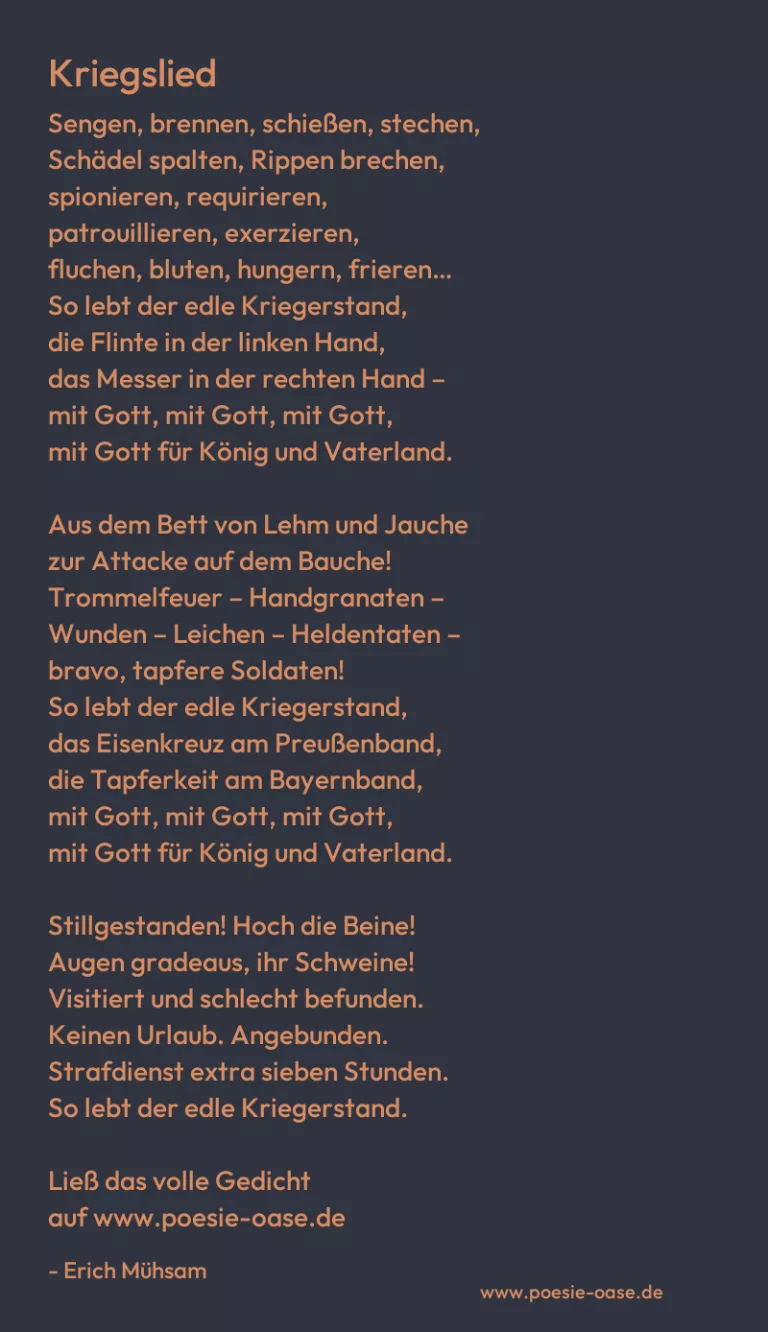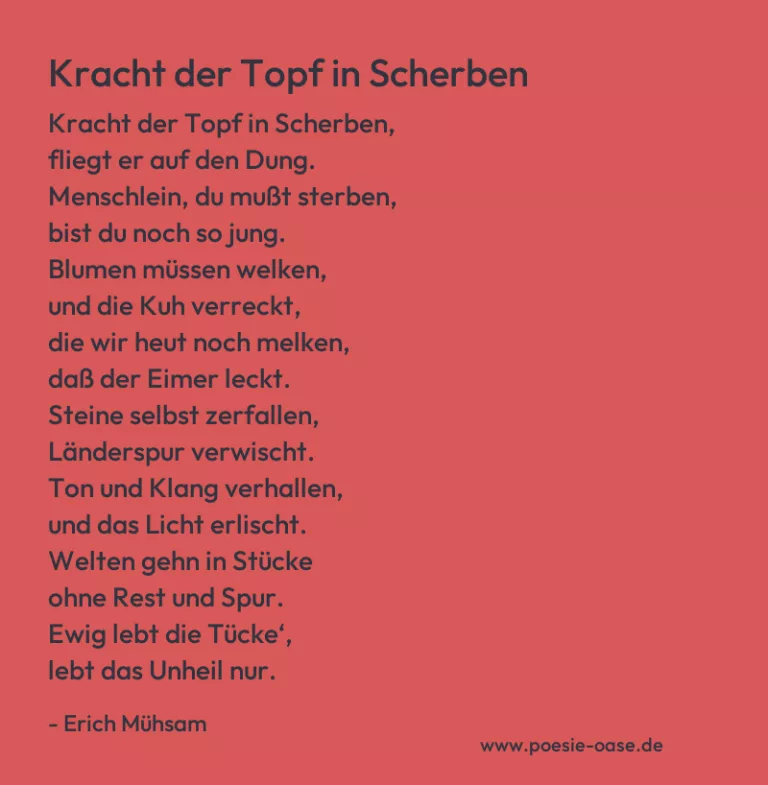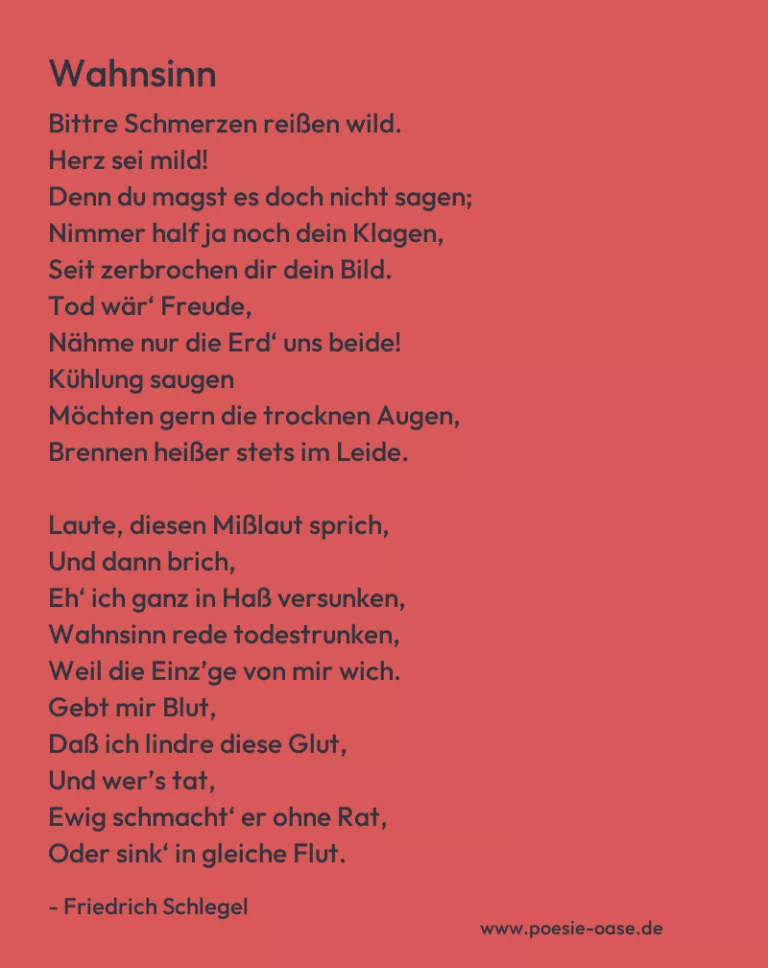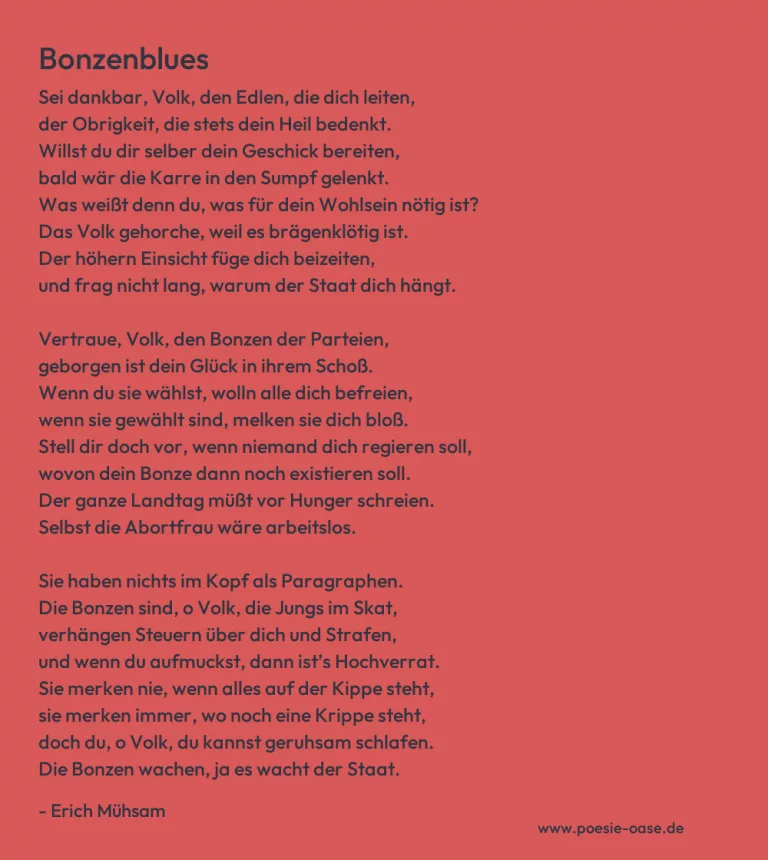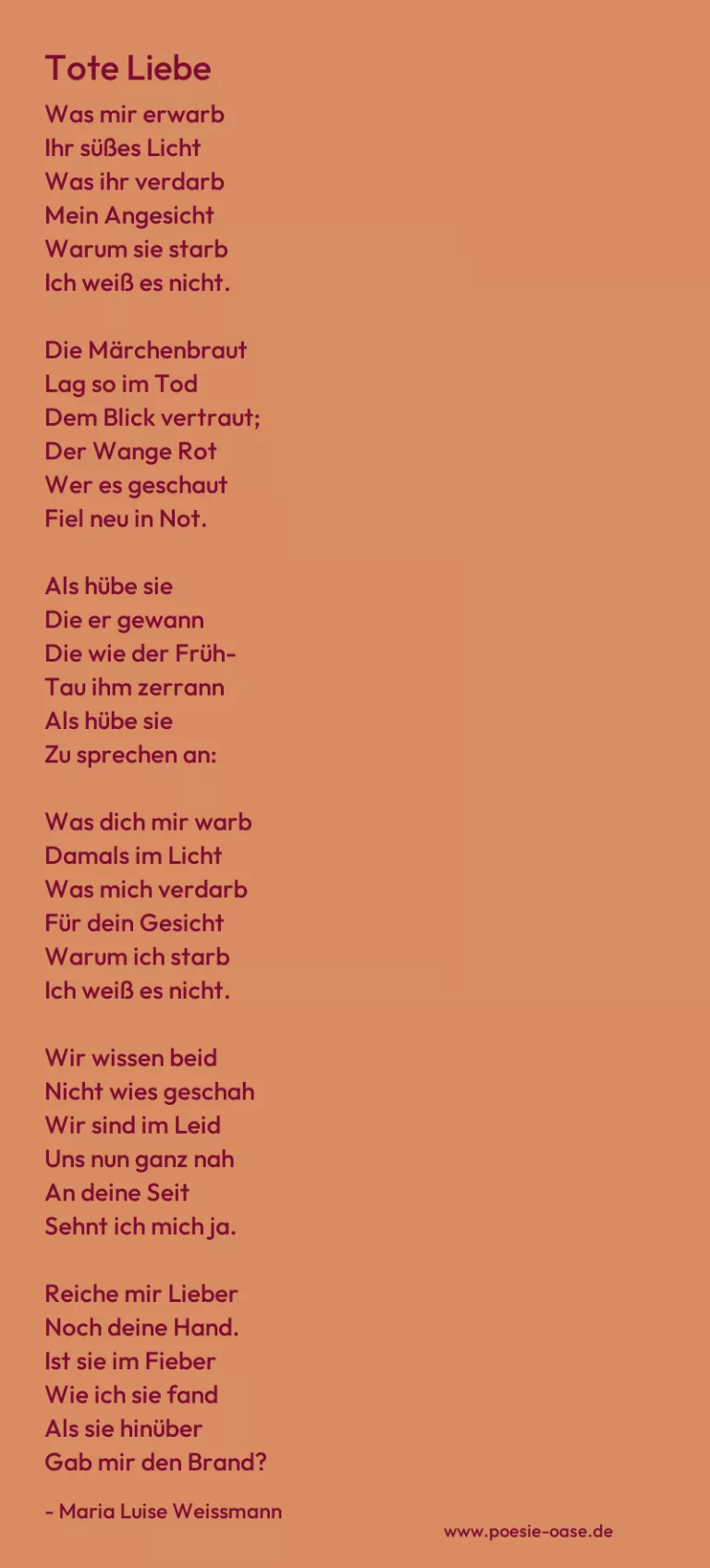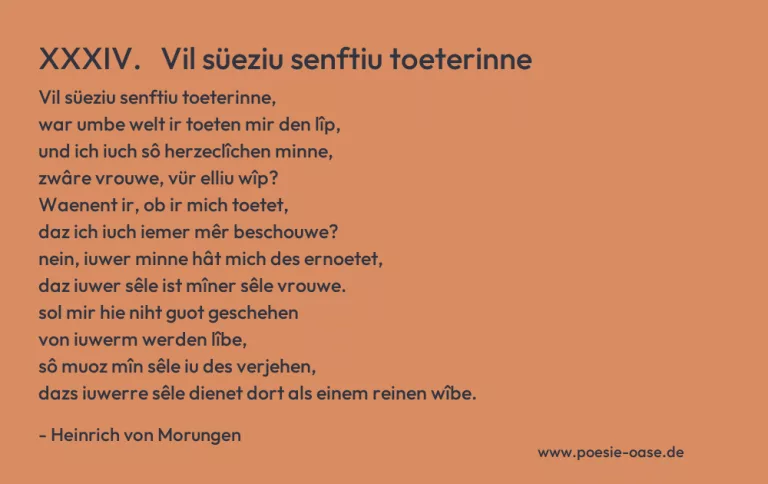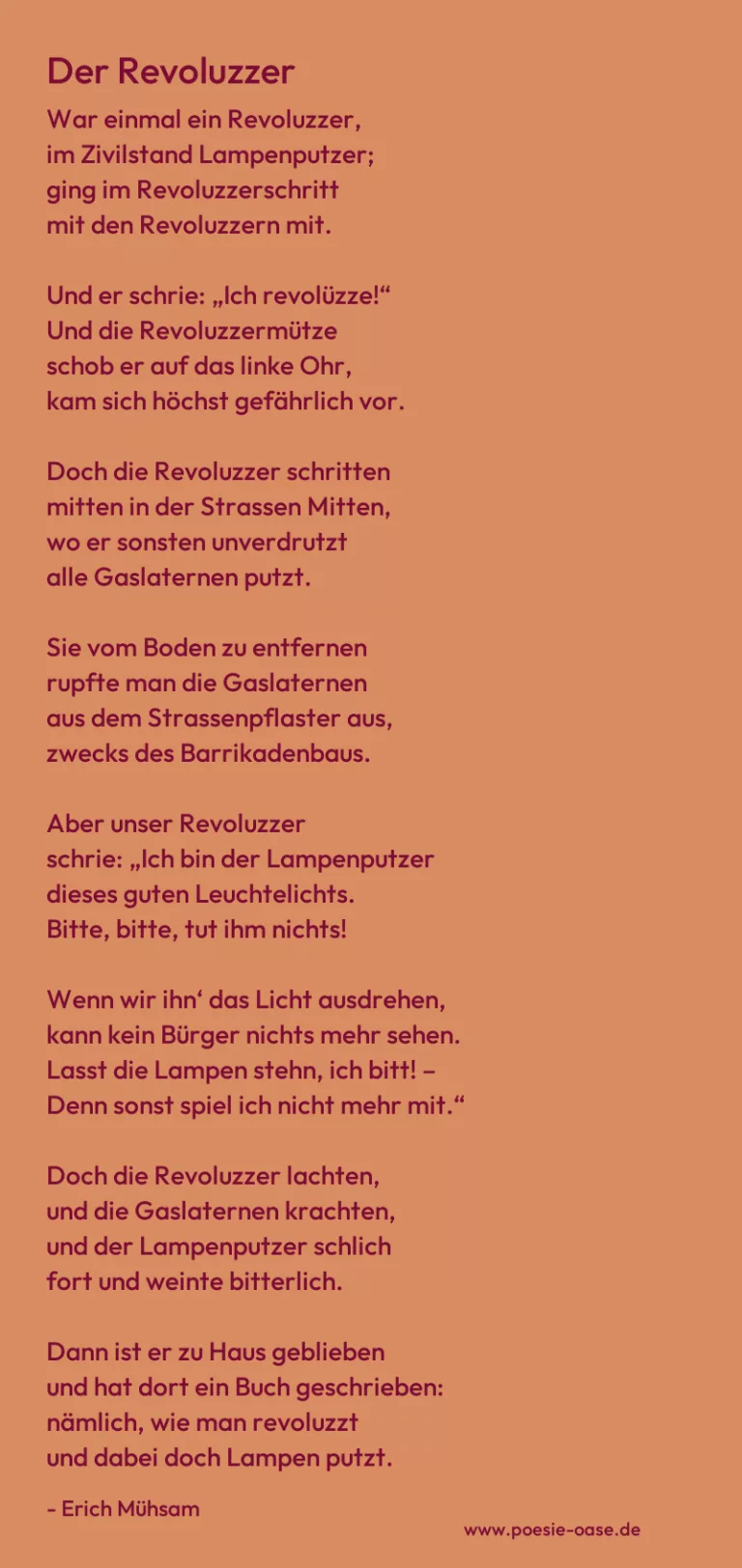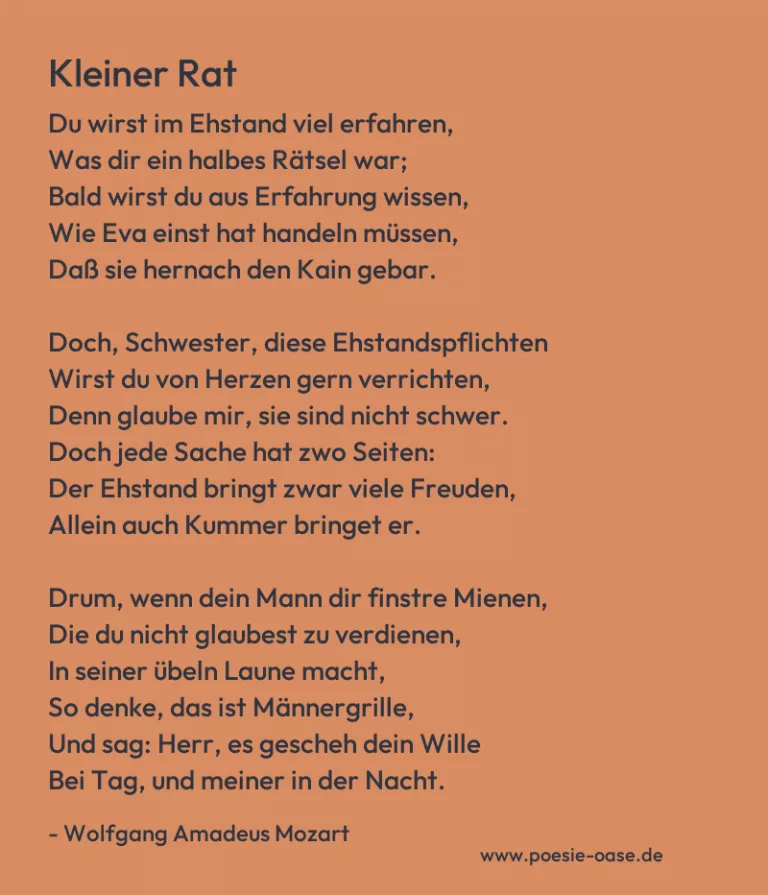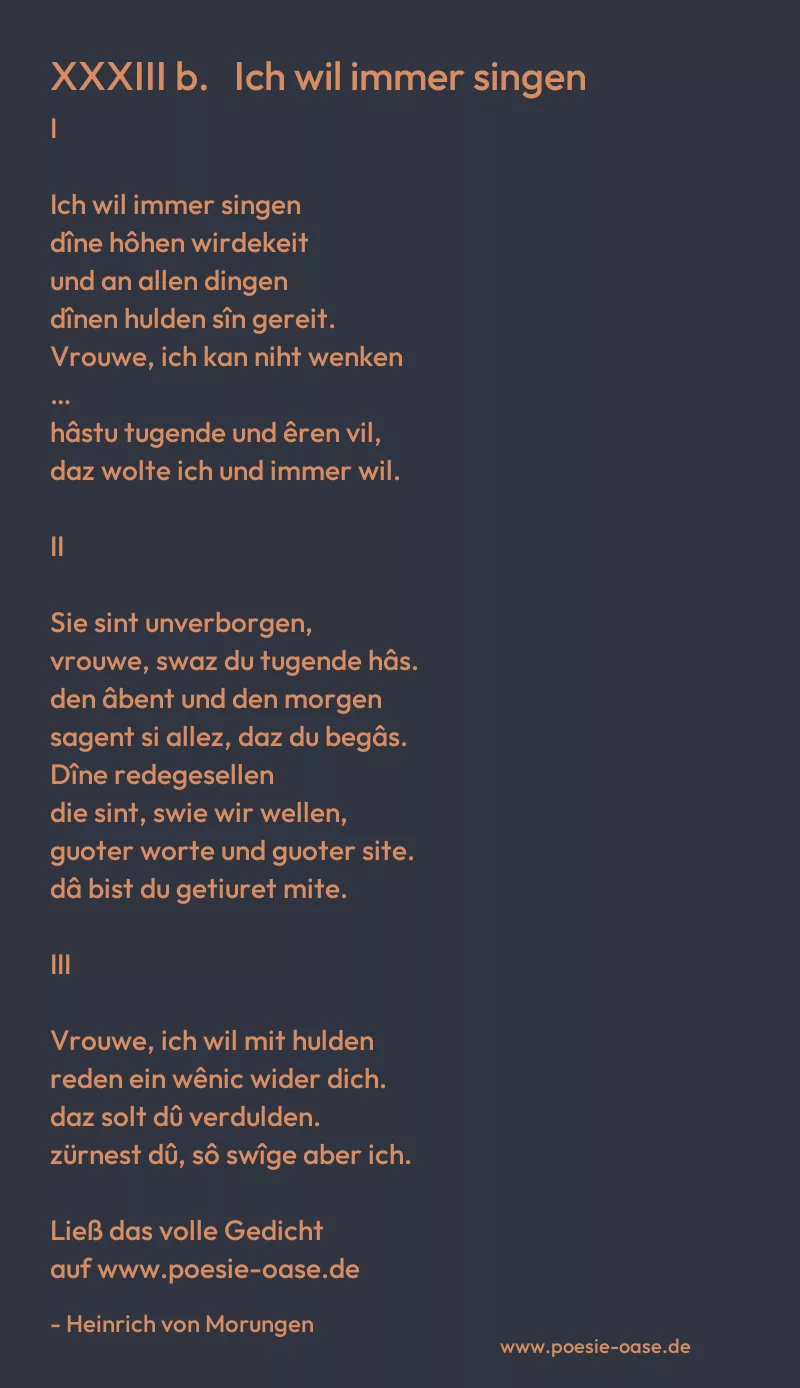XXXIII b. Ich wil immer singen
I
Ich wil immer singen
dîne hôhen wirdekeit
und an allen dingen
dînen hulden sîn gereit.
Vrouwe, ich kan niht wenken
…
hâstu tugende und êren vil,
daz wolte ich und immer wil.
II
Sie sint unverborgen,
vrouwe, swaz du tugende hâs.
den âbent und den morgen
sagent si allez, daz du begâs.
Dîne redegesellen
die sint, swie wir wellen,
guoter worte und guoter site.
dâ bist du getiuret mite.
III
Vrouwe, ich wil mit hulden
reden ein wênic wider dich.
daz solt dû verdulden.
zürnest dû, sô swîge aber ich.
Wilt du dîner jugende
kumen gar zuo tugende,
sô tuo vriunden vriuntschaft schîn,
swie dir doch ze muote sî.
IV
Nieman sol daz rechen,
ob ich hôhe sprüche hân.
wâ von sol der sprechen,
der nie hôhen muot gewan?
Ich hân hôchgemüete.
vrouwe, dîne güete,
sît ich die alrêrst sach,
sô weste ich wol, waz ich sprach.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
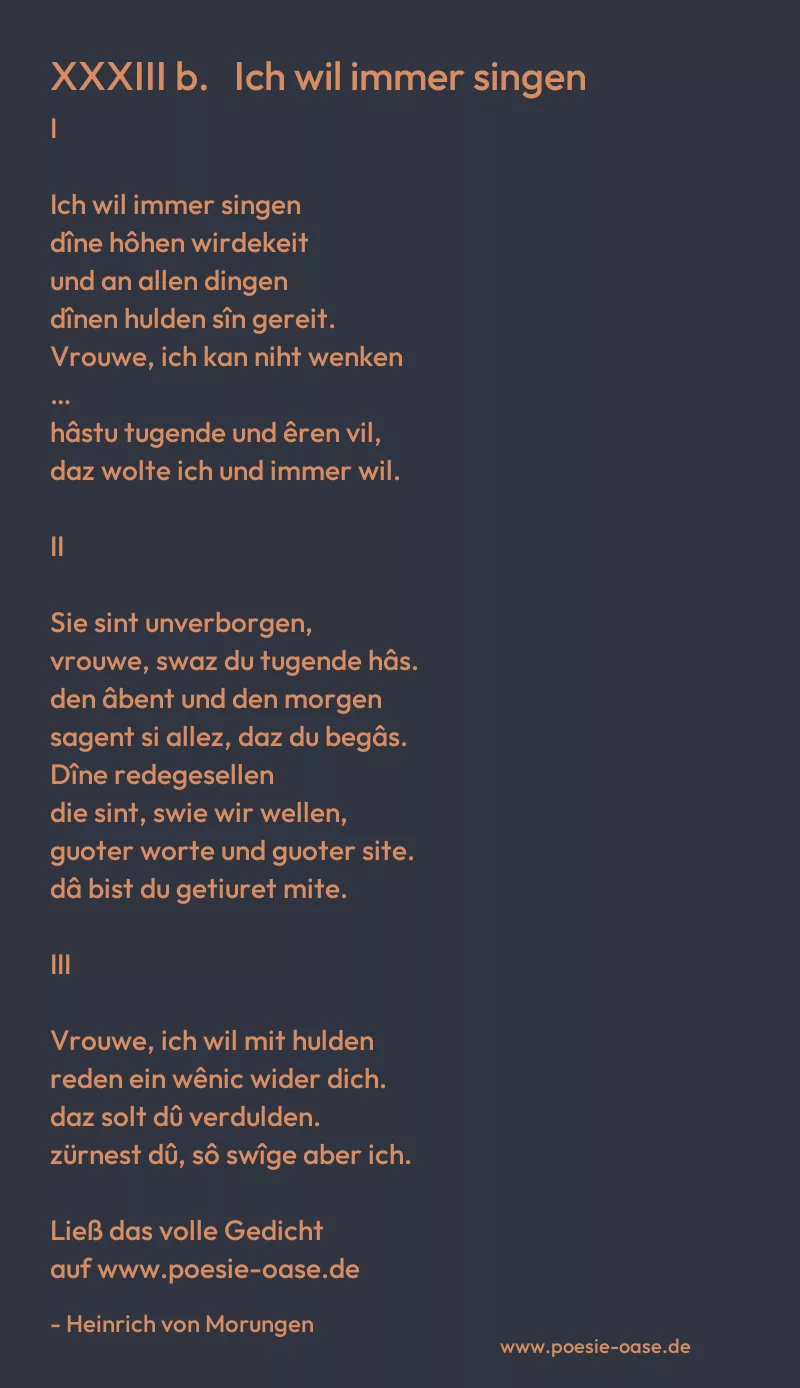
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „XXXIII b. Ich wil immer singen“ von Heinrich von Morungen ist ein kunstvoll gestaltetes Minnelied, das die hohe Wertschätzung des lyrischen Ichs für die Geliebte ausdrückt. Es setzt sich aus vier Strophen zusammen, in denen Bewunderung, Lobpreisung und eine feine Mischung aus Bitte und Tadel miteinander verwoben sind. Zentral ist dabei die Idee der hohen Minne – einer idealisierten, tugendhaften Liebe, in der das Streben nach innerer Veredelung und die Verehrung der Frau im Mittelpunkt stehen.
In der ersten Strophe kündigt das Ich an, stets von der „hôhen wirdekeit“ der Frau singen zu wollen. Diese Haltung entspricht dem ritterlich-höfischen Ideal, in dem der Sänger seine Rolle als Diener der Dame versteht und durch seine Hingabe ihre Tugenden verherrlicht. Es geht ihm nicht nur um persönliche Gunst, sondern auch um die Anerkennung ihrer Würde und ihres hohen gesellschaftlichen wie moralischen Standes.
Die zweite Strophe unterstreicht die Unverkennbarkeit ihrer Tugend. Nicht nur das lyrische Ich, sondern „den âbent und den morgen“ erzählen alle von ihren Taten – ihr Ruf eilt ihr voraus. Auch ihre Umgebung – ihre „redegesellen“ – stehen beispielhaft für gute Sitte und Anstand. Damit wird die Geliebte in eine Sphäre moralischer Vollkommenheit erhoben, die über rein äußere Schönheit hinausgeht.
Die dritte Strophe bringt eine kleine Wende. Das Ich wagt es, die Frau höflich aufzufordern, ihre Jugend mit echter Tugend zu verbinden, indem sie „vriunden vriuntschaft schîn“ zeigt – also wahre Freundlichkeit gegenüber ihren Verehrern. Hier klingt vorsichtig Kritik an: Die Frau möge sich nicht nur durch Zurückhaltung und Distanz auszeichnen, sondern auch durch Gnade und Offenheit. Doch diese Mahnung geschieht in höflicher, fast demütiger Form, stets unter Vorbehalt ihres Zorns.
Die letzte Strophe rechtfertigt die hohen Worte des Ichs. Er spricht aus einem „hôchgemüete“, einem edlen, innerlich gehobenen Gemüt, das seine Quelle in der Güte der Frau hat. Seit er sie das erste Mal gesehen hat, weiß er, wovon er spricht. Diese finale Beteuerung verleiht dem Gedicht einen selbstbewussten Abschluss: Die Liebe zur Frau ist nicht bloße Schwärmerei, sondern Ausdruck eines innerlich geläuterten und wahrhaft hohen Gefühls.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.