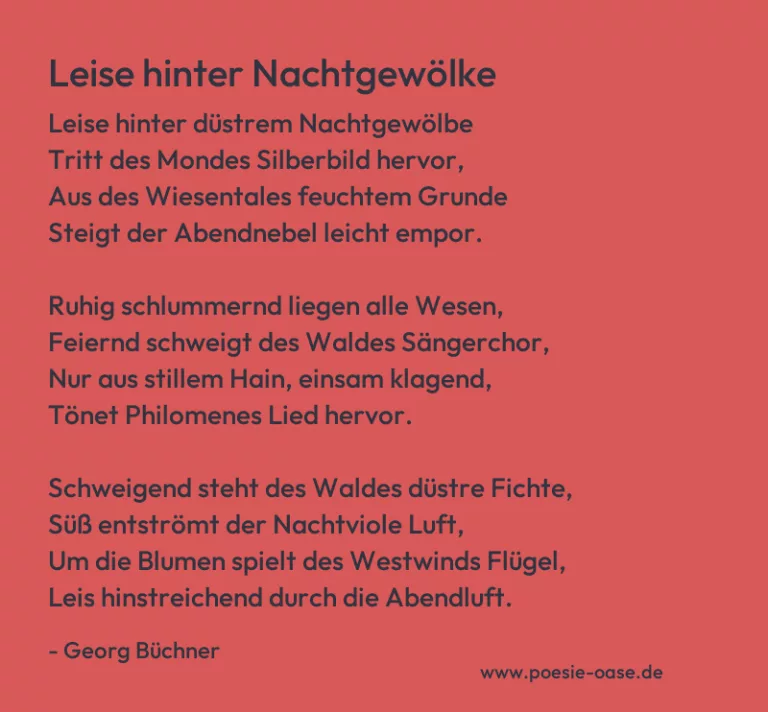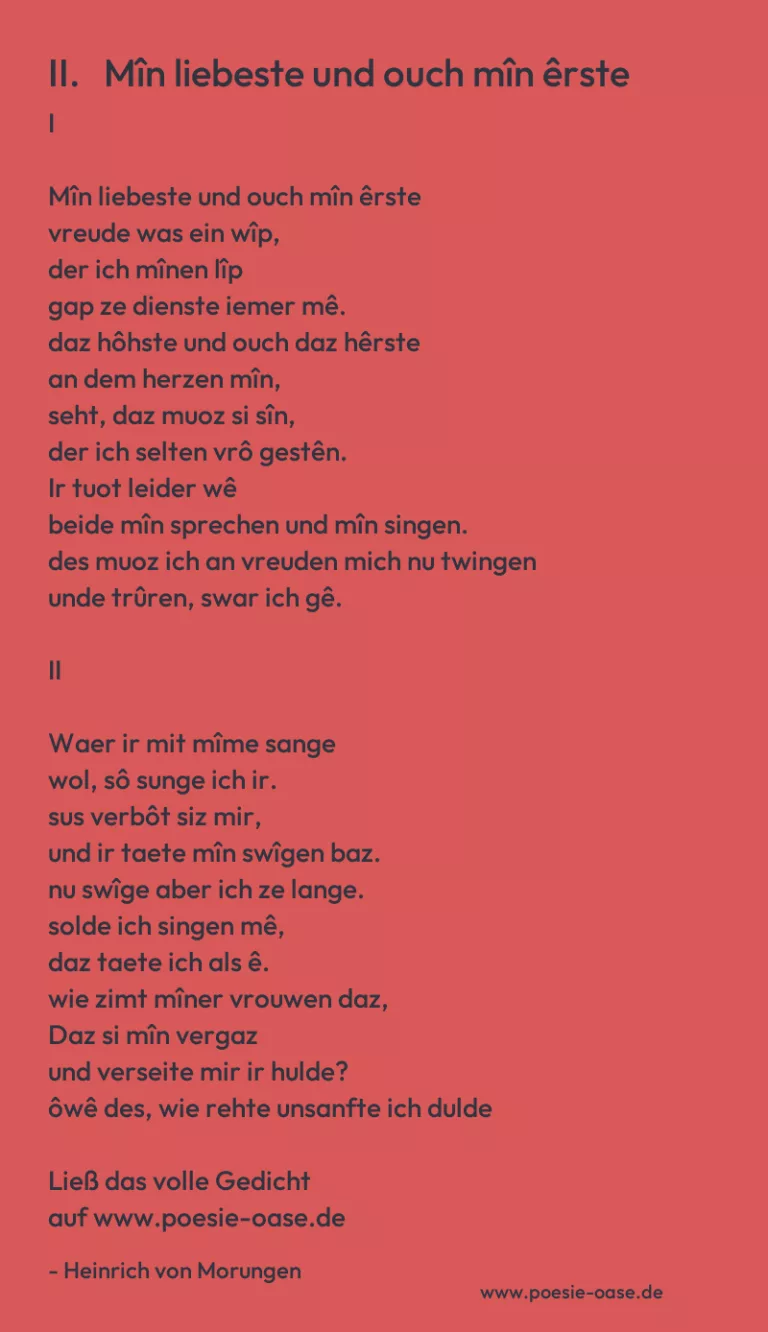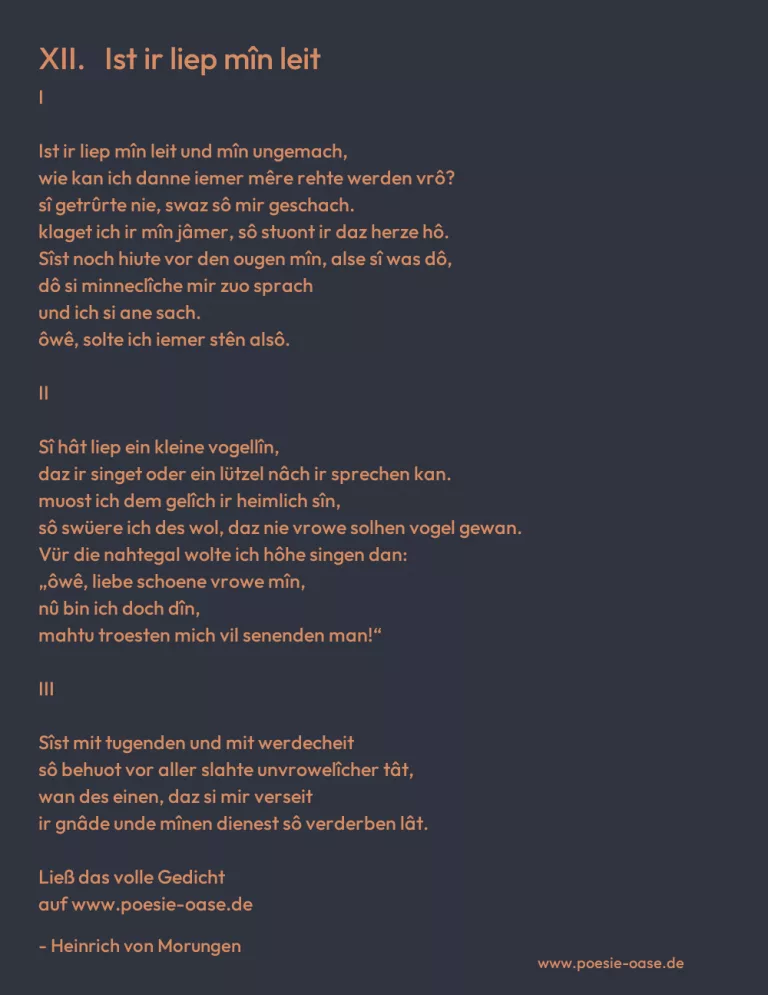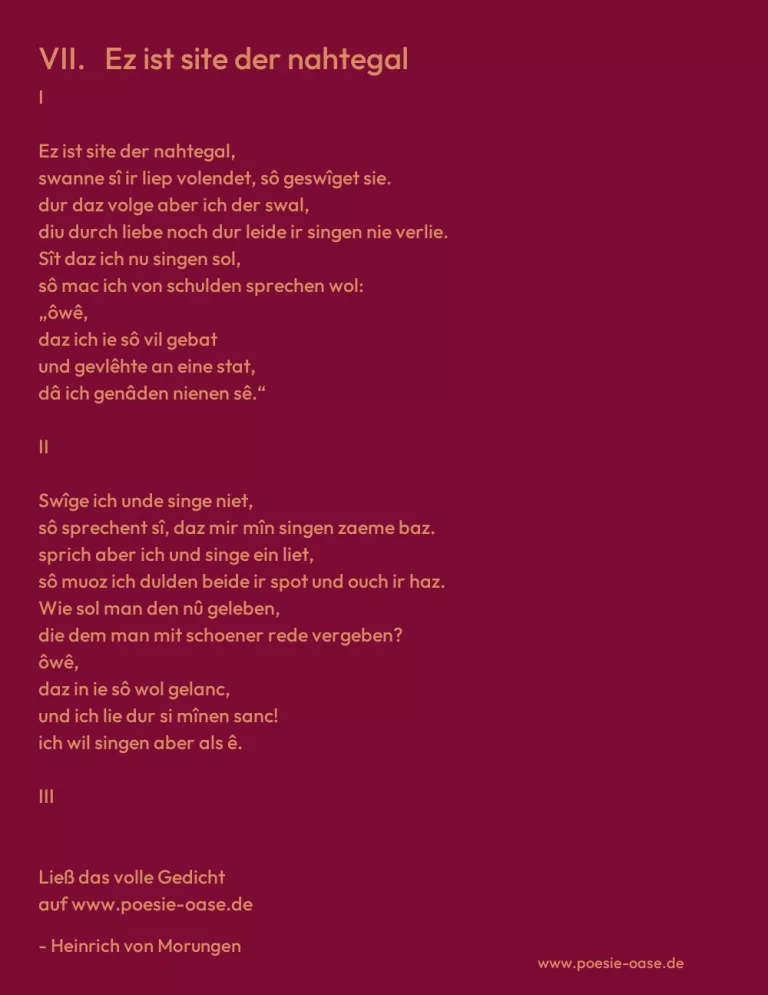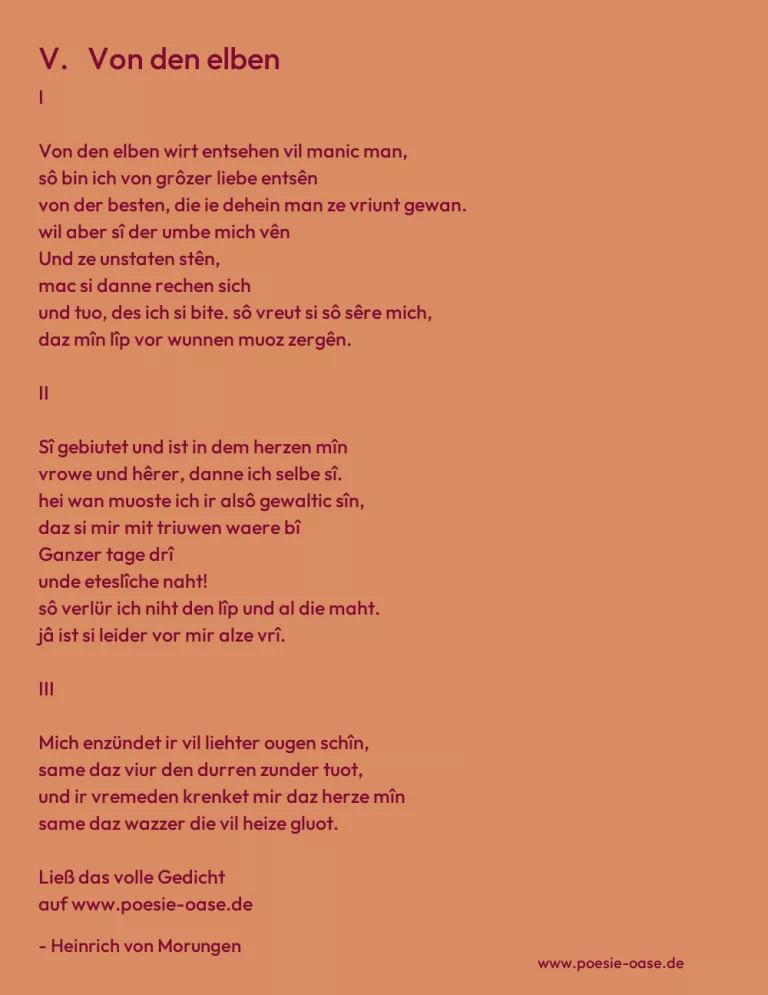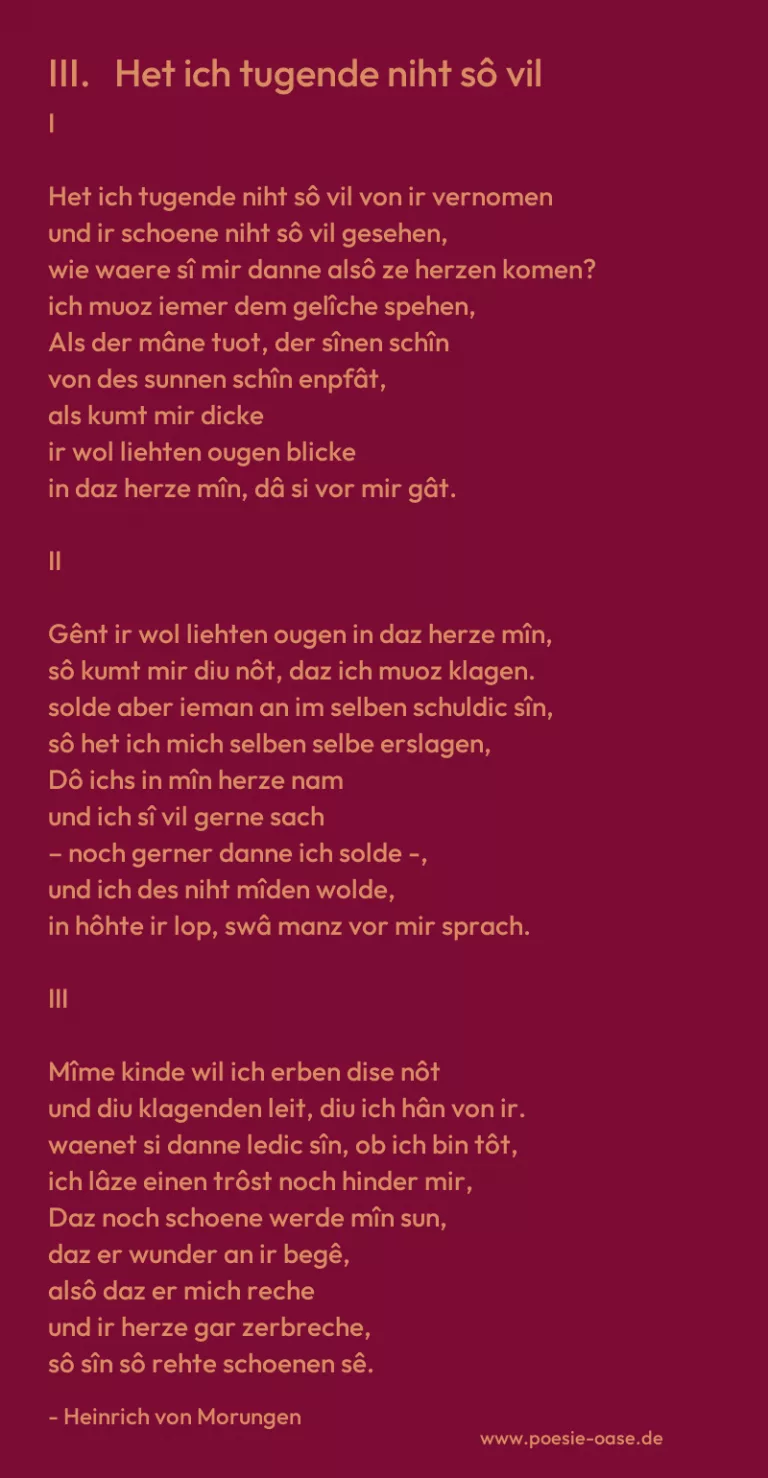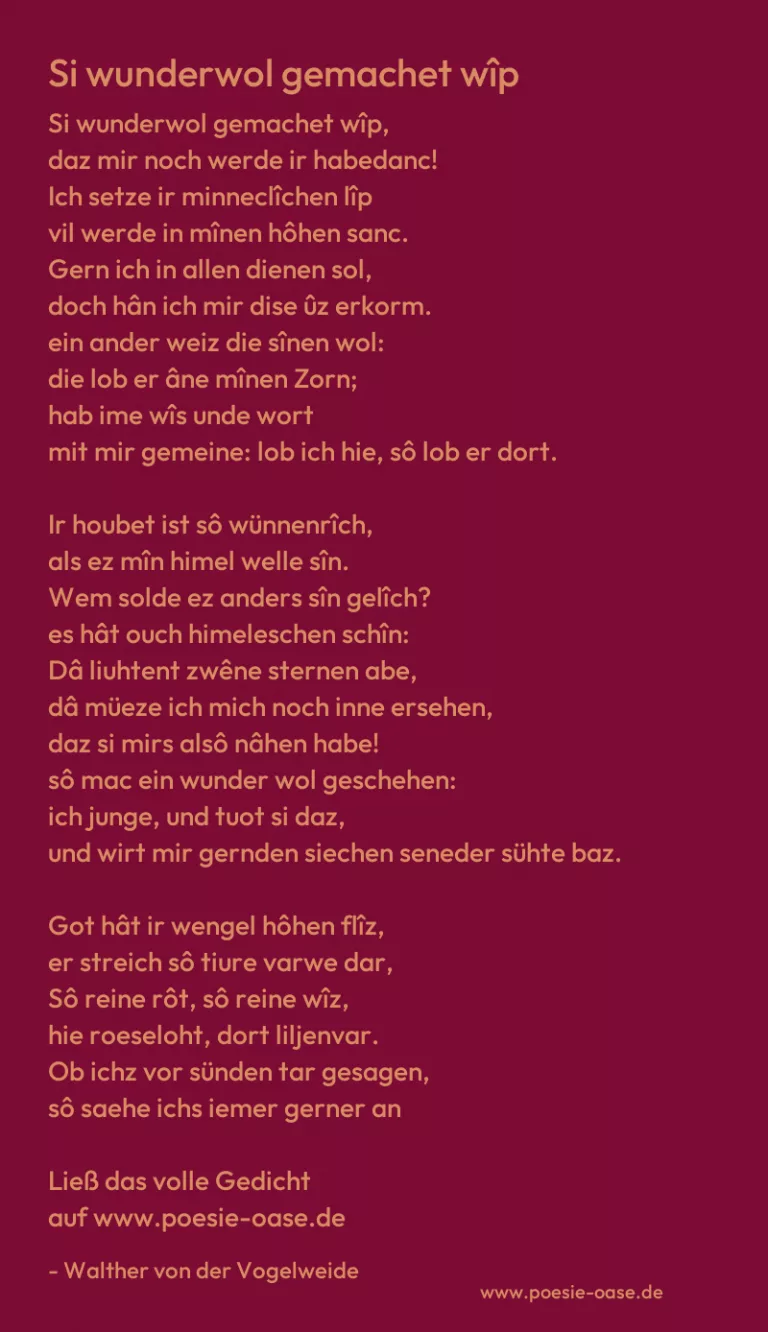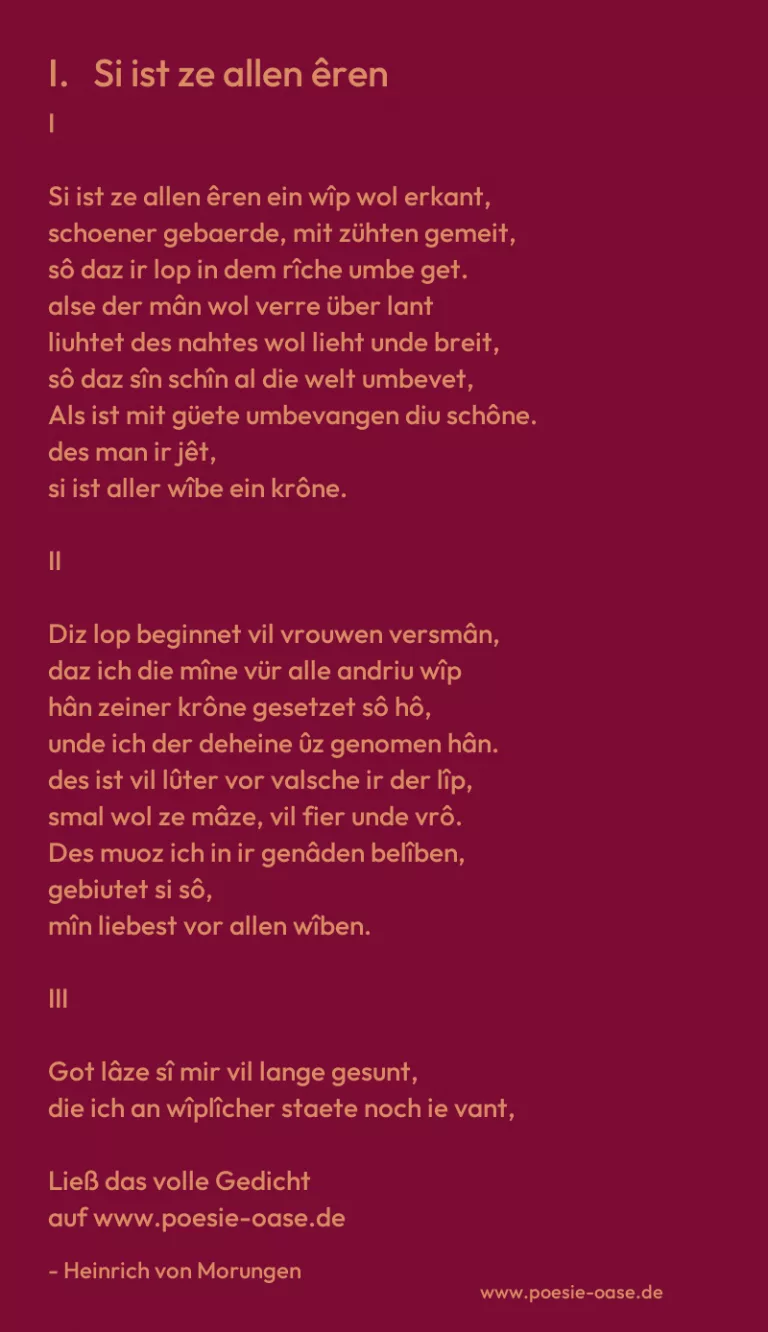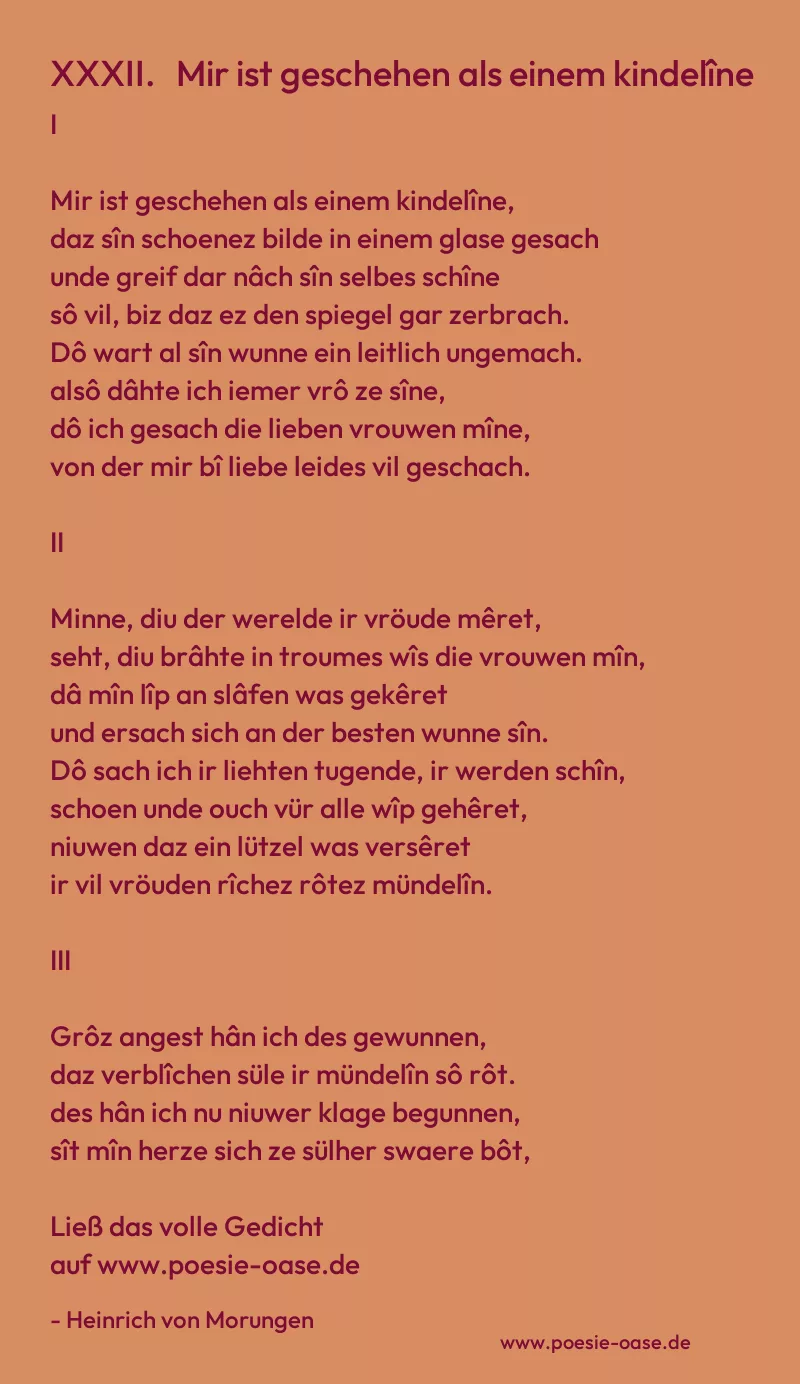XXXII. Mir ist geschehen als einem kindelîne
I
Mir ist geschehen als einem kindelîne,
daz sîn schoenez bilde in einem glase gesach
unde greif dar nâch sîn selbes schîne
sô vil, biz daz ez den spiegel gar zerbrach.
Dô wart al sîn wunne ein leitlich ungemach.
alsô dâhte ich iemer vrô ze sîne,
dô ich gesach die lieben vrouwen mîne,
von der mir bî liebe leides vil geschach.
II
Minne, diu der werelde ir vröude mêret,
seht, diu brâhte in troumes wîs die vrouwen mîn,
dâ mîn lîp an slâfen was gekêret
und ersach sich an der besten wunne sîn.
Dô sach ich ir liehten tugende, ir werden schîn,
schoen unde ouch vür alle wîp gehêret,
niuwen daz ein lützel was versêret
ir vil vröuden rîchez rôtez mündelîn.
III
Grôz angest hân ich des gewunnen,
daz verblîchen süle ir mündelîn sô rôt.
des hân ich nu niuwer klage begunnen,
sît mîn herze sich ze sülher swaere bôt,
Daz ich durch mîn ouge schouwe sülhe nôt
sam ein kint, daz wîsheit unversunnen
sînen schaten ersach in einem brunnen
und den minnen muoz unz an sînen tôt.
IV
Hôher wîp von tugenden und von sinnen
die enkan der himel niender ummevân
sô die guoten, die ich vor ungewinne
vremden muoz und immer doch an ir bestân.
Owê leider, jô wânde ichs ein ende hân
ir vil wunnenclîchen werden minne.
nû bin ich vil kûme an dem beginne.
des ist hin mîn wunne und ouch mîn gerender wân.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
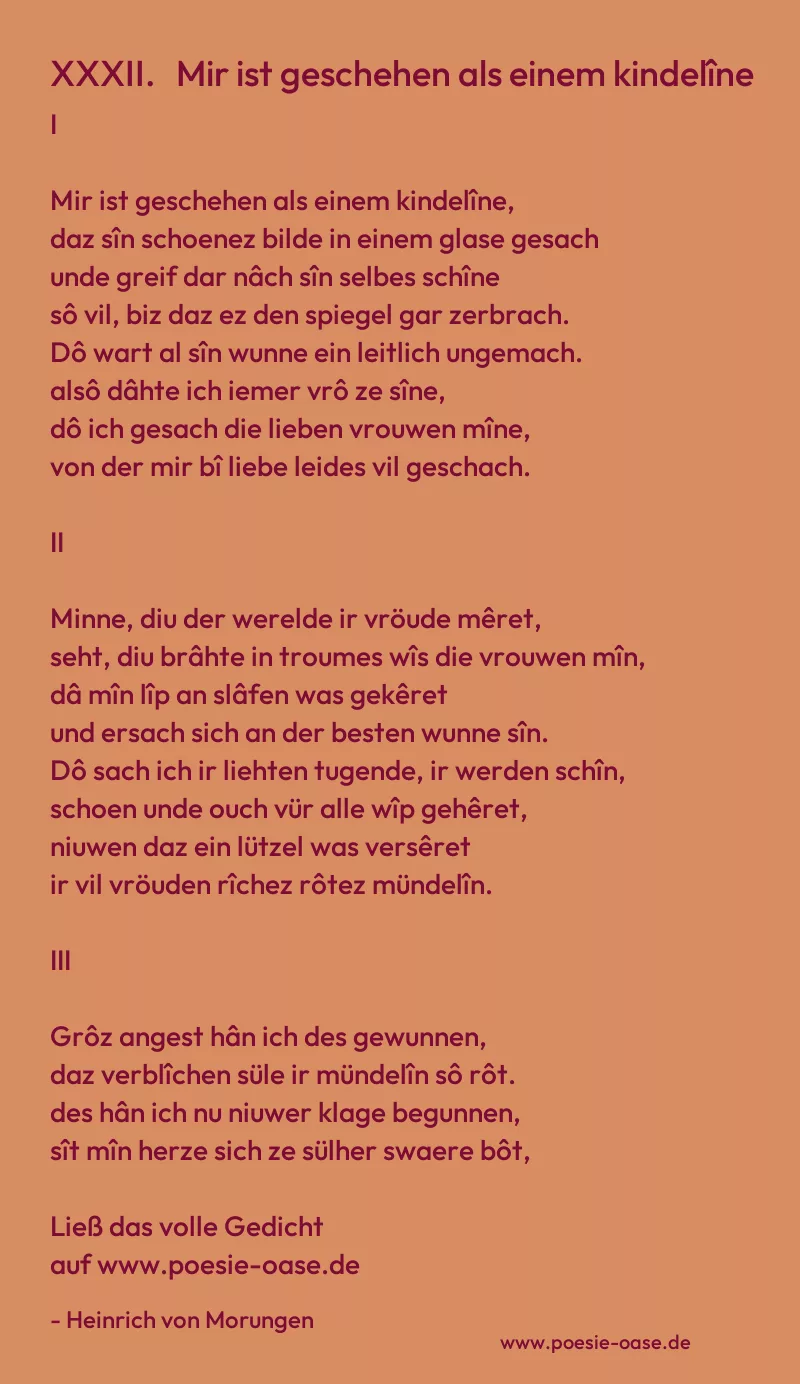
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „XXXII. Mir ist geschehen als einem kindelîne“ von Heinrich von Morungen entfaltet in vier kunstvoll gestalteten Strophen eine tiefe Allegorie der unerfüllten Liebe, in der die Grenzen zwischen Traum, Spiegelbild und Wirklichkeit verschwimmen. Im Zentrum steht ein lyrisches Ich, das wie ein ahnungsloses Kind einem Trugbild nachjagt – der schönen Erscheinung einer Frau, die in ihrer Unerreichbarkeit zugleich Quelle tiefster Wonne und schmerzlichster Klage wird.
Die erste Strophe setzt mit einem eindrücklichen Bild ein: Ein Kind, das sein eigenes Spiegelbild erblickt, danach greift und schließlich den Spiegel zerbricht. Diese Szene dient als Metapher für das Erleben des Ichs, das beim Anblick seiner Geliebten glaubt, Glück gefunden zu haben – doch der Wunsch nach Nähe zerstört die Illusion. Aus Freude wird Leid. Die Frau, von der er spricht, ist nicht einfach eine Geliebte im weltlichen Sinn, sondern ein Idealbild, das sich der Annäherung entzieht.
In der zweiten Strophe wird diese Erfahrung noch gesteigert durch die Vorstellung eines Traums: Die Minne selbst bringt ihm im Schlaf die Frau, die „vür alle wîp gehêret“, also über alle anderen Frauen erhaben ist. Ihr „rîchez rôtez mündelîn“, das kleine rote Mündlein, wird zur Quelle höchster Freude – aber auch dieses Bild ist vergänglich. Es zeigt sich hier eine Spannung zwischen idealisierter Schönheit und der Angst vor dem Verblassen dieser Erscheinung.
Die dritte Strophe bringt die Furcht vor Verlust zum Ausdruck. Die Angst, dass das „mündelîn“ verblassen könnte, treibt den Sprecher in neue Klage. Er vergleicht sich mit einem Kind, das seinen eigenen Schatten im Brunnen sieht – eine poetische Umschreibung für das Erkennen einer trügerischen, nicht greifbaren Realität. Wie dieses Kind bleibt auch er gefangen in der Illusion, deren emotionale Wucht ihn lebenslang prägt. Die Liebe wird so zu einer existenziellen Kraft, die bis zum Tod wirkt.
In der vierten Strophe vollzieht sich ein Stimmungsumschwung hin zur Resignation. Die Frau, eine „hôher wîp von tugenden und von sinnen“, bleibt dem Ich fremd und unerreichbar, obwohl er ihr ewig treu bleibt. Der Gedanke, dass die Liebe ein Ende haben könnte, erweist sich als trügerisch. Statt Erfüllung bringt sie Enttäuschung – das erhoffte Glück erweist sich als bloßer Anfang ständiger Sehnsucht. Das Gedicht endet so in einem tief melancholischen Ton, der die Vergänglichkeit der Liebe und die Tragik des liebenden Ichs betont.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.