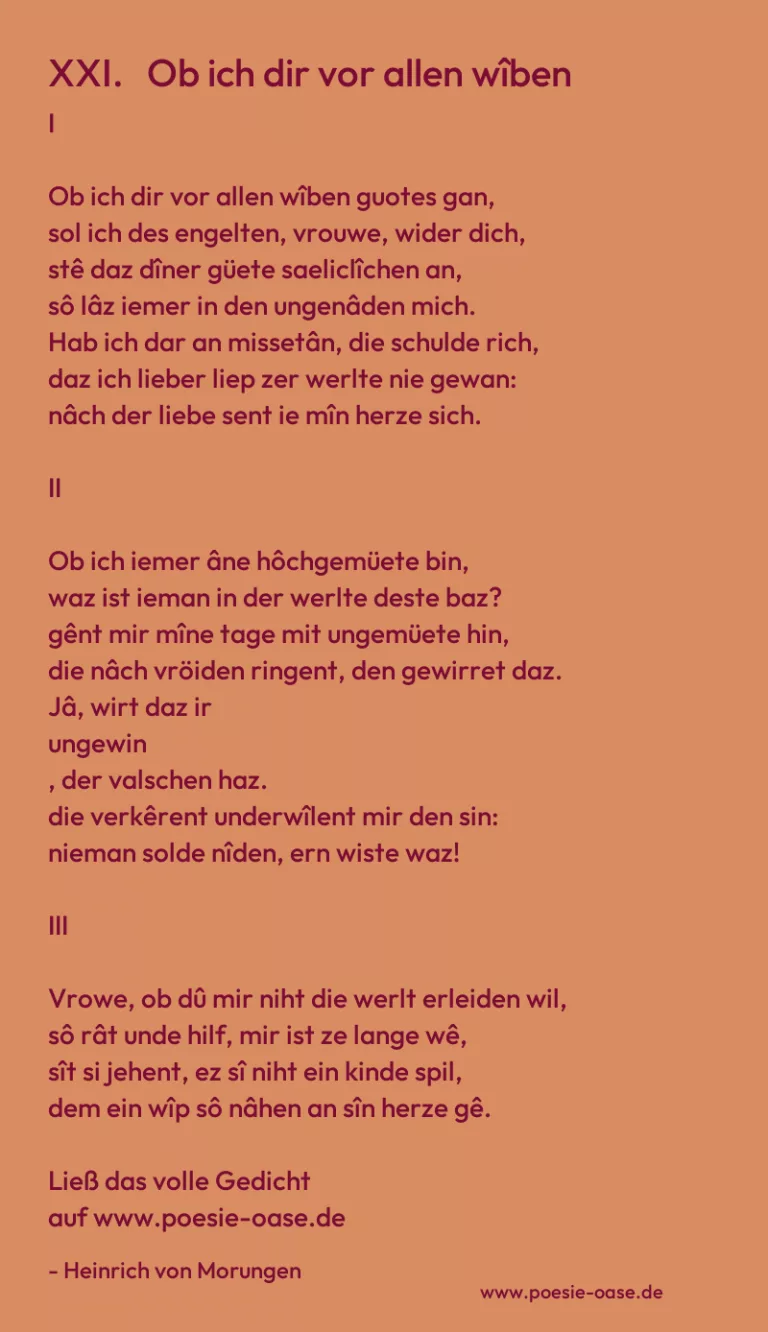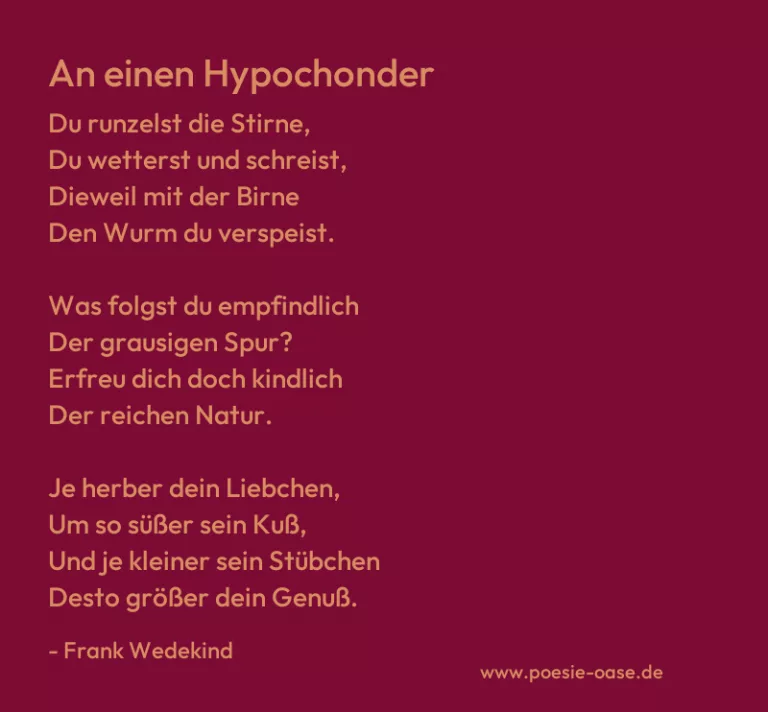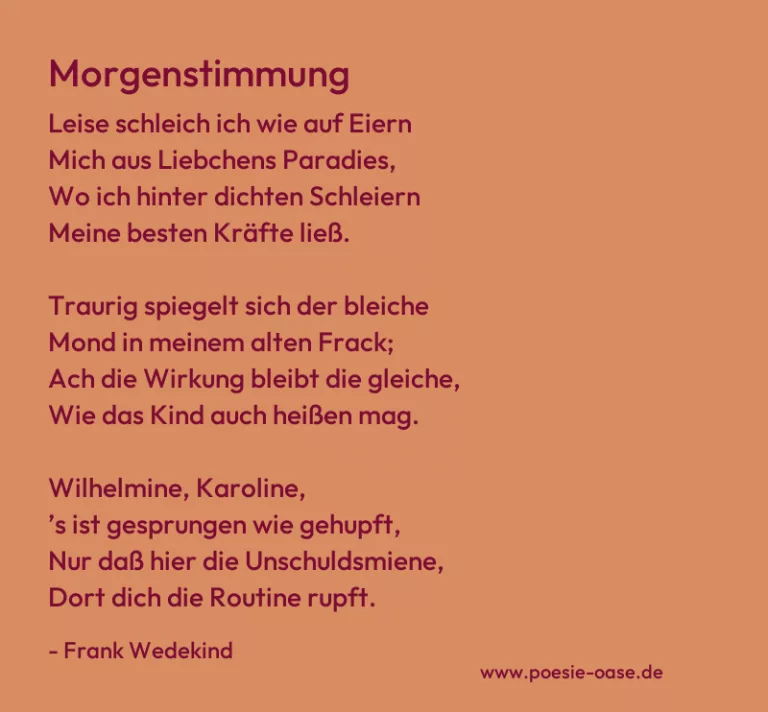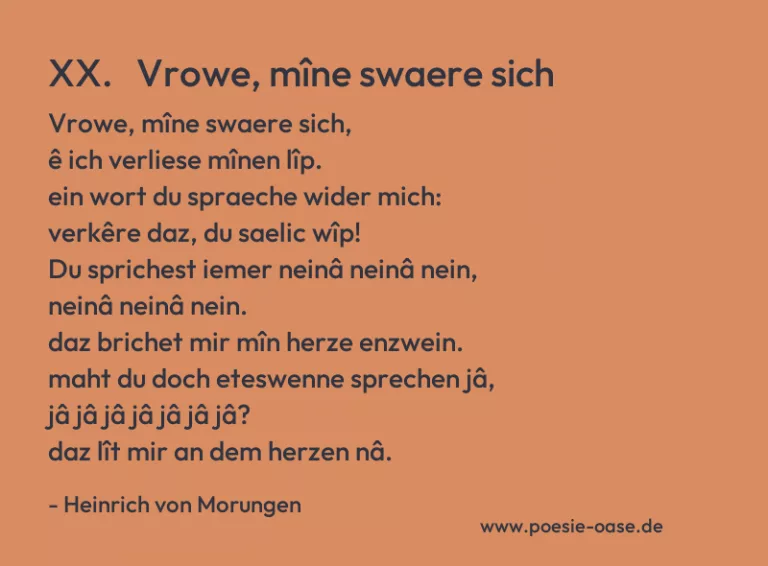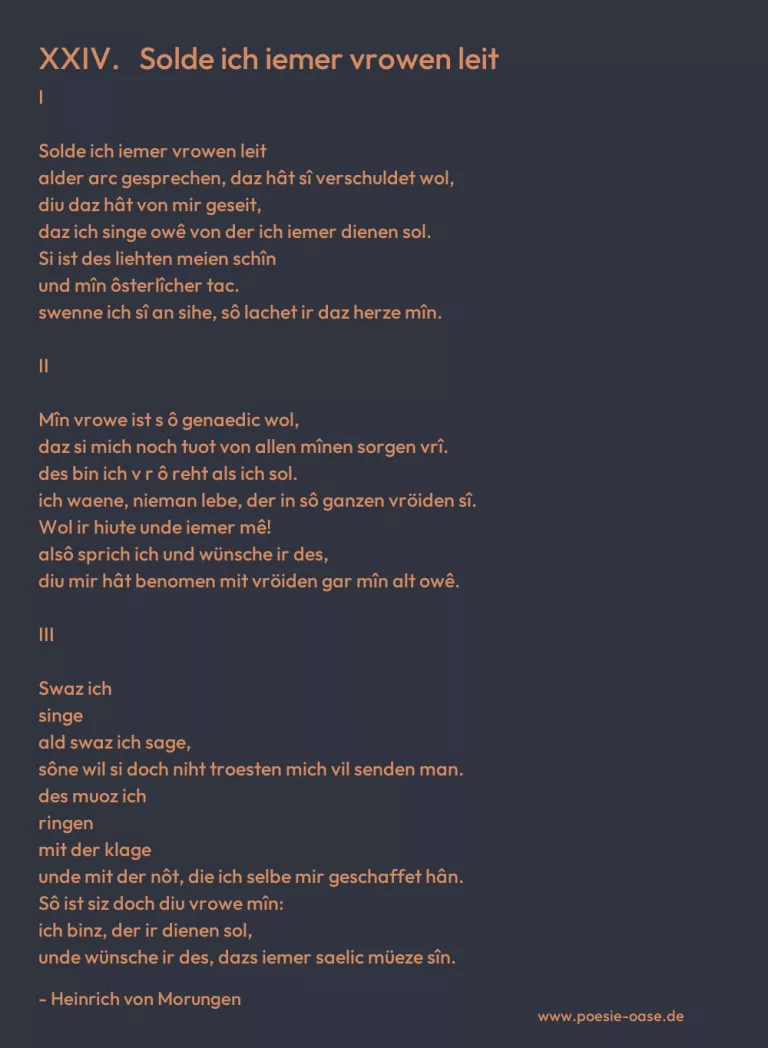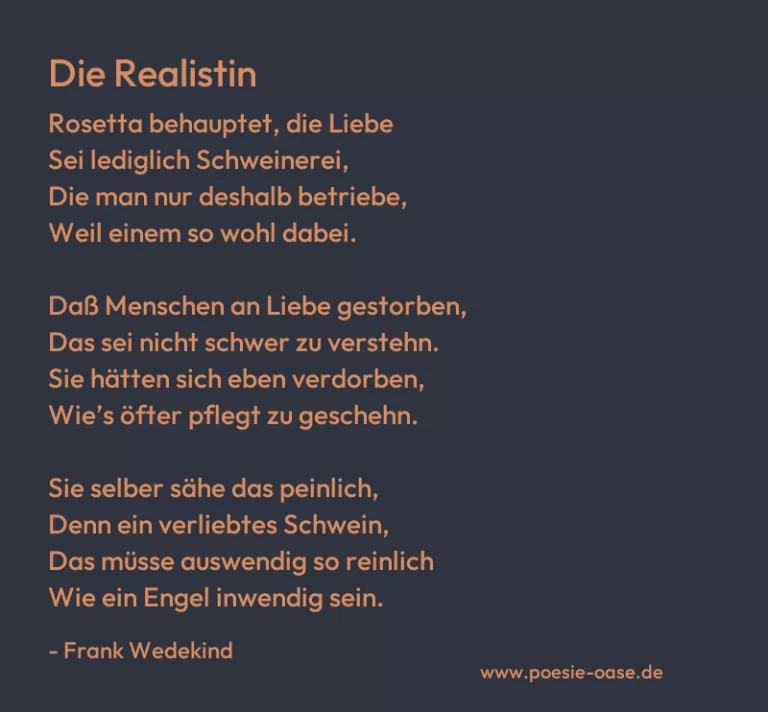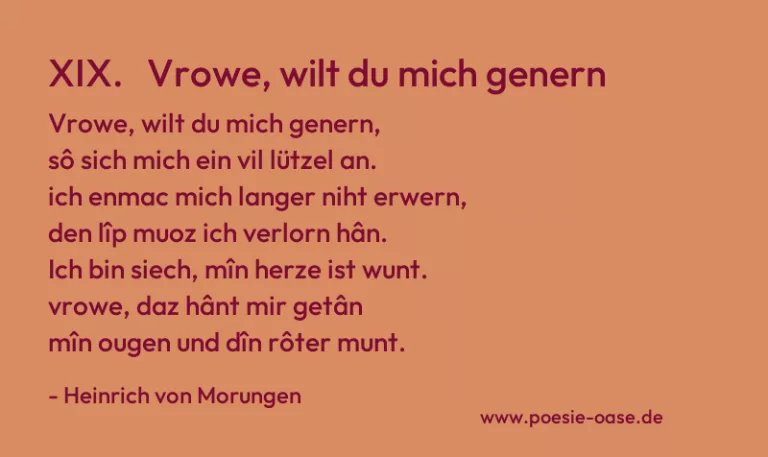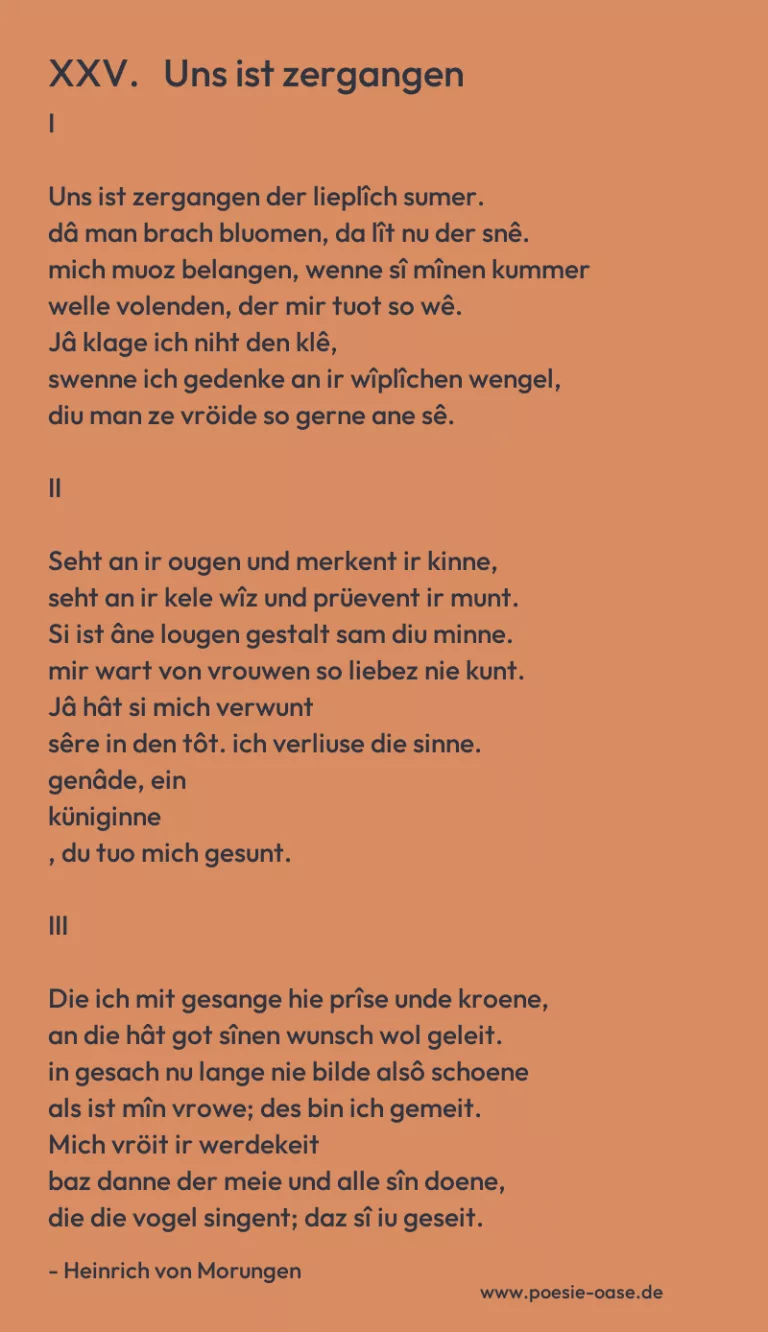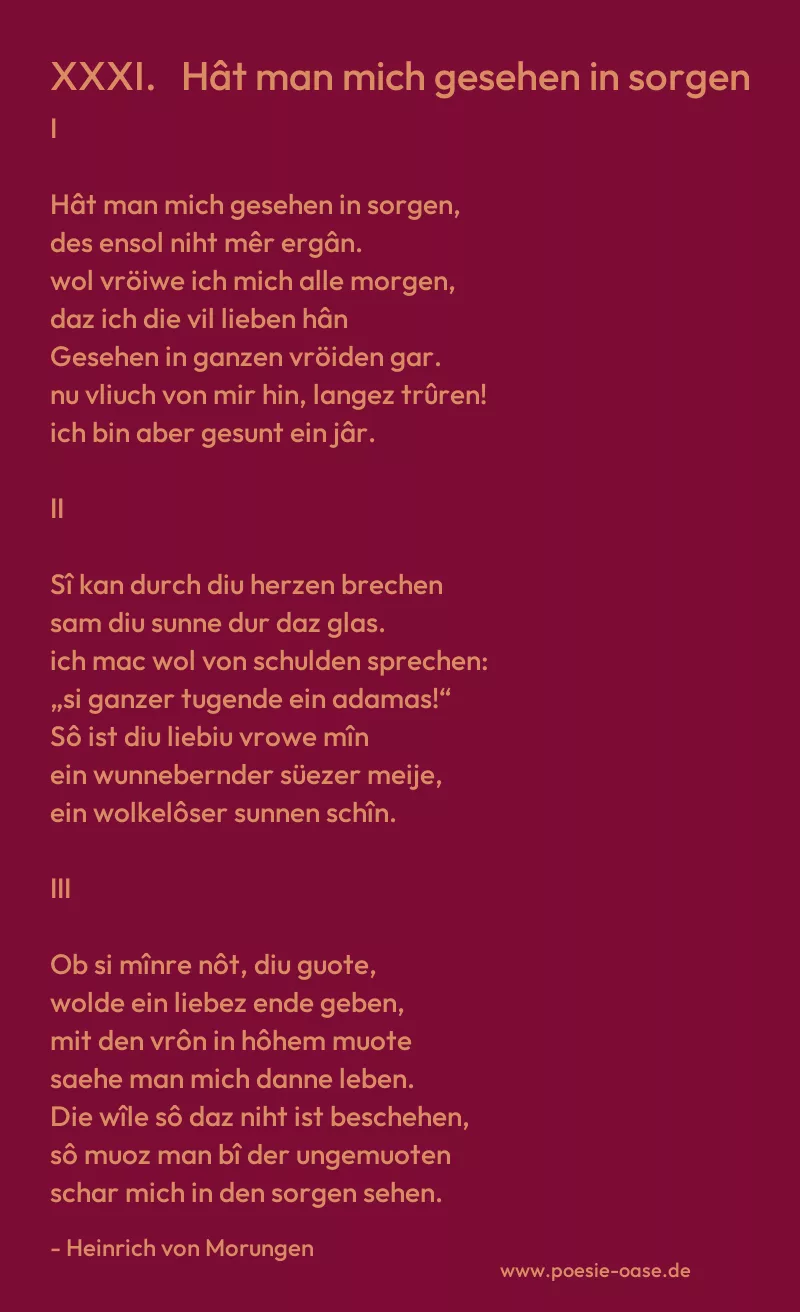XXXI. Hât man mich gesehen in sorgen
I
Hât man mich gesehen in sorgen,
des ensol niht mêr ergân.
wol vröiwe ich mich alle morgen,
daz ich die vil lieben hân
Gesehen in ganzen vröiden gar.
nu vliuch von mir hin, langez trûren!
ich bin aber gesunt ein jâr.
II
Sî kan durch diu herzen brechen
sam diu sunne dur daz glas.
ich mac wol von schulden sprechen:
„si ganzer tugende ein adamas!“
Sô ist diu liebiu vrowe mîn
ein wunnebernder süezer meije,
ein wolkelôser sunnen schîn.
III
Ob si mînre nôt, diu guote,
wolde ein liebez ende geben,
mit den vrôn in hôhem muote
saehe man mich danne leben.
Die wîle sô daz niht ist beschehen,
sô muoz man bî der ungemuoten
schar mich in den sorgen sehen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
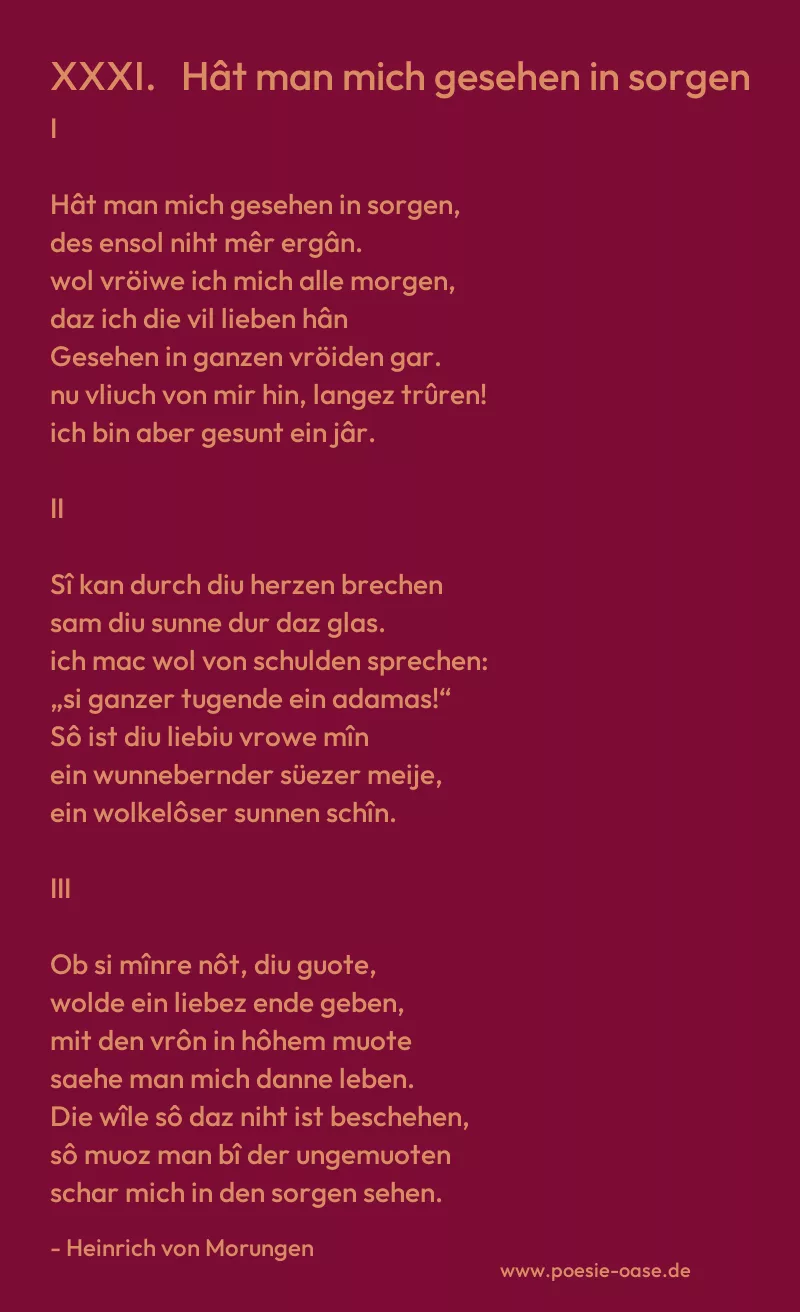
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Hât man mich gesehen in sorgen“ von Heinrich von Morungen drückt die tiefe Sehnsucht des lyrischen Ichs nach Liebe und die damit verbundenen emotionalen Schwankungen aus. In der ersten Strophe schildert der Sprecher eine Zeit, in der er von Sorgen geplagt war, aber dennoch Freude an der Liebe empfand. Der Satz „wol vröiwe ich mich alle morgen“ verweist auf die täglichen Momente des Glücks und die Hoffnung, die ihm durch die Liebe gegeben werden. Doch trotz dieser Freude gibt es auch Raum für tiefes Leid, da er die „vile lieben hân“, also viele verschiedene Facetten der Liebe, erlebt hat. In der letzten Zeile der Strophe kommt eine gewisse Erleichterung zum Ausdruck: „ich bin aber gesunt ein jâr“, was darauf hinweist, dass der Sprecher nun nach einer Zeit der Sorge wieder zu innerer Gesundheit und Stabilität gefunden hat. Die Sorge scheint also vorübergehend gewesen zu sein.
Die zweite Strophe widmet sich der Darstellung der geliebten Frau und ihrer außergewöhnlichen Wirkung auf das Herz des Sprechers. Der Vergleich „durch diu herzen brechen / sam diu sunne dur daz glas“ zeigt, wie mächtig ihre Präsenz und Ausstrahlung sind – wie die Sonne, die das Glas durchbricht, kann ihre Liebe das Herz des Sprechers zutiefst erreichen. Der Sprecher beschreibt sie als „ein wunnebernder süezer meije“, was sie als perfekte und unbeschreiblich süße Frau idealisiert. Die Frau wird als „wolkelôser sunnen schîn“ beschrieben, was sie als Quelle von Licht und Klarheit im Leben des Sprechers darstellt, wobei „wolkelôser“ auf die ungetrübte und makellose Qualität ihrer Liebe hinweist.
In der dritten Strophe verweist der Sprecher darauf, dass, obwohl seine geliebte Frau ihm Trost und Erfüllung bringen könnte, ihre Liebe ihm nicht vollständig gegeben ist. Die Zeilen „ob si mînre nôt, diu guote, / wolde ein liebez ende geben“ deuten darauf hin, dass er sich in einer Situation befindet, in der die Liebe seiner Frau ihm nicht den erhofften Frieden oder die erlösende Lösung für seine Sorgen bietet. Der „hohe muote“ der Frau verweist darauf, dass ihre Haltung oder ihre Selbstgenügsamkeit sie daran hindern, sich vollständig auf den Sprecher einzulassen. Bis dieser Zustand der Erfüllung eintritt, muss der Sprecher weiterhin in seinen Sorgen verbleiben und „bei der ungemuoten schar“ gesehen werden – ein Hinweis darauf, dass die Unvollkommenheit und das Fehlen einer Lösung für seine emotionalen Turbulenzen weiterhin zu sehen sind.
Heinrich von Morungen beschreibt in diesem Gedicht die widersprüchliche Natur von Liebe und Sorge: einerseits bringt die Liebe Freude und Erfüllung, andererseits kann sie ebenso tiefes Leid und Unsicherheit verursachen, wenn sie nicht ganz oder nicht vollständig erwidert wird. Das Gedicht zeigt auf subtile Weise, wie das Streben nach einer idealisierten Liebe gleichzeitig Quelle von Glück und Leid ist, wobei der Sprecher sich zwischen den beiden Polen von Hoffnung und Enttäuschung bewegt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.