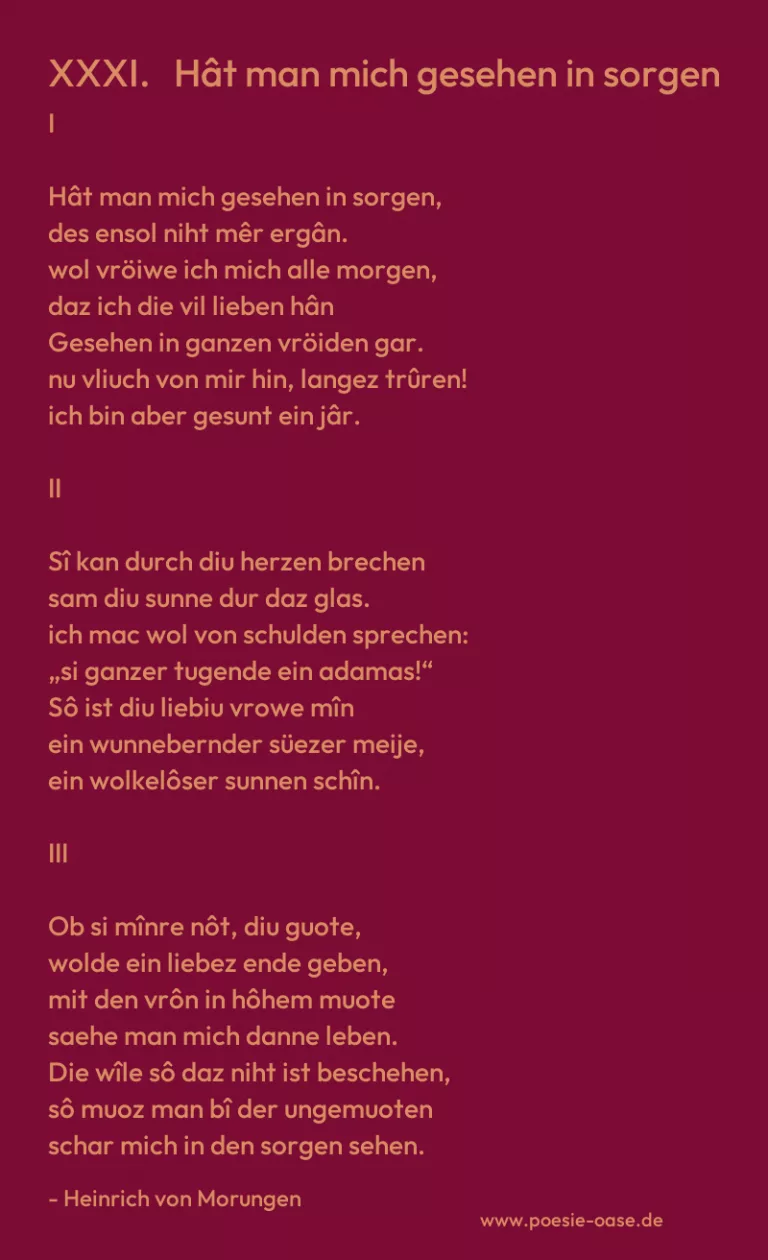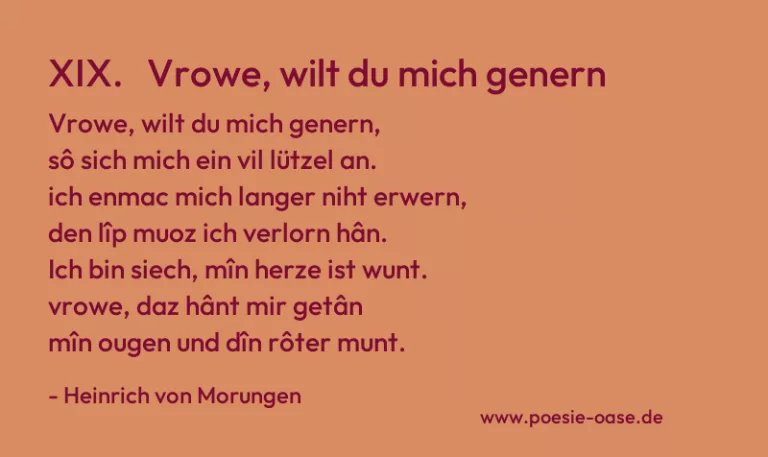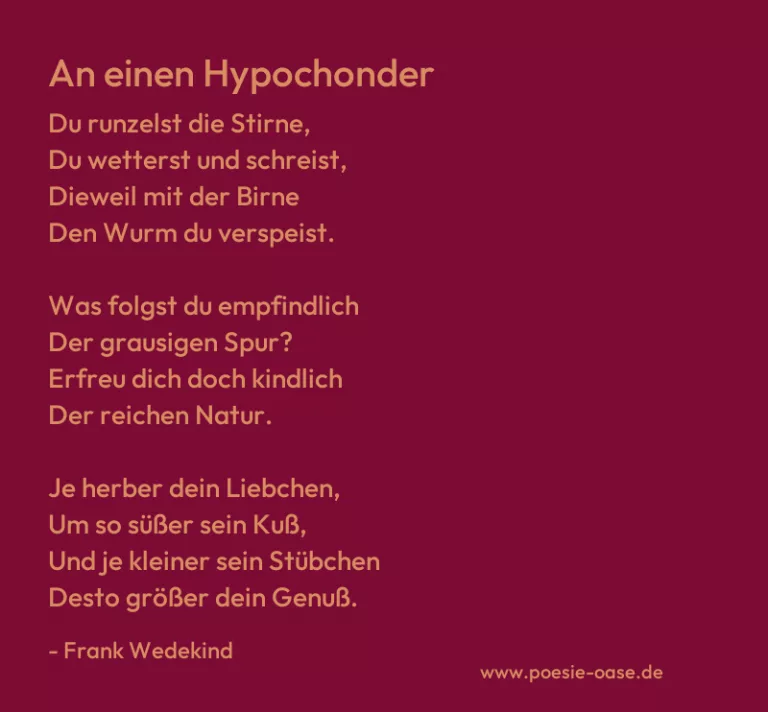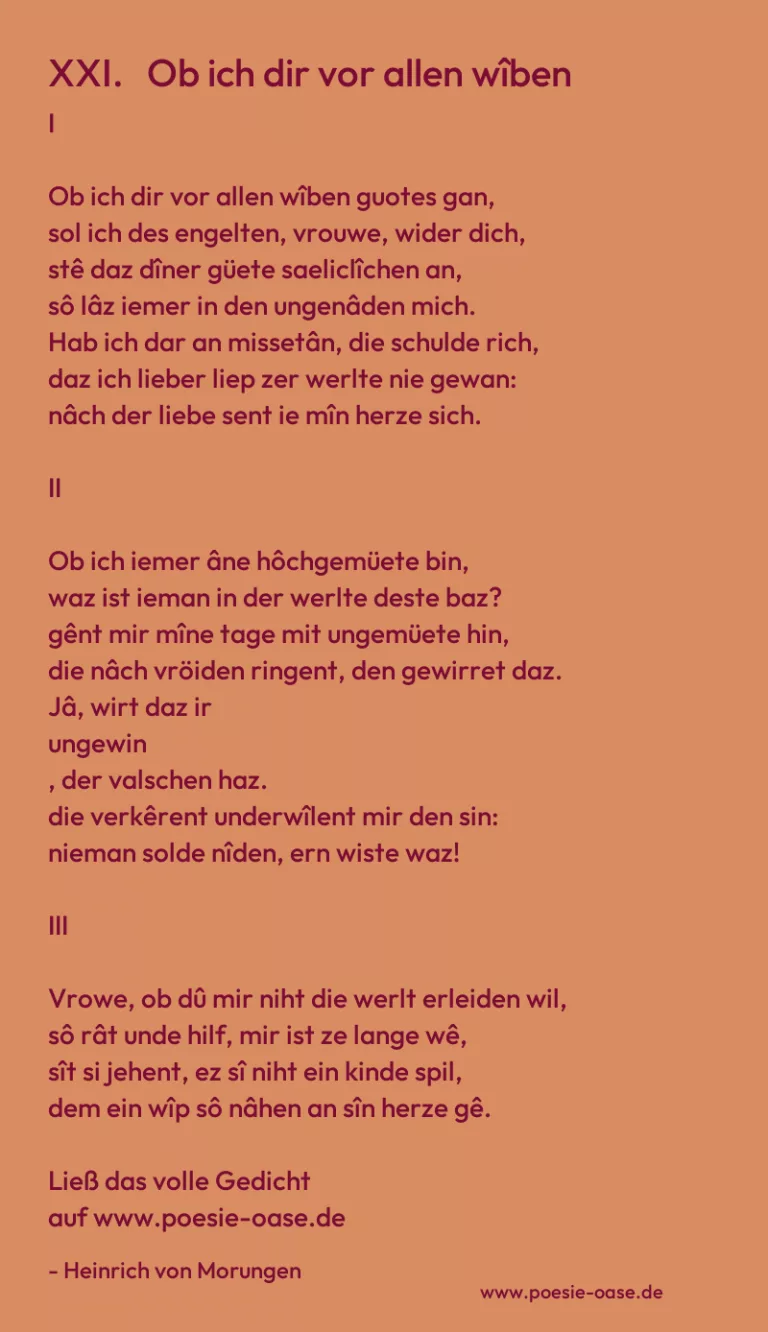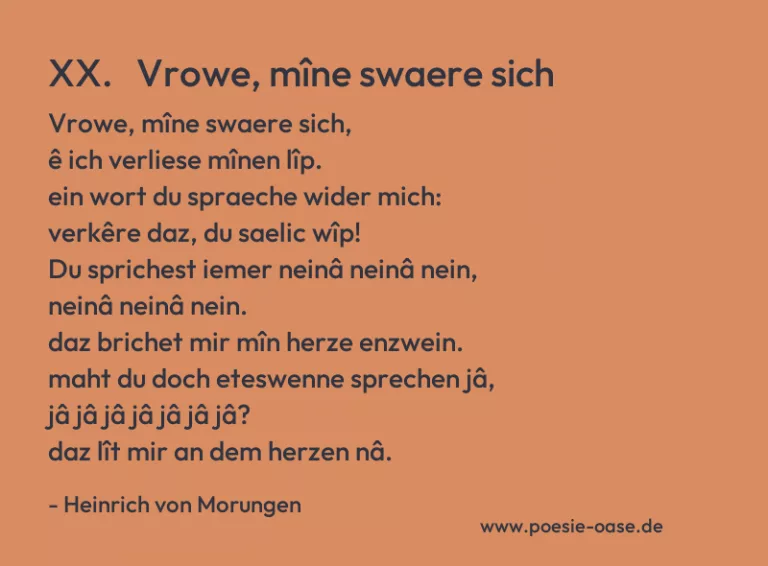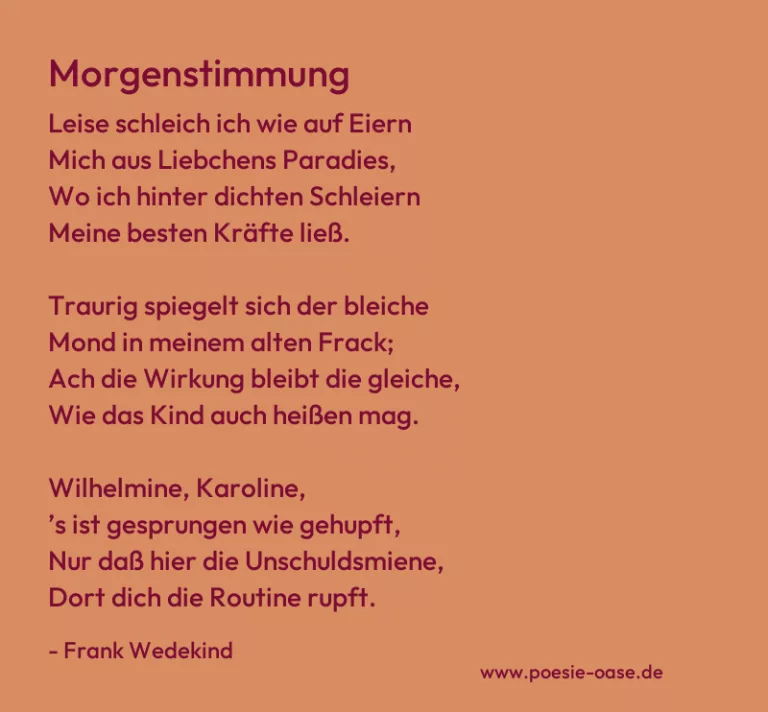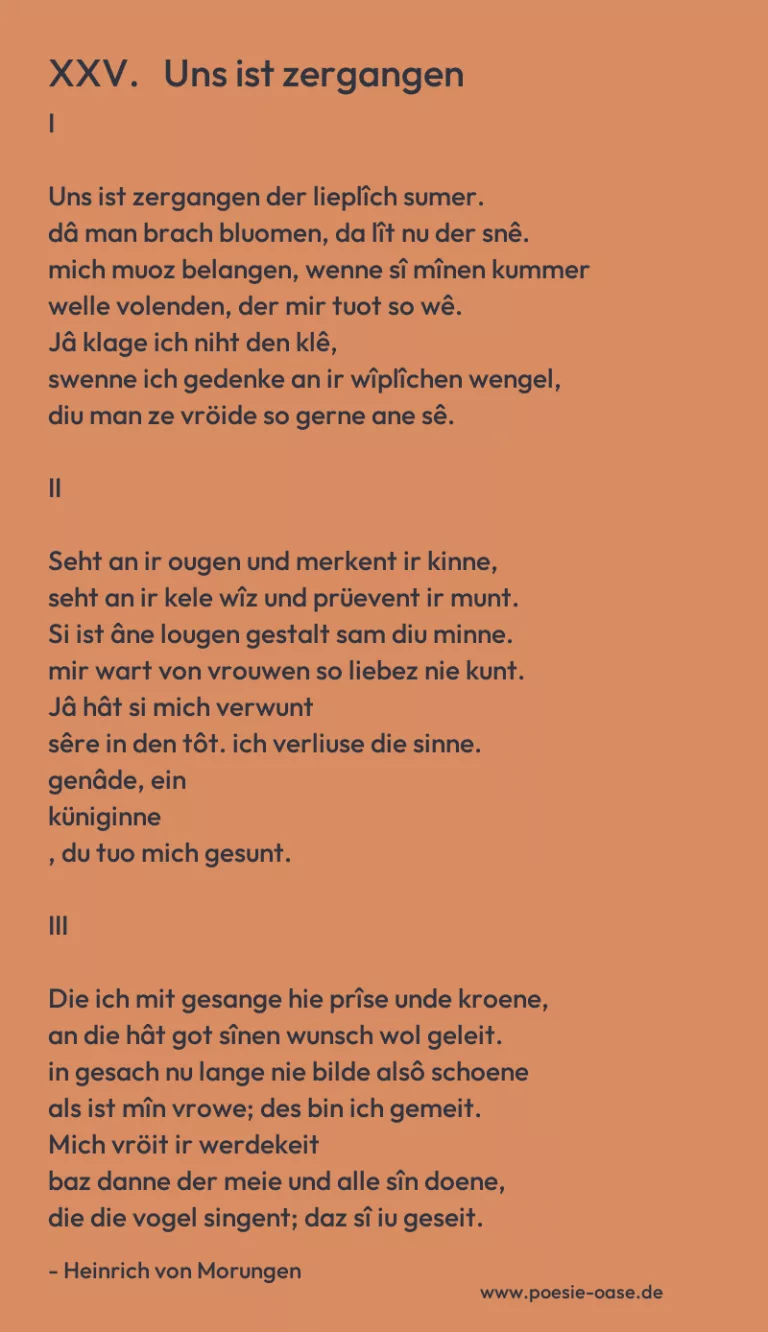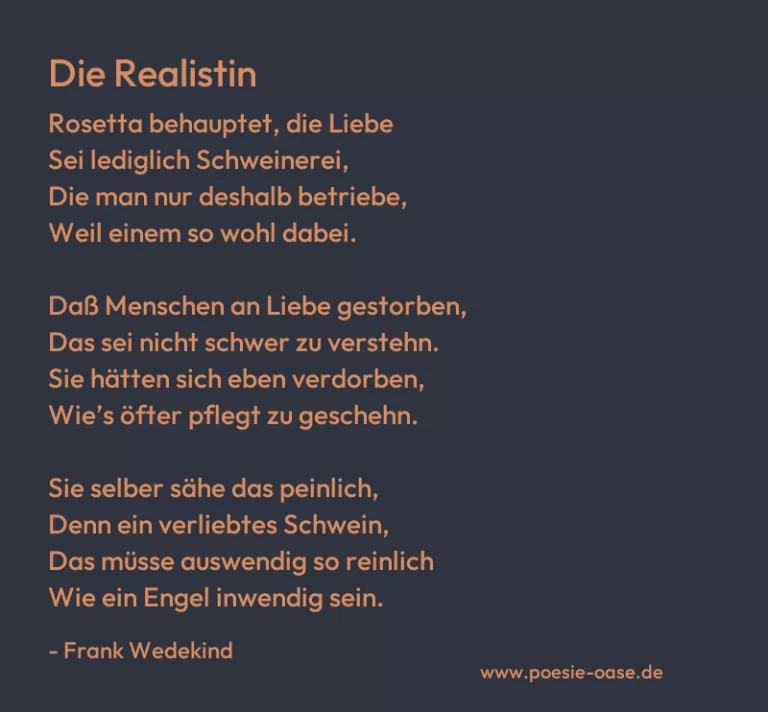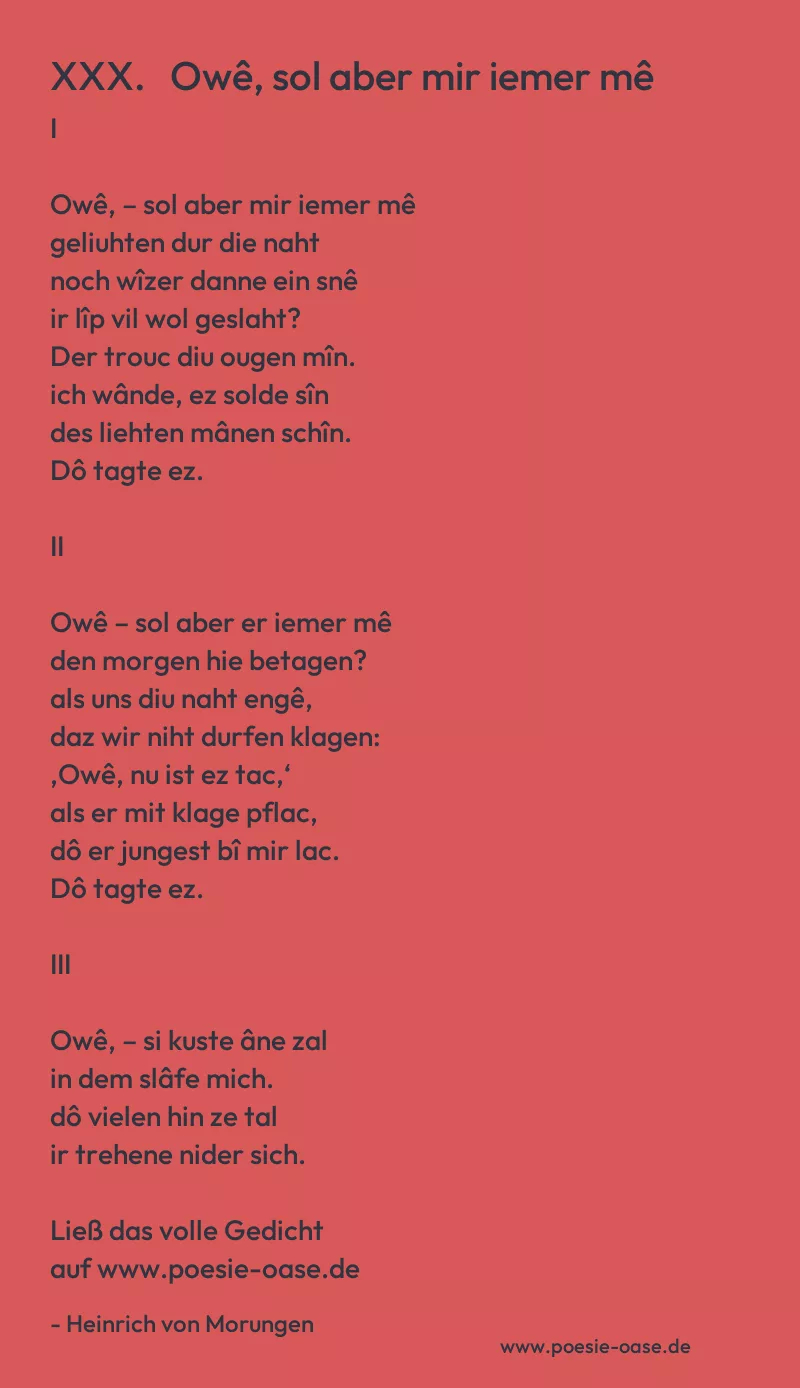XXX. Owê, sol aber mir iemer mê
I
Owê, – sol aber mir iemer mê
geliuhten dur die naht
noch wîzer danne ein snê
ir lîp vil wol geslaht?
Der trouc diu ougen mîn.
ich wânde, ez solde sîn
des liehten mânen schîn.
Dô tagte ez.
II
Owê – sol aber er iemer mê
den morgen hie betagen?
als uns diu naht engê,
daz wir niht durfen klagen:
‚Owê, nu ist ez tac,‘
als er mit klage pflac,
dô er jungest bî mir lac.
Dô tagte ez.
III
Owê, – si kuste âne zal
in dem slâfe mich.
dô vielen hin ze tal
ir trehene nider sich.
Iedoch getrôste ich sie,
daz sî ir weinen lie
und mich al umbevie.
Dô tagte ez.
IV
0wê,- daz er sô dicke sich
bî mir ersehen hât!
als er endahte mich,
sô wolt er sunder wât
Mîn arme schouwen blôz.
ez was ein wunder grôz,
daz in des nie verdrôz.
Dô tagte ez.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
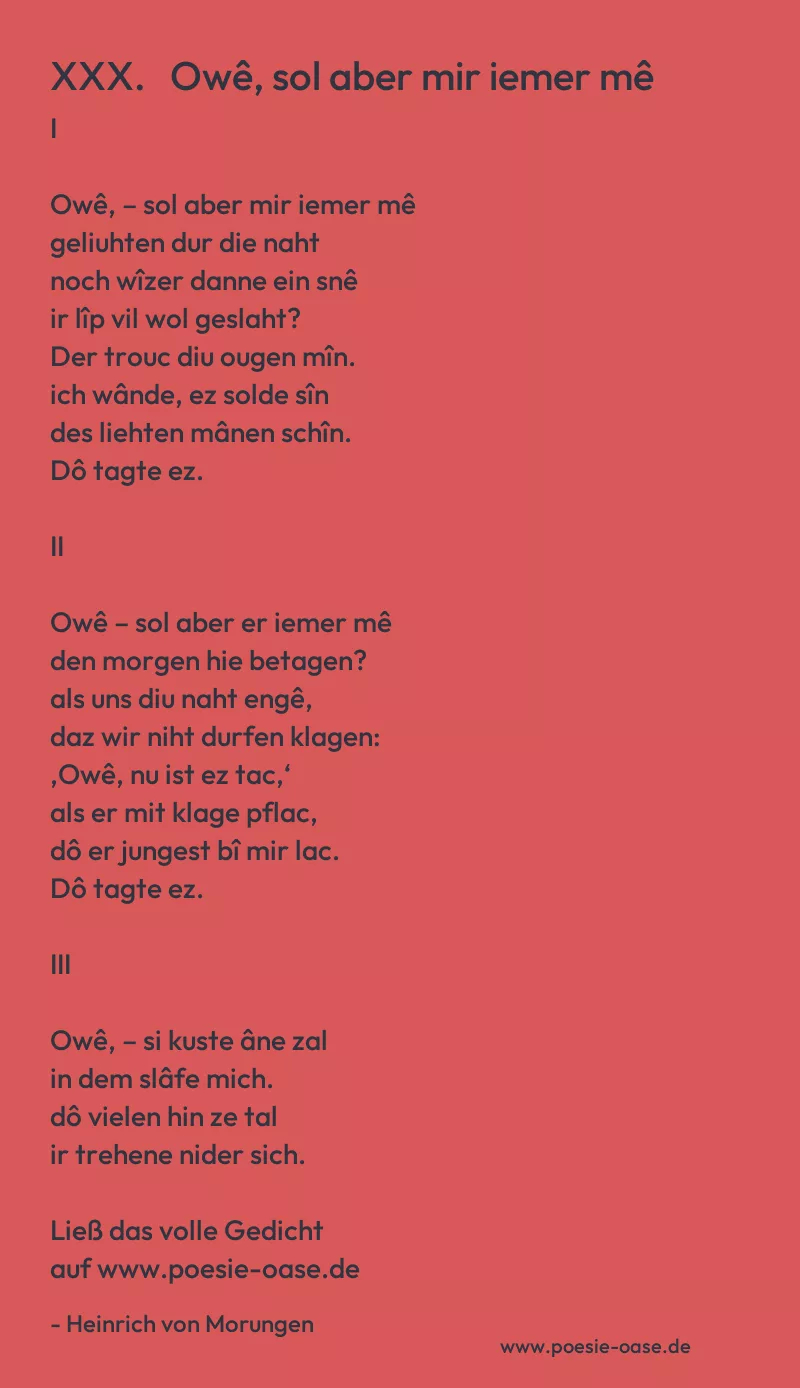
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „XXX. Owê, sol aber mir iemer mê“ von Heinrich von Morungen ist eine eindrucksvolle Klage über die Flüchtigkeit des Liebesglücks und die Vergänglichkeit sinnlicher Nähe. In vier Strophen erinnert sich das lyrische Ich an innige, nächtliche Momente mit der Geliebten – Momente voller Nähe, Küsse und Zärtlichkeit –, die jedoch stets jäh durch das Anbrechen des Tages beendet werden. Der wiederkehrende Schlusssatz „Dô tagte ez“ (Da tagte es) wirkt wie ein Refrain der Enttäuschung und verstärkt das Gefühl des Verlusts.
Die erste Strophe beginnt mit einem Ausdruck tiefen Staunens: Der Körper der Geliebten leuchtet in der Dunkelheit wie der Mond, weißer als Schnee, ein Idealbild körperlicher und sinnlicher Schönheit. Die Augen des Ichs „tragen“ dieses Licht – es wird zum Inbild einer überirdischen Erscheinung. Doch sobald der Tag kommt, endet dieses nächtliche Leuchten; die Realität drängt sich zwischen ihn und seine Liebe.
In der zweiten Strophe wird die Trennung am Morgen stärker betont. Die Nacht, in der Nähe möglich ist, ist zu kurz, und am Morgen bleibt nur das Klagen. Die innige Verbindung zwischen den beiden wird vom Tageslicht zerrissen, was den Schmerz noch vertieft. Die Nacht wird so zur einzigen Zuflucht der Liebenden, der Tag hingegen zum Symbol der Trennung und der gesellschaftlichen Normen, die diese Liebe nicht dulden.
Die dritte Strophe zeigt einen besonders zarten Moment: Die Geliebte küsst das Ich im Schlaf und weint dabei. Ihre Tränen sprechen von der Wehmut und der Ahnung der Trennung. Doch es gibt auch Trost: das Ich beruhigt sie, und sie umarmt ihn. Dieses Bild zeigt die Gegenseitigkeit der Zuneigung – ein Moment reiner, stiller Liebe, den das Tageslicht dennoch unerbittlich beendet.
Die vierte Strophe bringt schließlich ein Element des Staunens und der Bewunderung. Der Geliebte erscheint immer wieder, voller Verlangen, mit dem Wunsch nach körperlicher Nähe – und das Ich wundert sich darüber, dass es ihn „nie verdrôz“. Auch hier wird die Intensität der Leidenschaft betont, doch erneut ist das Glück flüchtig: „Dô tagte ez“ beendet jedes dieser Erinnerungsbilder. So wird das Gedicht zu einer melancholischen Reflexion über das Spannungsverhältnis zwischen nächtlicher Erfüllung und täglicher Entsagung – eine Liebe, die nur im Verborgenen bestehen kann.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.