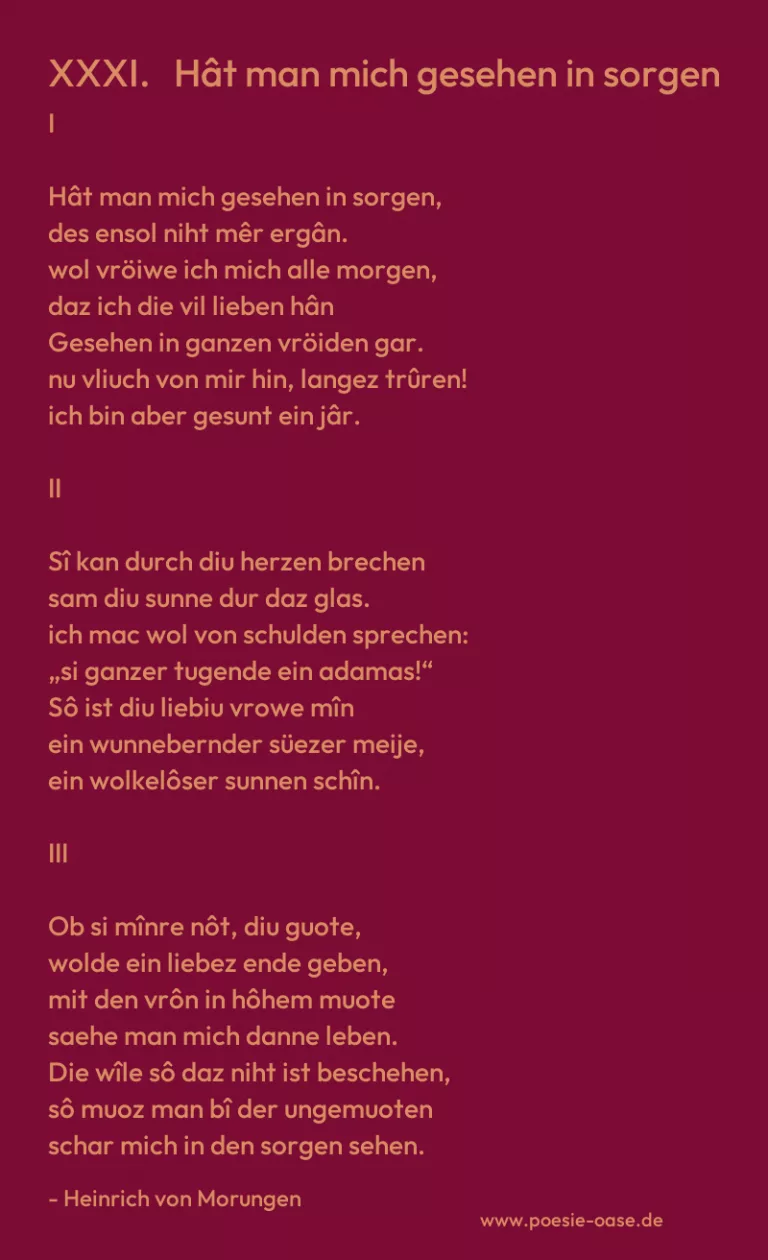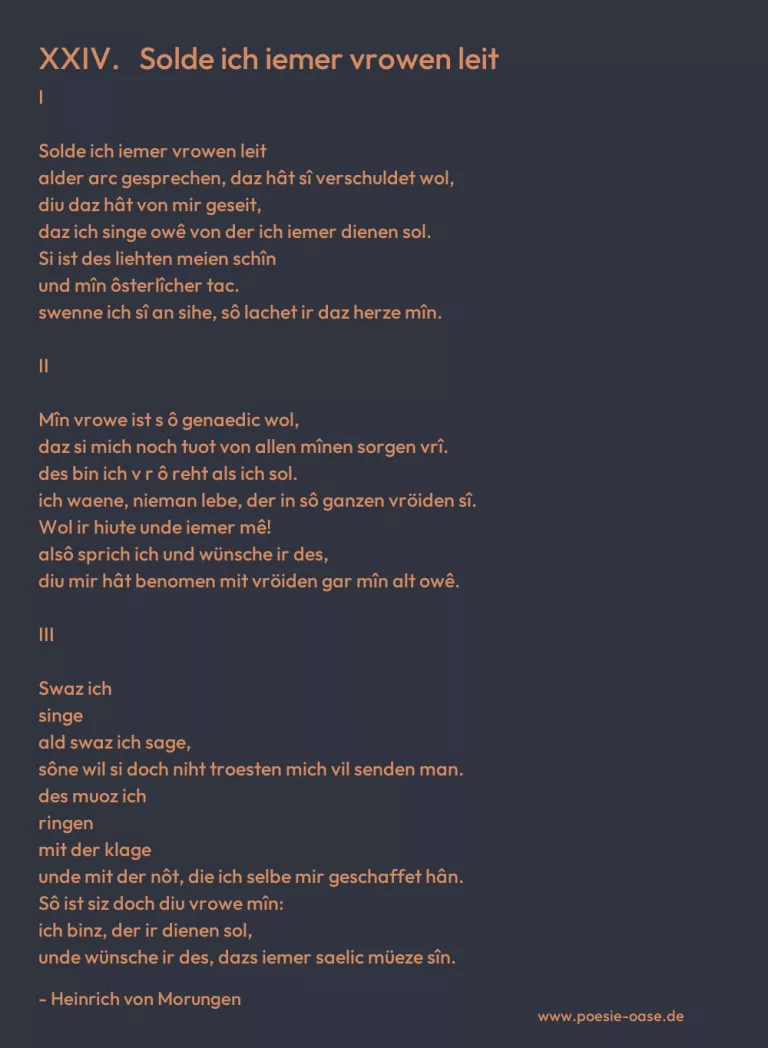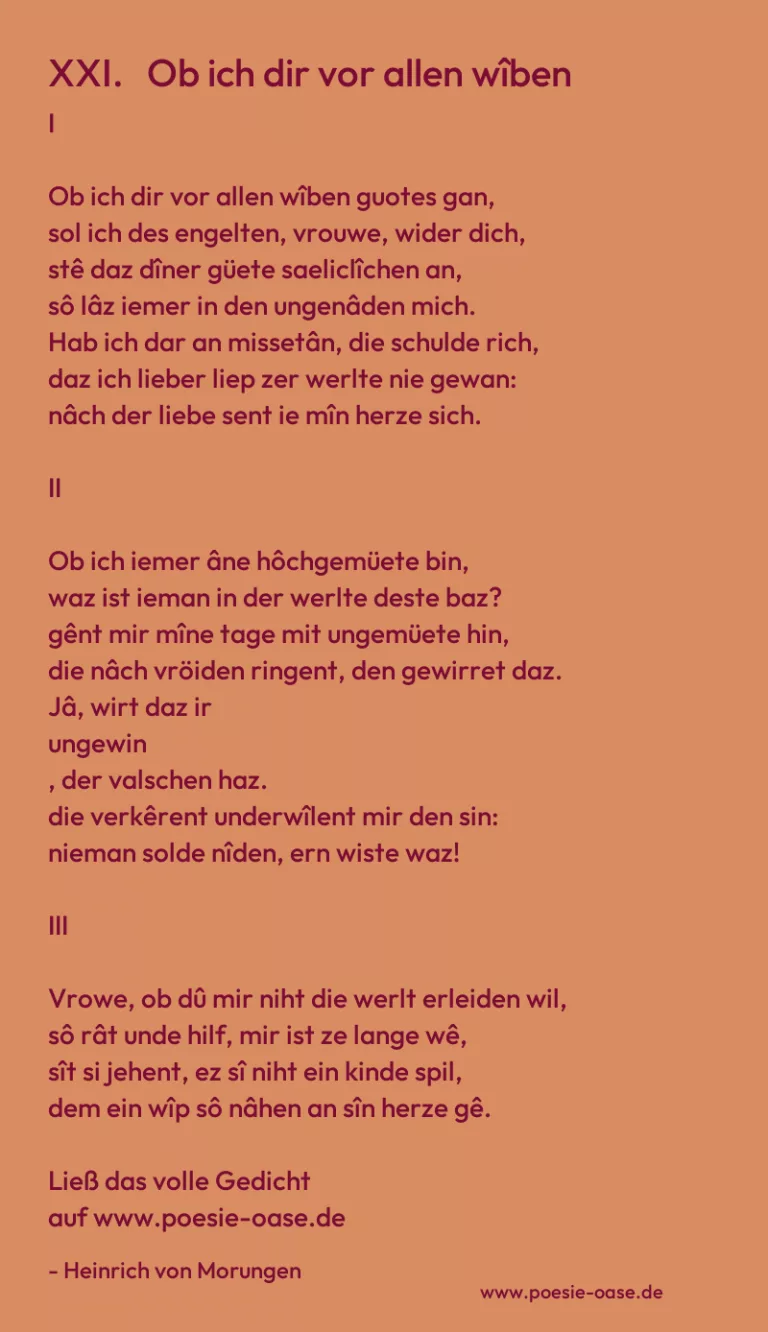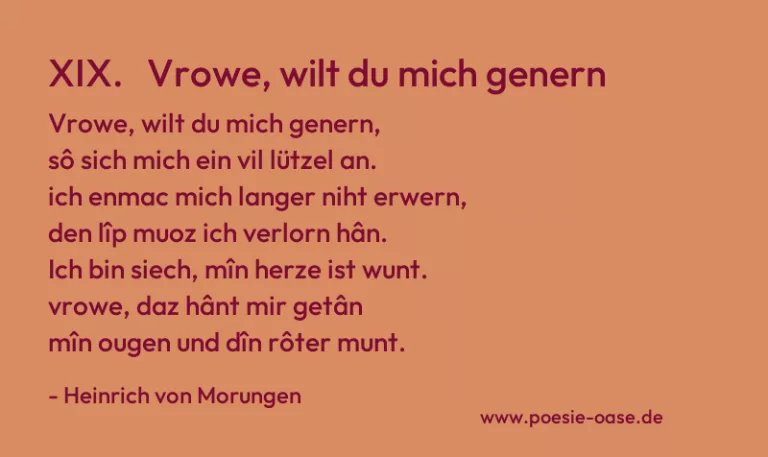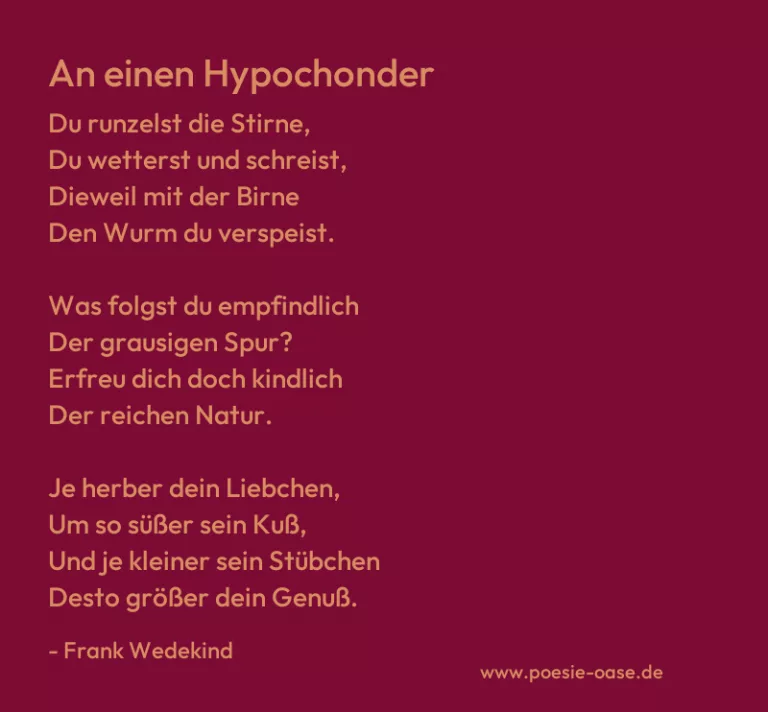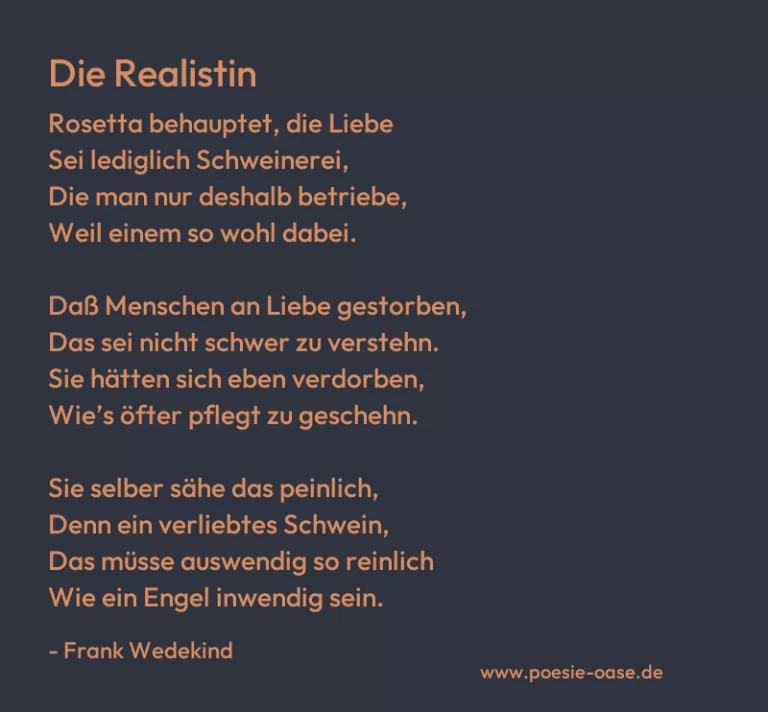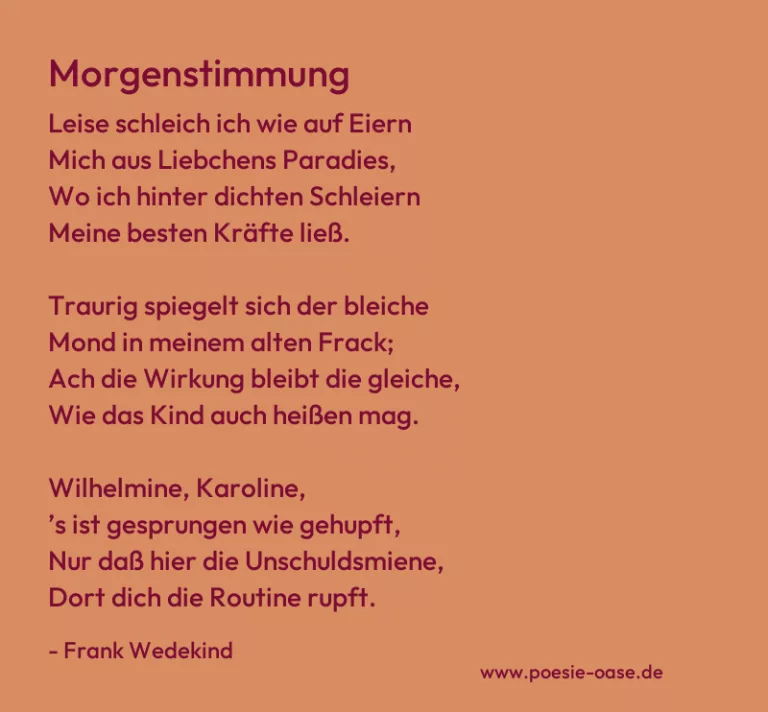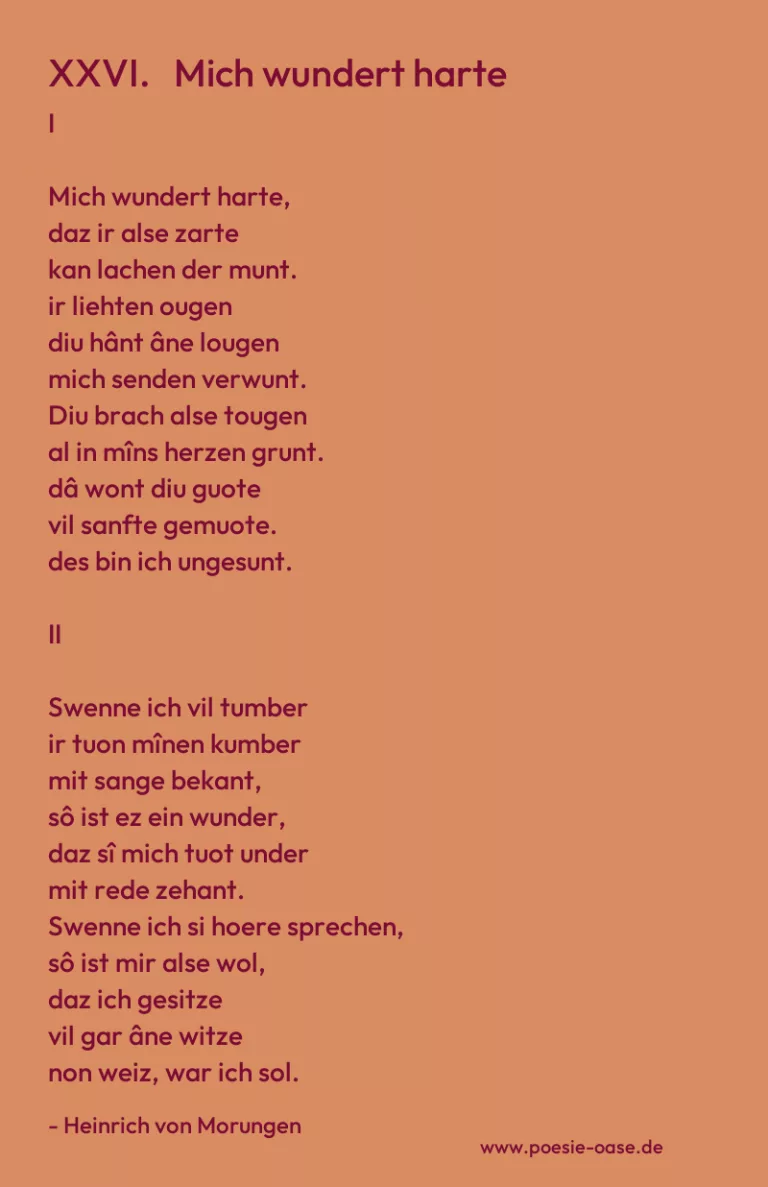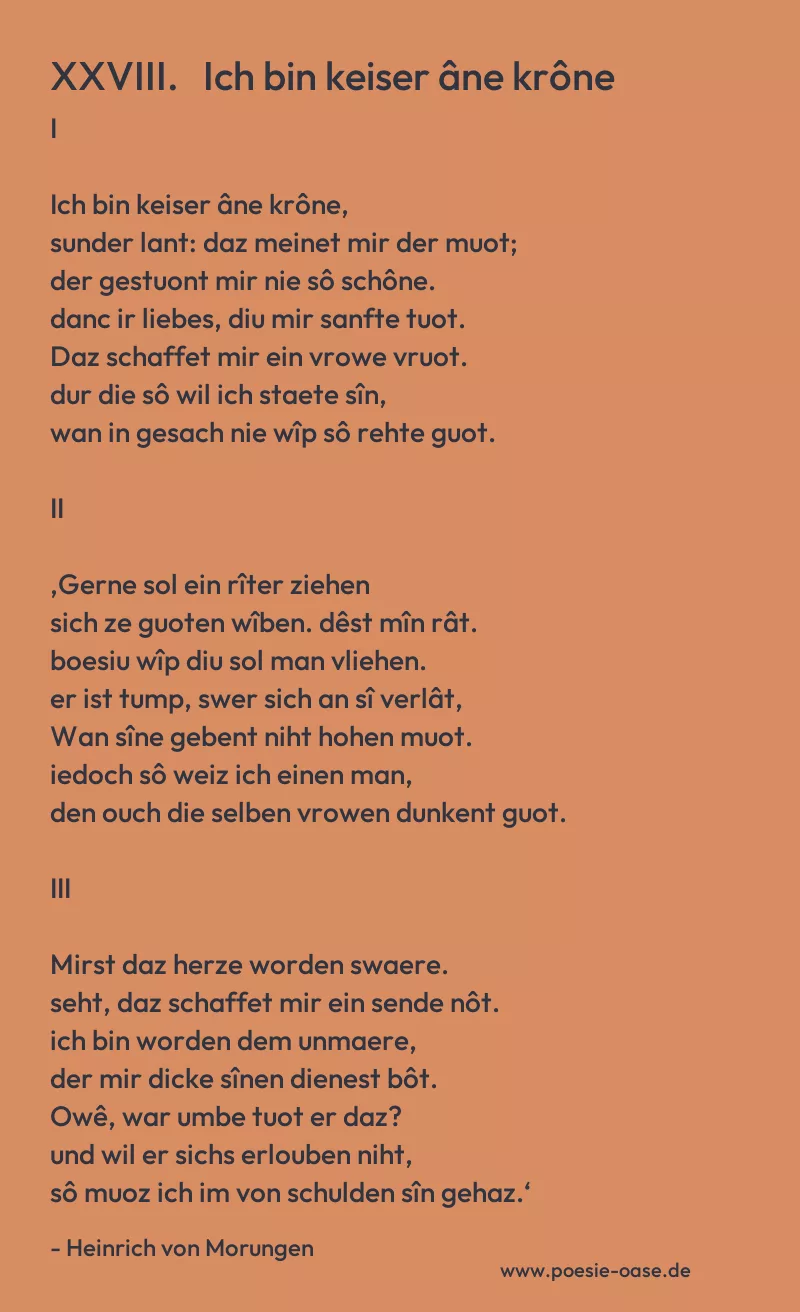XXVIII. Ich bin keiser âne krône
I
Ich bin keiser âne krône,
sunder lant: daz meinet mir der muot;
der gestuont mir nie sô schône.
danc ir liebes, diu mir sanfte tuot.
Daz schaffet mir ein vrowe vruot.
dur die sô wil ich staete sîn,
wan in gesach nie wîp sô rehte guot.
II
‚Gerne sol ein rîter ziehen
sich ze guoten wîben. dêst mîn rât.
boesiu wîp diu sol man vliehen.
er ist tump, swer sich an sî verlât,
Wan sîne gebent niht hohen muot.
iedoch sô weiz ich einen man,
den ouch die selben vrowen dunkent guot.
III
Mirst daz herze worden swaere.
seht, daz schaffet mir ein sende nôt.
ich bin worden dem unmaere,
der mir dicke sînen dienest bôt.
Owê, war umbe tuot er daz?
und wil er sichs erlouben niht,
sô muoz ich im von schulden sîn gehaz.‘
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
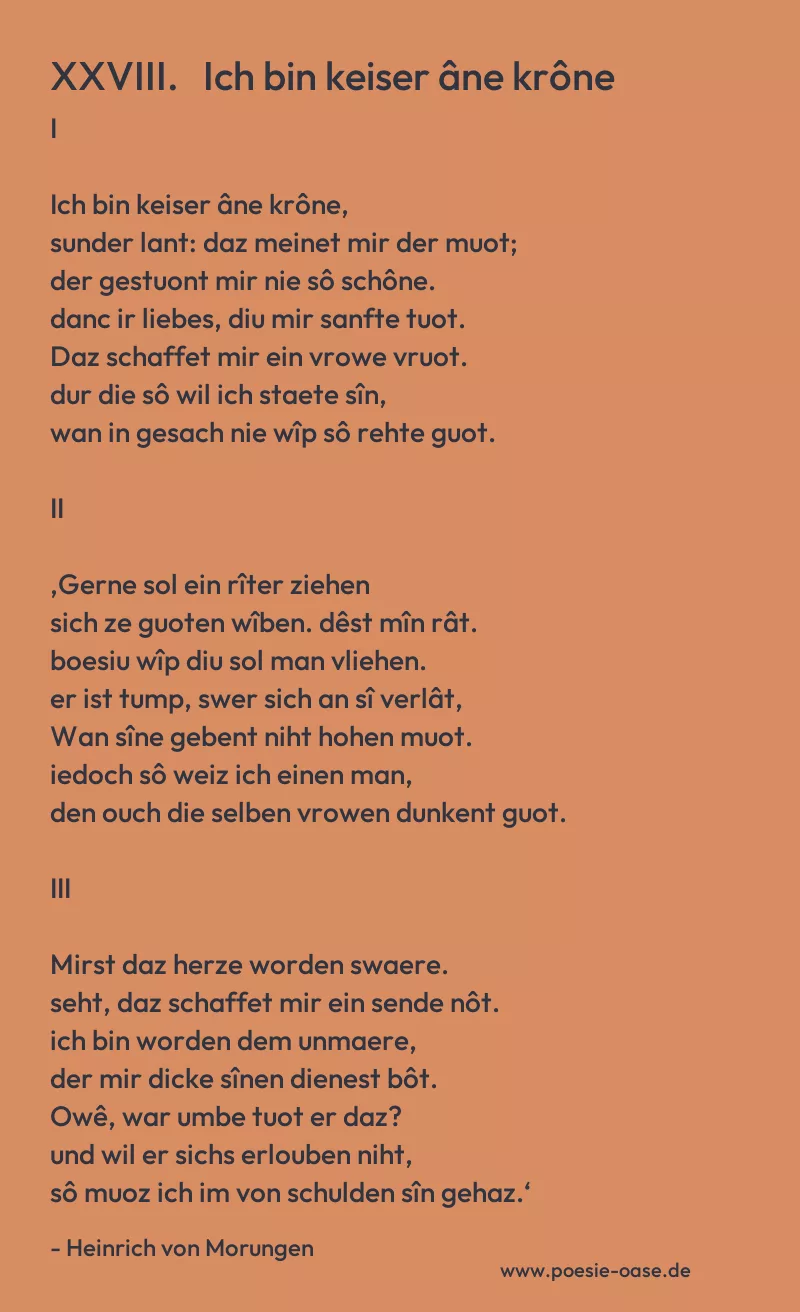
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich bin keiser âne krône“ von Heinrich von Morungen beschreibt die innere Zerrissenheit und das Leid eines Liebenden, der sich trotz seiner Liebe und Hingabe zur Geliebten wie ein „keiser âne krône“ (Kaiser ohne Krone) fühlt – eine Figur der Macht und Bedeutung, die jedoch leer und ohne wirkliche Anerkennung ist. In der ersten Strophe reflektiert der Sprecher seine Position als „keiser âne krône“ und beschreibt, wie die Geliebte ihm mit ihrer sanften Liebe ein Gefühl von Herrschaft und Bedeutung verleiht, obwohl er in der Gesellschaft keine tatsächliche Macht oder Anerkennung besitzt. Die Liebe der Geliebten ist für ihn die „krône“ (Krone), die ihm die höchste Form der Erfüllung und Freude schenkt. Der Vergleich zwischen dem „keiser“ und der „vrowe vruot“ (fröhlichen Frau) zeigt, dass wahre Macht für ihn nicht in weltlicher Autorität, sondern in der Liebe einer Frau liegt.
In der zweiten Strophe spricht der Sprecher über die Bedeutung von „guten wîben“ (guten Frauen) und stellt fest, dass ein „rîter“ (Ritter) sich zu einer solchen Frau bekennen sollte. Das „boesiu wîp“ (böses Weib) hingegen solle man meiden, da es den Ritter in seiner Ehre und seinem Mut schwächt. Hier wird eine moralische und ethische Bewertung von Frauen vorgenommen: Die Frau, die er liebt, repräsentiert für ihn das Gute, während die „bösen Frauen“ diejenigen sind, die nur zu Unheil und Kummer führen. Die Vorstellung, dass sich ein Mann auf eine Frau verlassen sollte, die ihn in seiner Würde und seinem „hohen muot“ (hohem Mut) bestärkt, zeigt eine idealisierte Vorstellung von Liebe als einer Quelle der Erhebung und des Stolzes. Doch der Sprecher erkennt, dass nicht alle Frauen dies bieten können, und dass selbst eine Frau, die er als gut empfindet, ihn auch in die Irre führen könnte.
In der dritten Strophe wendet sich das Gedicht der tragischen Wendung zu. Der Sprecher beschreibt, wie sein Herz schwer geworden ist („mirst daz herze worden swaere“), was auf die Last der unerfüllten oder enttäuschten Liebe hinweist. Er fühlt sich von einer „unmaere“ (Ungeheuer) verfolgt, die ihm seine Dienste anbietet, aber ihm letztlich keinen Frieden bringt. Diese „Ungeheuer“ könnte als Metapher für die inneren Dämonen des Sprechers oder die zerstörerischen Auswirkungen der Liebe verstanden werden. Der Sprecher fühlt sich von dieser unerwiderten Liebe in eine „nôt“ (Not) gestürzt und ist von der Ablehnung des Angebots der Geliebten tief enttäuscht. Die Frage „war umbe tuot er daz?“ (Warum tut er das?) verdeutlicht seine Verwirrung und seinen Schmerz über die Ablehnung, und er erkennt, dass er sich in einem Zustand der Schuld und des Hasses befindet, obwohl er sich nichts anderes wünscht, als ihre Zuneigung.
Insgesamt zeigt das Gedicht die komplexe und widersprüchliche Natur der Liebe: Sie kann sowohl erheben als auch zerstören. Der Sprecher fühlt sich als „keiser“ ohne Krone – er hat das Gefühl, dass er in seiner Liebe die größte Bedeutung findet, aber gleichzeitig von der Geliebten nicht die Anerkennung erhält, die er sich wünscht. Morungen stellt die tiefen emotionalen Konflikte und die Ambivalenz der Liebe dar, die sowohl eine Quelle der Freude als auch der Qual ist. Das Gedicht spiegelt eine typische Haltung der mittelalterlichen Liebesdichtung wider, in der die Liebe idealisiert, aber auch als eine schmerzhafte und konfliktreiche Erfahrung dargestellt wird.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.