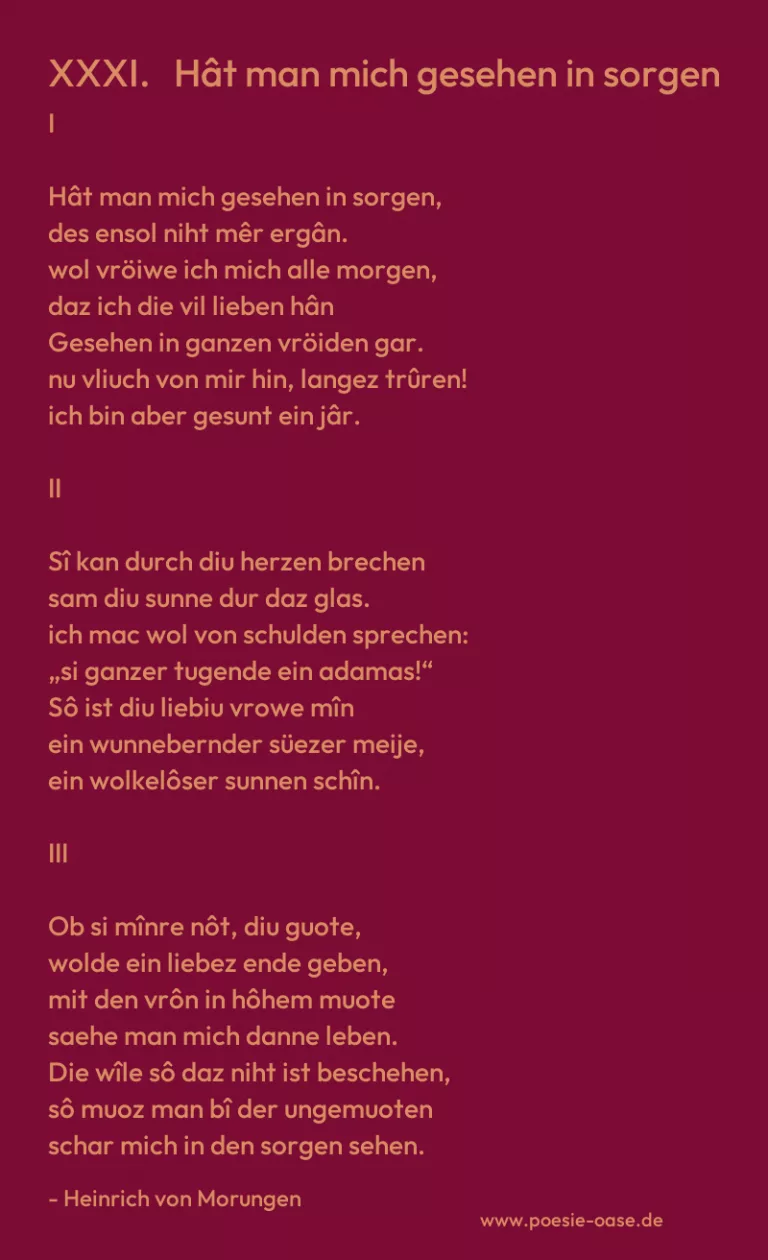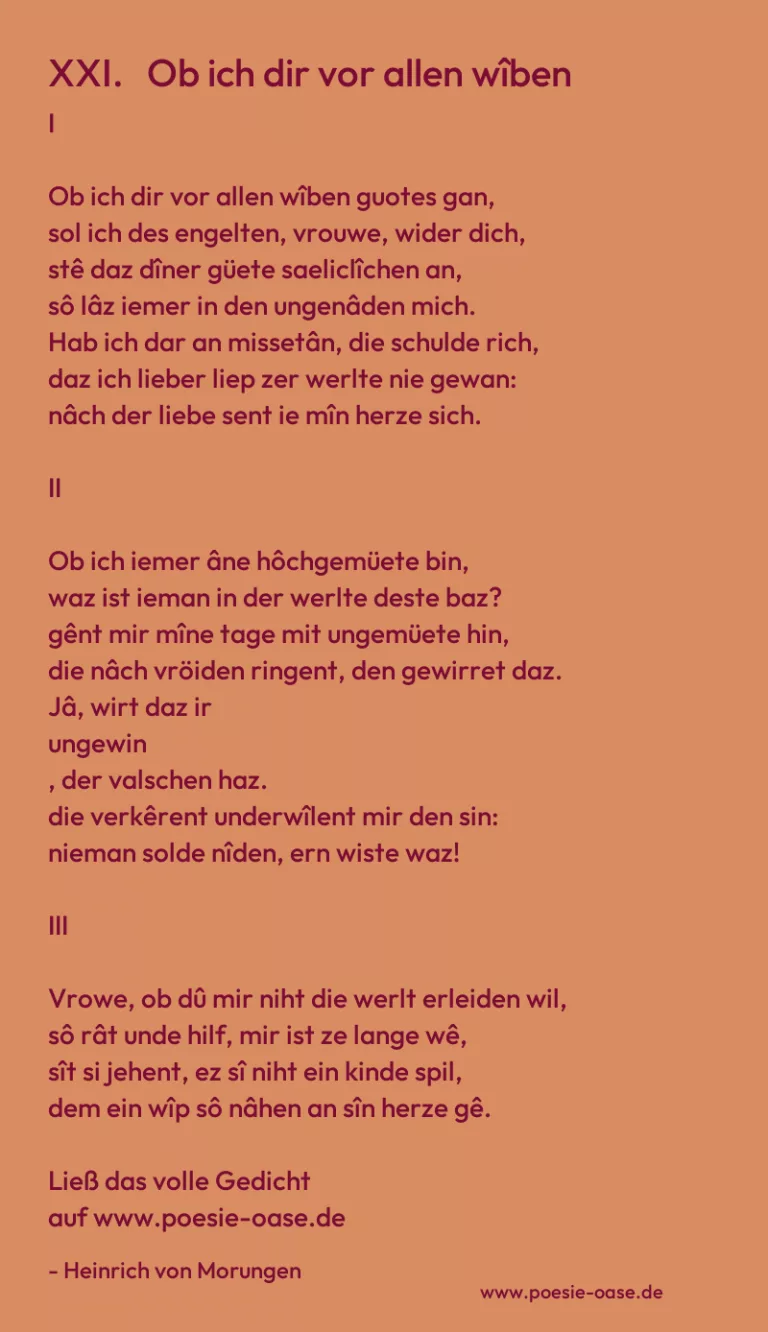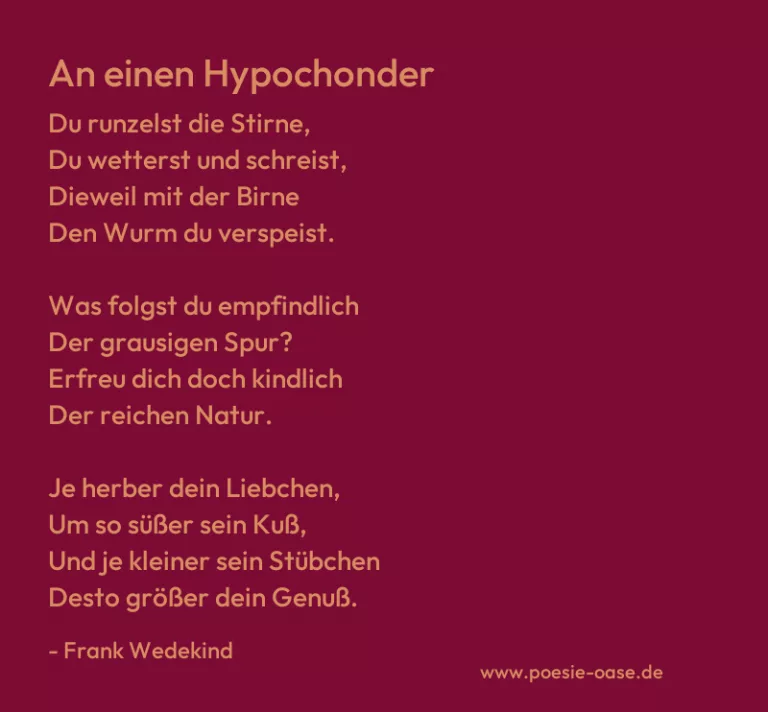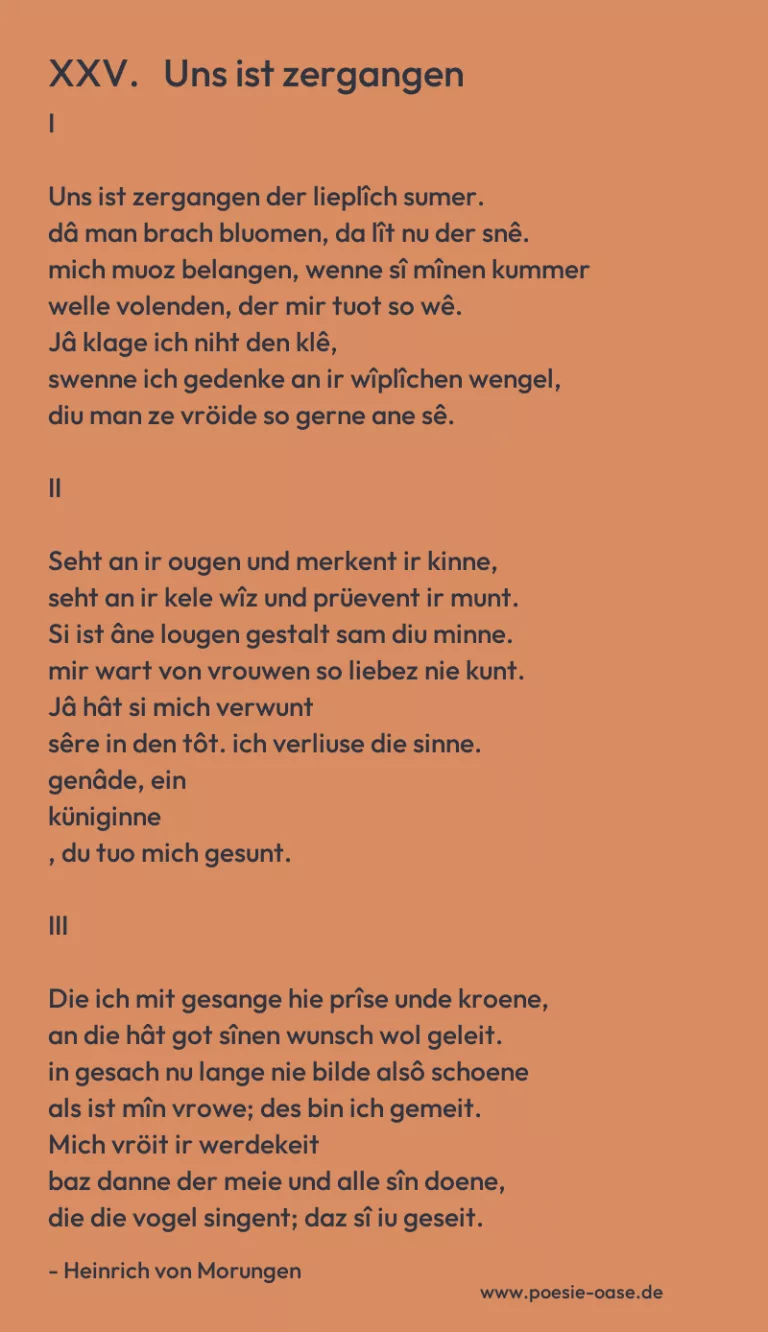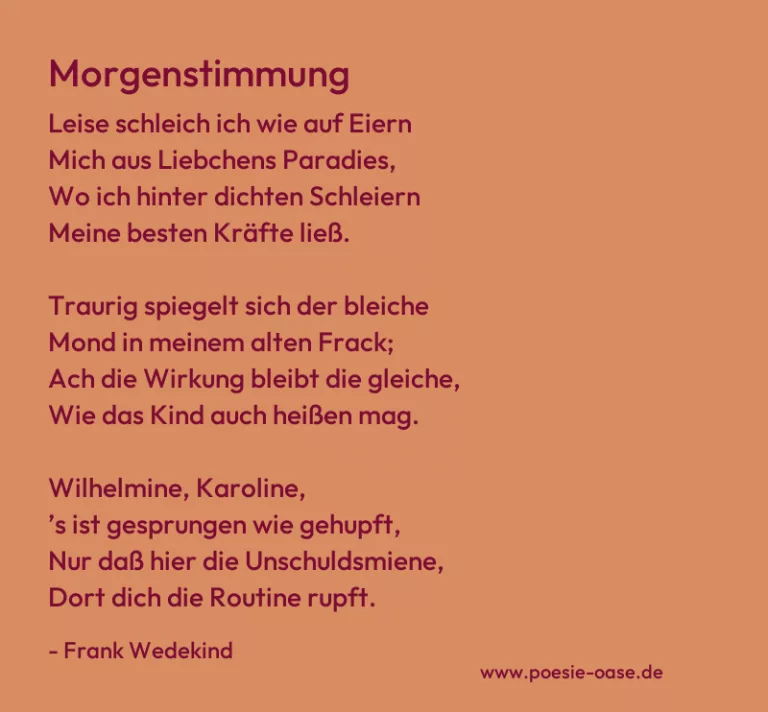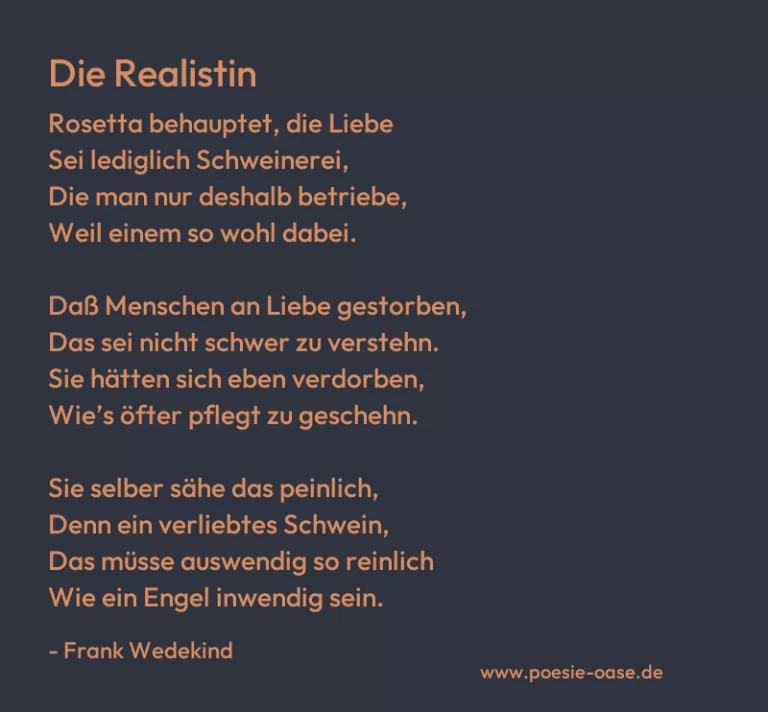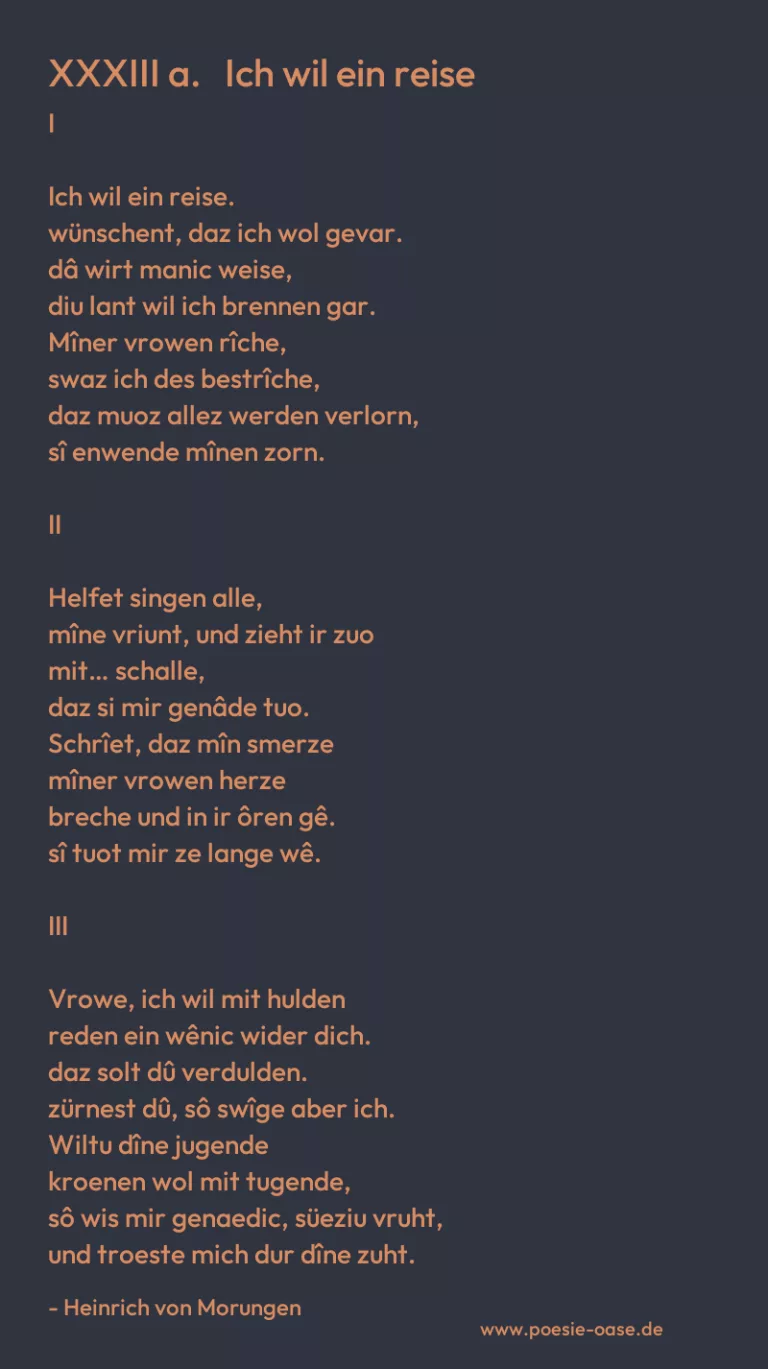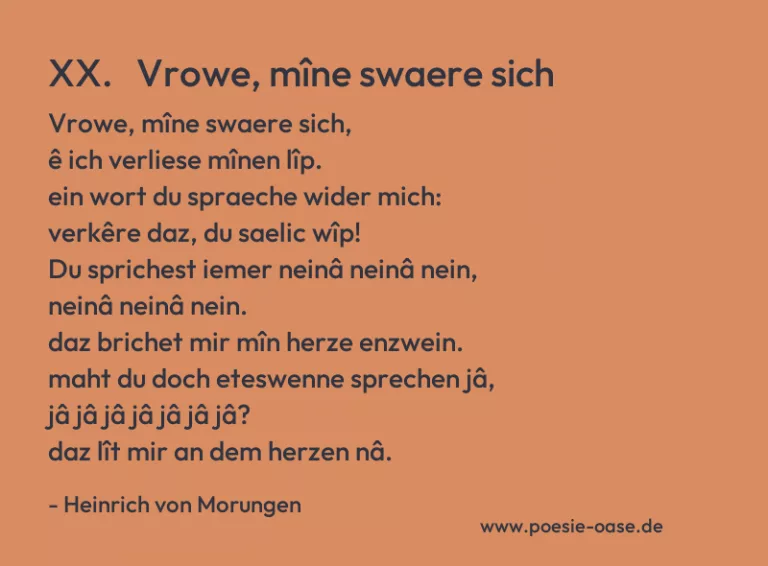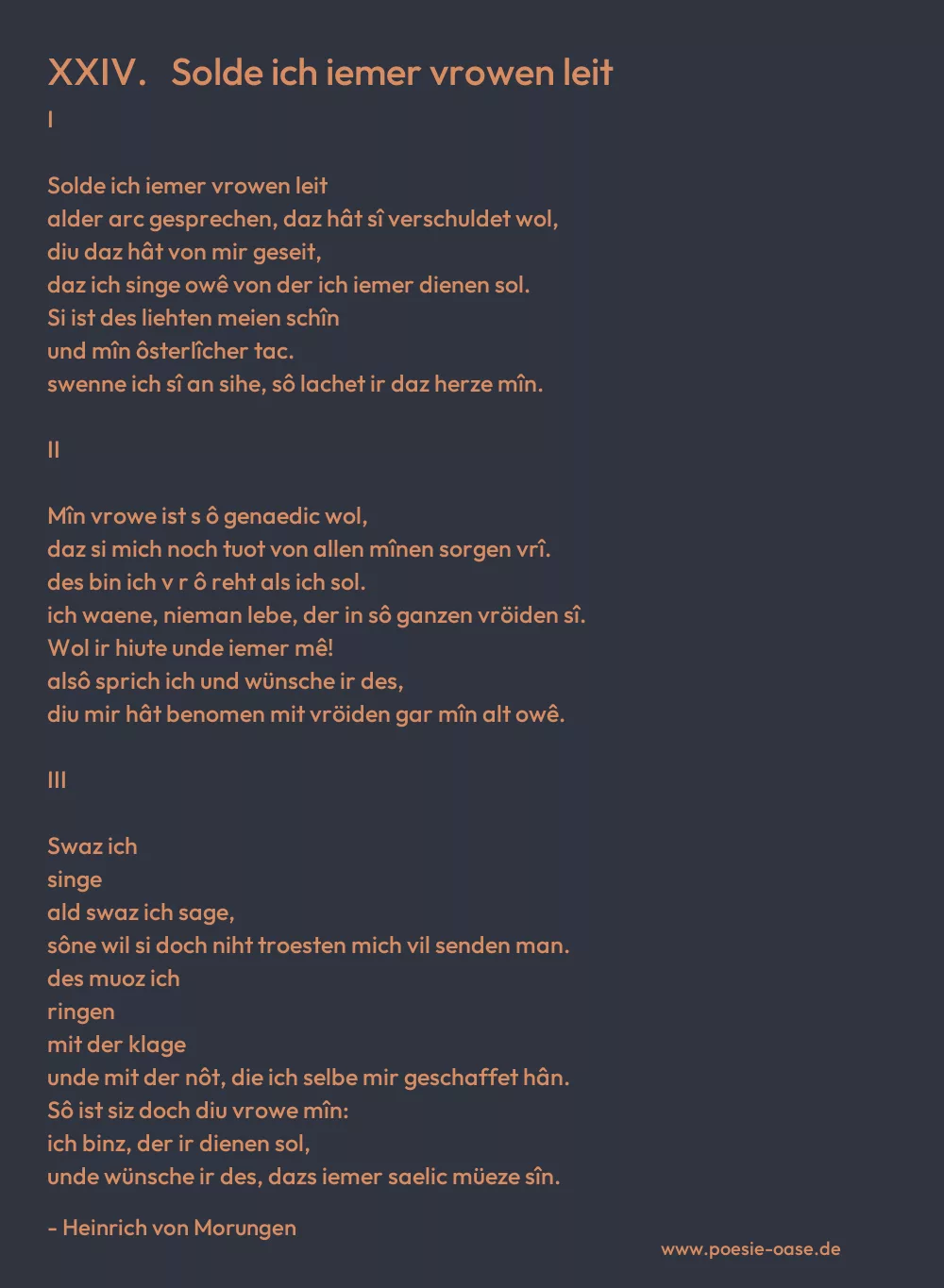XXIV. Solde ich iemer vrowen leit
I
Solde ich iemer vrowen leit
alder arc gesprechen, daz hât sî verschuldet wol,
diu daz hât von mir geseit,
daz ich singe owê von der ich iemer dienen sol.
Si ist des liehten meien schîn
und mîn ôsterlîcher tac.
swenne ich sî an sihe, sô lachet ir daz herze mîn.
II
Mîn vrowe ist s ô genaedic wol,
daz si mich noch tuot von allen mînen sorgen vrî.
des bin ich v r ô reht als ich sol.
ich waene, nieman lebe, der in sô ganzen vröiden sî.
Wol ir hiute unde iemer mê!
alsô sprich ich und wünsche ir des,
diu mir hât benomen mit vröiden gar mîn alt owê.
III
Swaz ich
singe
ald swaz ich sage,
sône wil si doch niht troesten mich vil senden man.
des muoz ich
ringen
mit der klage
unde mit der nôt, die ich selbe mir geschaffet hân.
Sô ist siz doch diu vrowe mîn:
ich binz, der ir dienen sol,
unde wünsche ir des, dazs iemer saelic müeze sîn.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
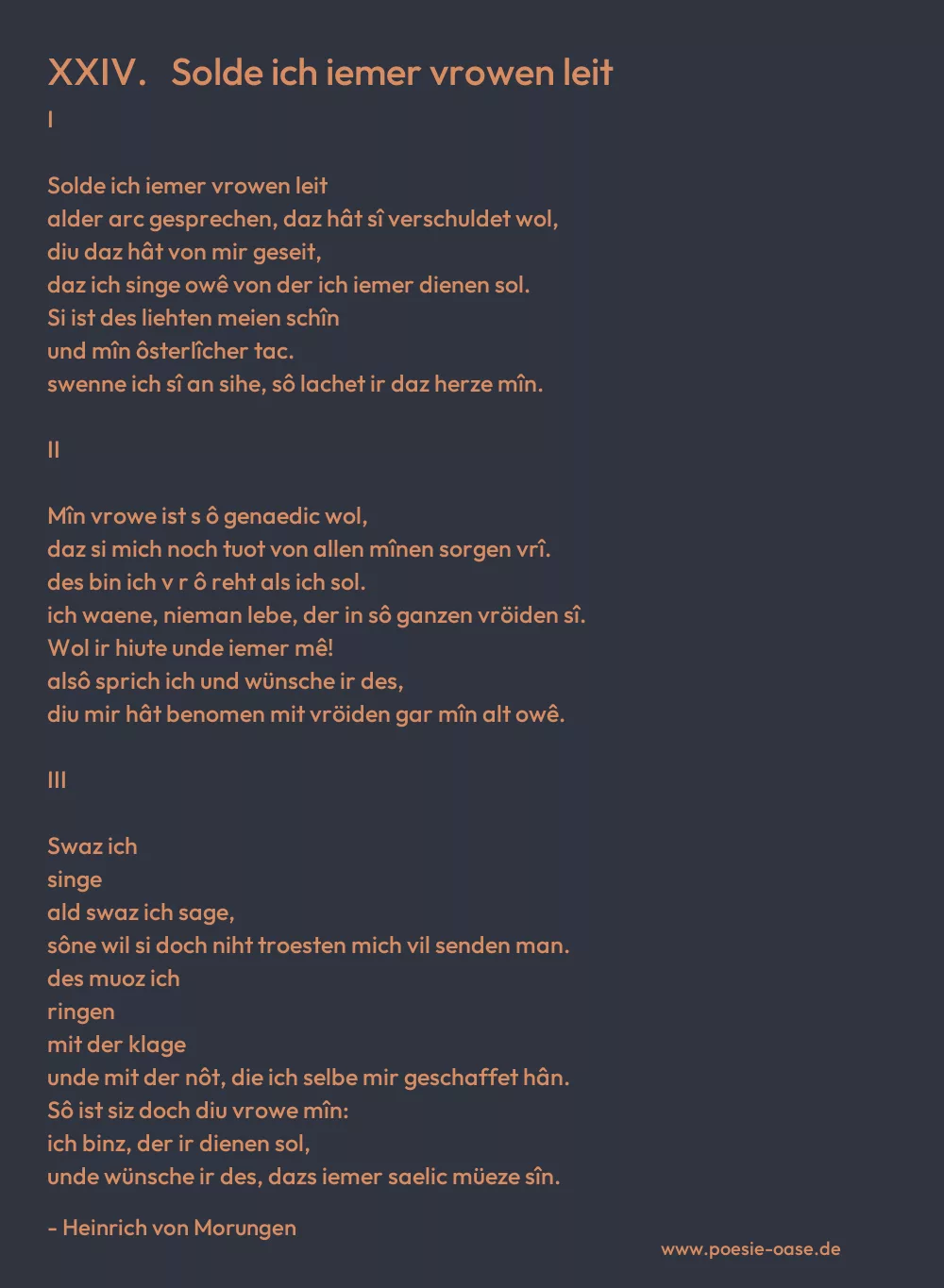
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Solde ich iemer vrowen leit“ von Heinrich von Morungen beschreibt das Ringen des lyrischen Ichs mit den Widersprüchen und Herausforderungen der Liebe. In der ersten Strophe äußert der Sprecher eine Klage über die Verantwortung und die Last, die ihm von seiner Liebe auferlegt wurde. Die „vrowe“ (Frau), die seine Herzenserfüllung und Freude ist, wird auch als eine Quelle von Leid und Kummer dargestellt, wenn er von ihr entfernt ist. Ihre Anwesenheit ist für ihn wie der Sonnenaufgang, der sein Leben erleuchtet, und gleichzeitig ist sie der Ursprung seines Schmerzes. Es scheint, als ob der Sprecher in seiner Liebe gefangen ist – er fühlt sich durch die Anziehungskraft der Geliebten sowohl beglückt als auch von der Sorge um sie überwältigt.
In der zweiten Strophe beschreibt der Sprecher die Geliebte als eine Quelle des Trostes und des Friedens, die ihm von seinen Sorgen befreit. Ihre Liebe gibt ihm das Gefühl, als wäre er in einem Zustand völliger Freude und Glückseligkeit. Der Sprecher empfindet sich als „vrowe“ (Frau) der Frau, was auf eine starke emotionale und psychologische Bindung hinweist. Die Vorstellung, dass er durch ihre Liebe von allen äußeren Sorgen befreit wird, zeigt, wie tief seine Hingabe an sie geht. Dennoch bleibt ein gewisser Zweifel an der Dauer dieses Zustands, da die Vorstellung von „niemandem, der in solch vollständiger Freude lebt“ auch eine implizite Warnung vor der Zerbrechlichkeit von Glück und Liebe sein könnte.
In der dritten Strophe wird das Ringen des Sprechers weiter entfaltet, als er schildert, dass seine Bemühungen, der Geliebten durch Gesang oder Worte Trost zu spenden, nicht immer von Erfolg gekrönt sind. Obwohl er sich in seine Gefühle und Wünsche für sie vertieft, bleibt die Sehnsucht nach einer Antwort auf sein Leiden und seine Hingabe unbefriedigt. Es wird deutlich, dass er sich in einem Zustand der inneren Zerrissenheit befindet: Einerseits fühlt er sich in der Rolle des treuen Dieners, andererseits leidet er unter der unerwiderten oder unerfüllten Liebe. Die Wiederholung des Wunsches, dass sie ihm in seinem Leid beistehe, deutet auf eine gewisse Resignation hin, die jedoch nicht mit einer endgültigen Aufgabe der Liebe einhergeht.
Insgesamt thematisiert das Gedicht die komplexe Dynamik der Liebe und des Dienstes. Heinrich von Morungen zeigt die schwierige Balance zwischen der Hingabe an eine Geliebte und dem Schmerz, den diese Hingabe mit sich bringt. Der Sprecher befindet sich in einem emotionalen Dilemma – er fühlt sich durch seine Liebe beglückt, aber auch gefangen von den unerfüllten Erwartungen und den inneren Konflikten, die die Liebe mit sich bringt. Die Geliebte wird sowohl als Quelle des Glücks als auch des Schmerzes dargestellt, und das Gedicht reflektiert die paradoxe Natur der Liebe, die sowohl befreiend als auch belastend sein kann.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.