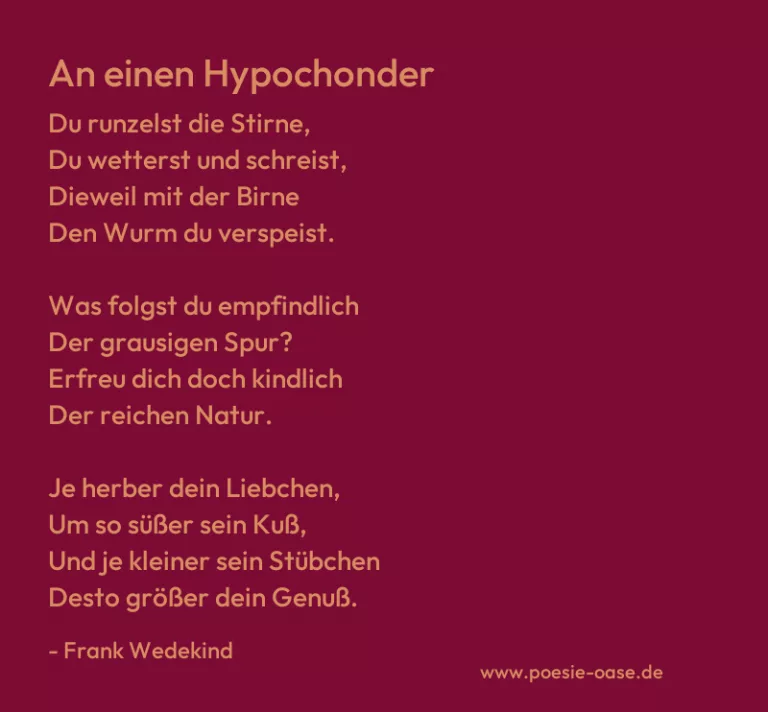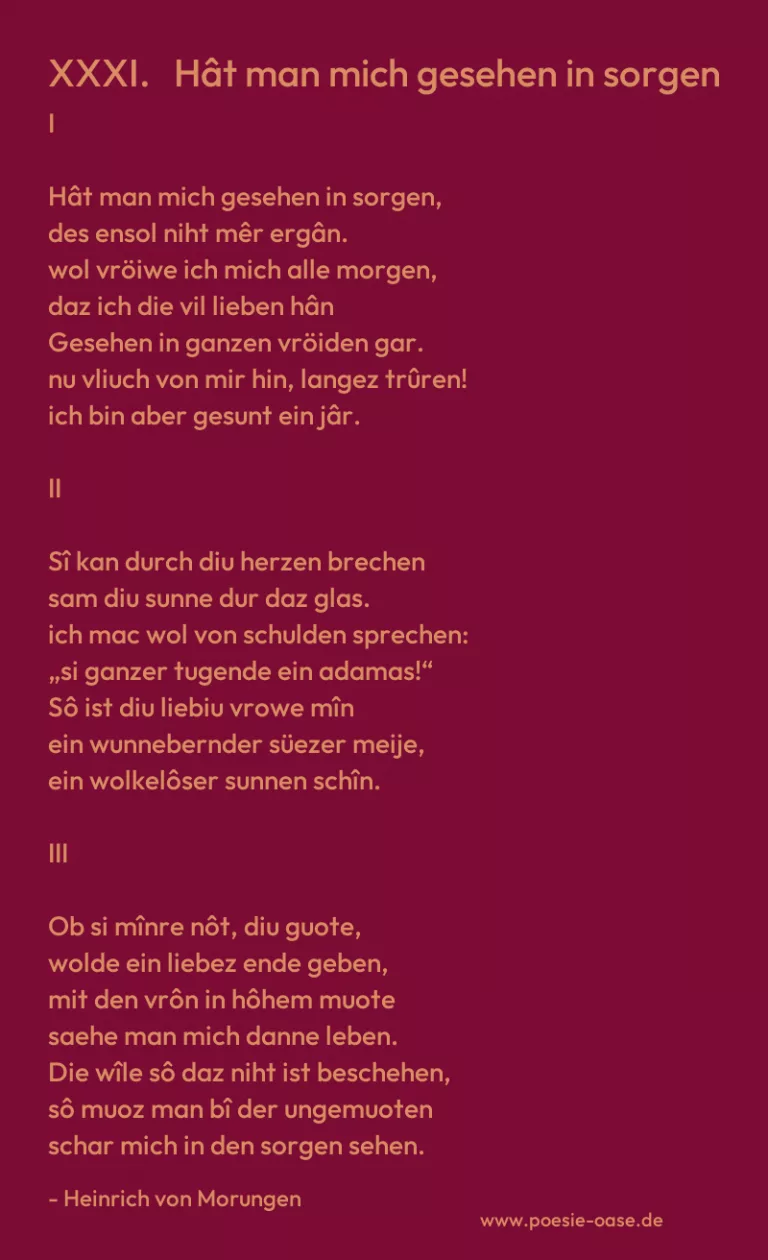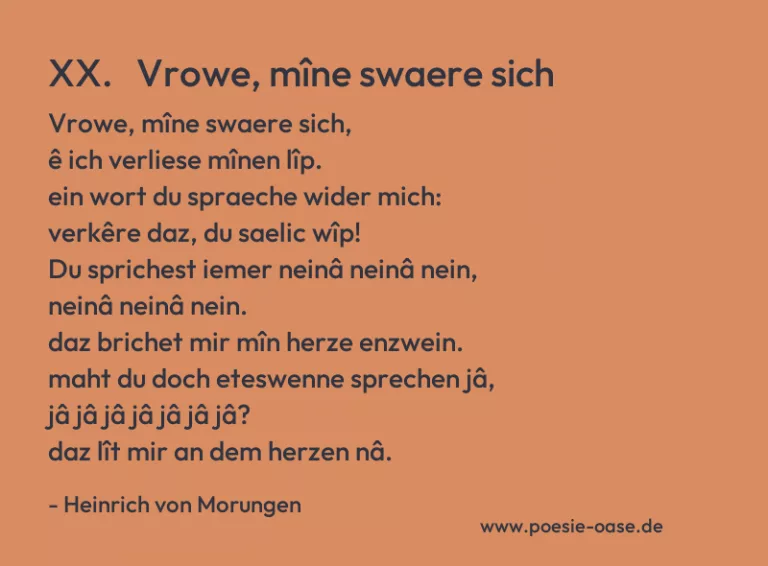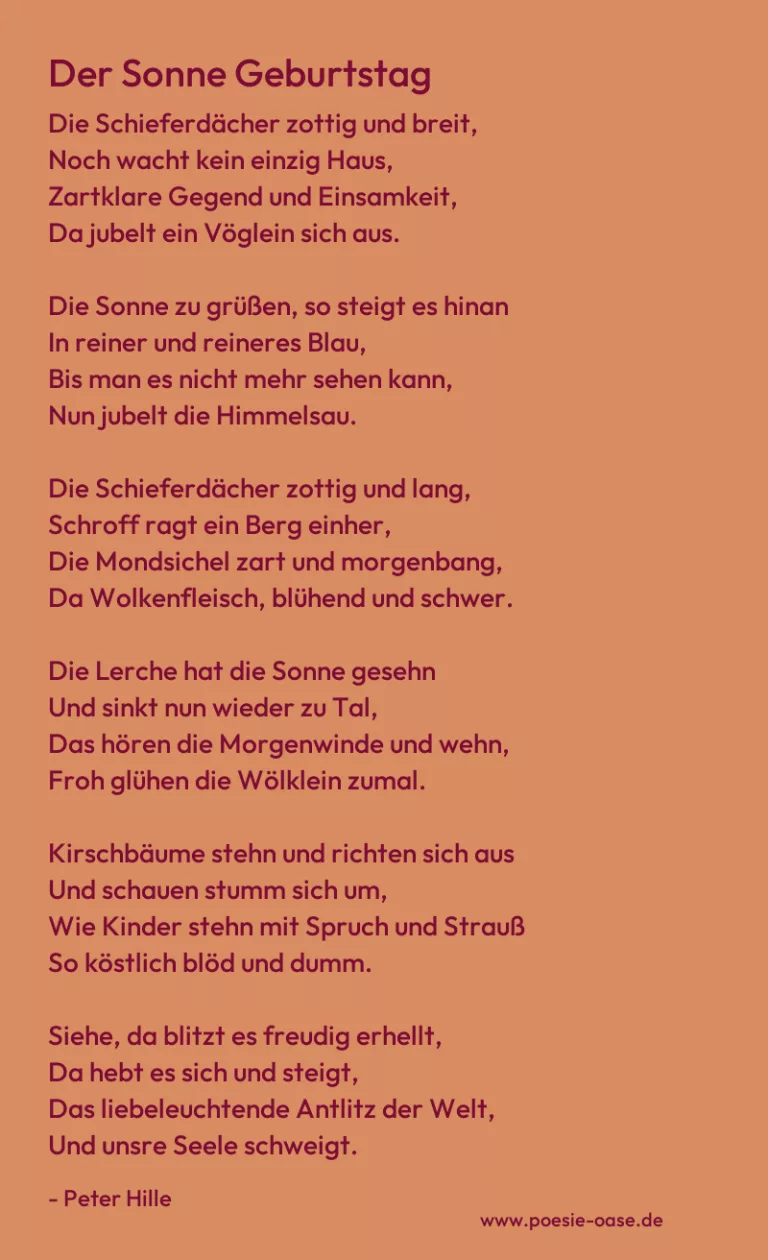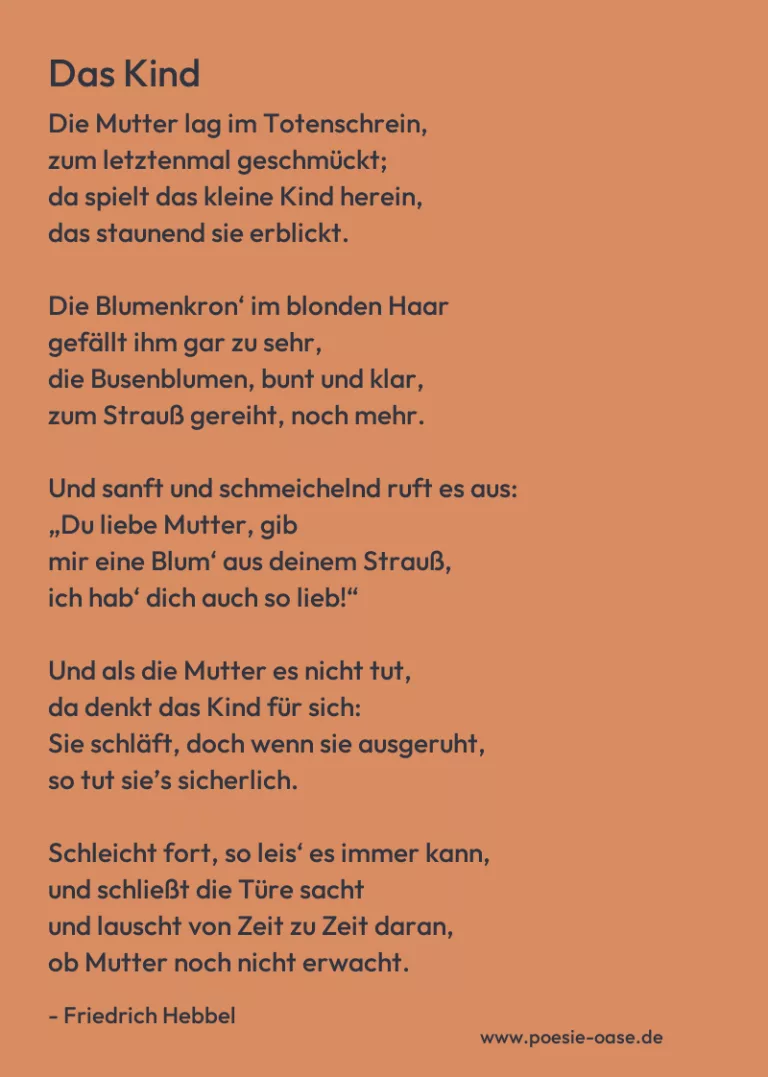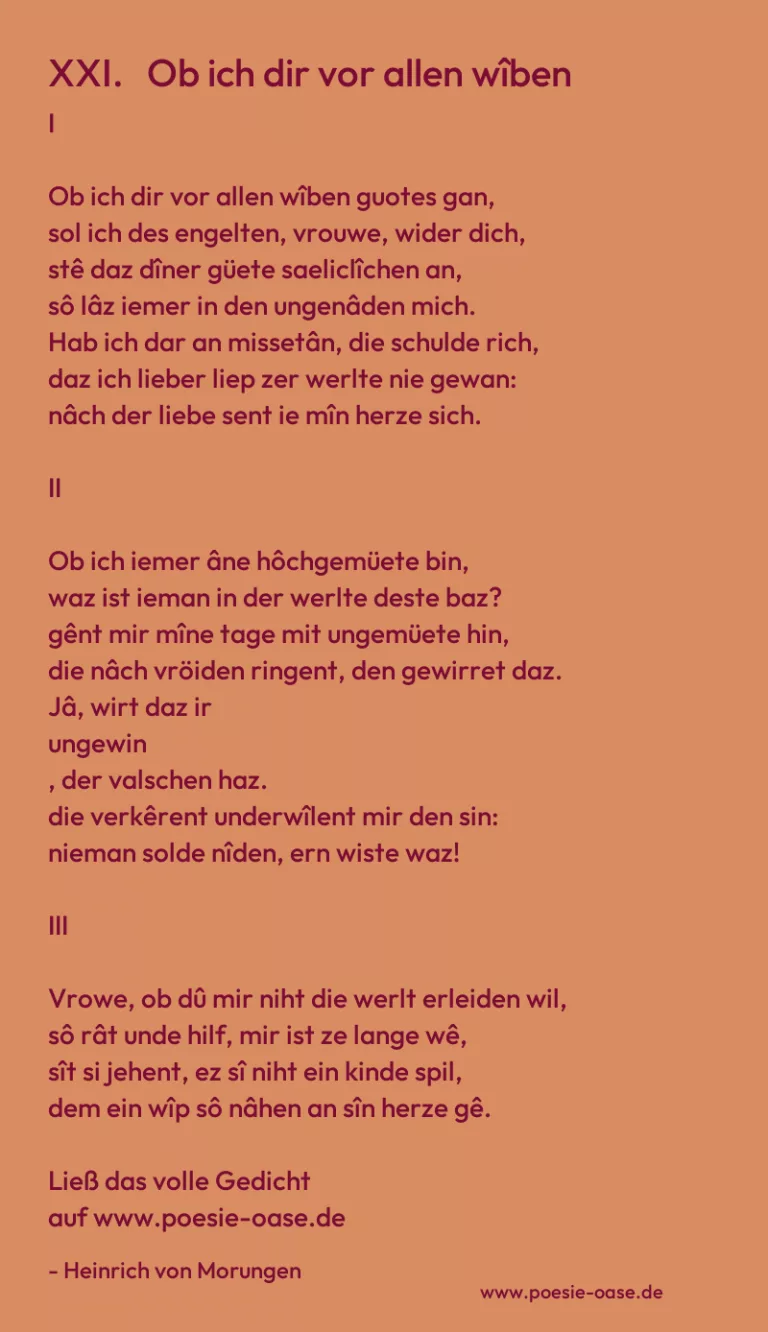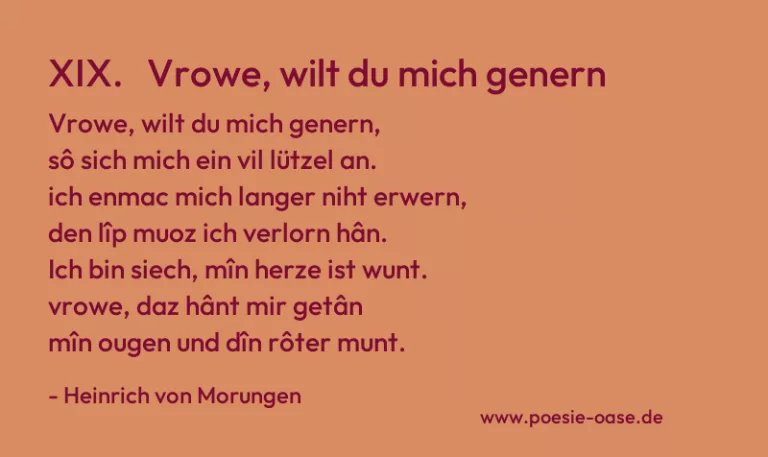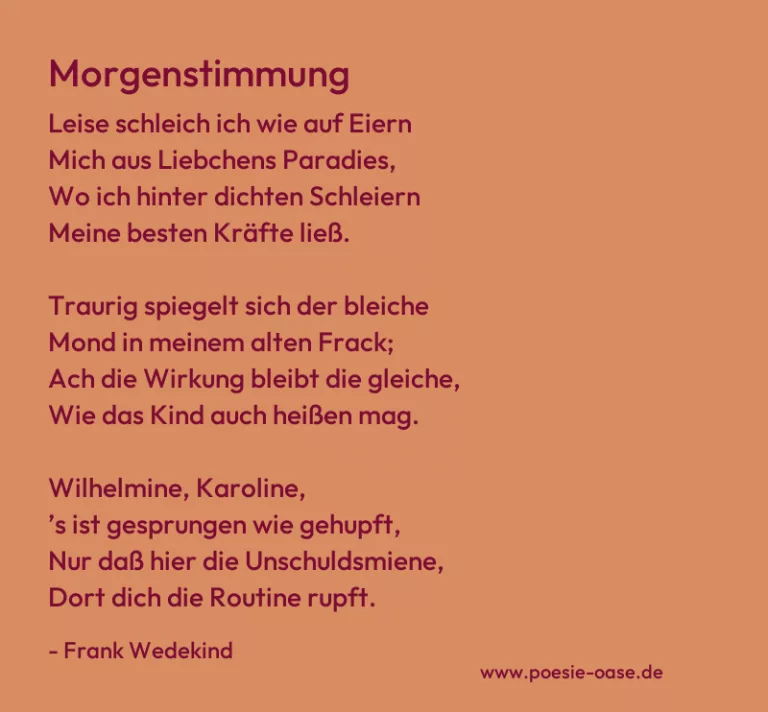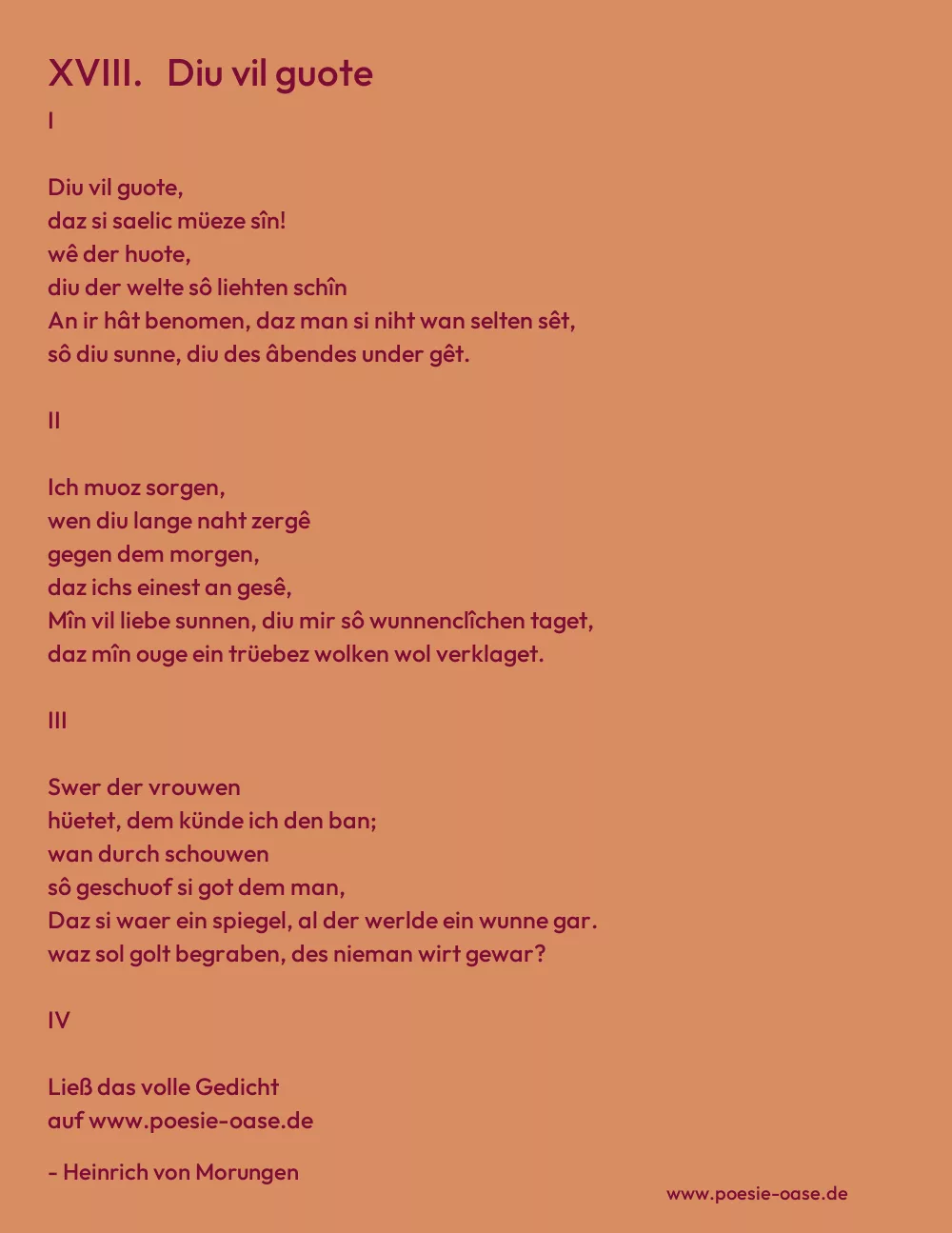XVIII. Diu vil guote
I
Diu vil guote,
daz si saelic müeze sîn!
wê der huote,
diu der welte sô liehten schîn
An ir hât benomen, daz man si niht wan selten sêt,
sô diu sunne, diu des âbendes under gêt.
II
Ich muoz sorgen,
wen diu lange naht zergê
gegen dem morgen,
daz ichs einest an gesê,
Mîn vil liebe sunnen, diu mir sô wunnenclîchen taget,
daz mîn ouge ein trüebez wolken wol verklaget.
III
Swer der vrouwen
hüetet, dem künde ich den ban;
wan durch schouwen
sô geschuof si got dem man,
Daz si waer ein spiegel, al der werlde ein wunne gar.
waz sol golt begraben, des nieman wirt gewar?
IV
Wê der huote,
die man reinen wîben tuot!
huote machet
staete vrouwen wankelmuot.
Man sol vrouwen schouwen unde lâzen âne twanc.
ich sach, daz ein sieche verboten wazzer tranc.
V
Ascholoie
diu vil guote heizet wol.
erst von Troie
Paris, der si minnen sol.
Obe er kiesen solde under den schoenesten, die nu leben
sô wurde ir der apfel, waer er unvergeben.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
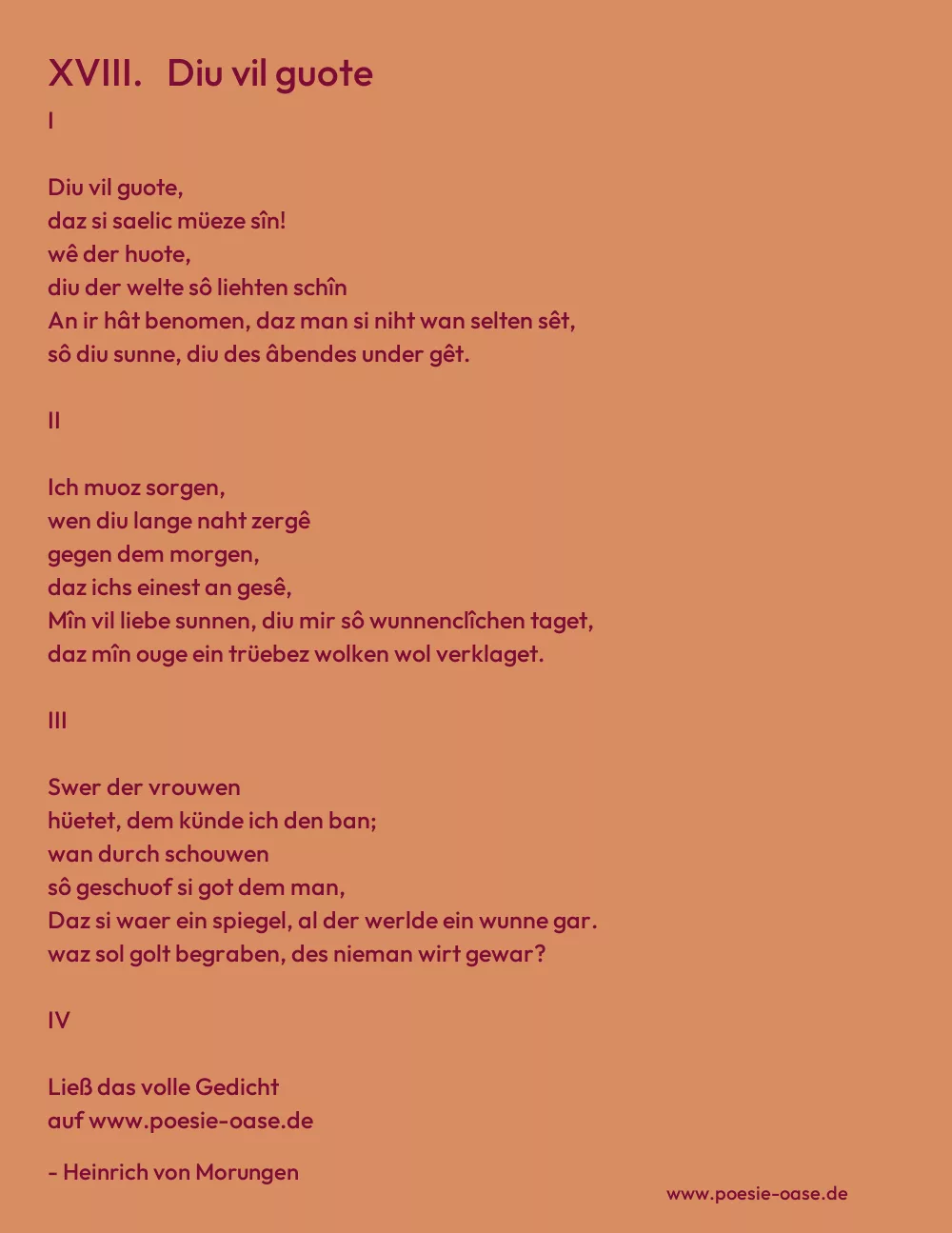
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Diu vil guote“ von Heinrich von Morungen ist ein kunstvoller Lobgesang auf eine überragend schöne und tugendhafte Frau, deren Seltenheit und Erhabenheit in vielfältigen Bildern gepriesen wird. Gleichzeitig bringt es Kritik an gesellschaftlichen Konventionen zum Ausdruck, etwa an der strengen Bewachung von Frauen („huote“), die im Minnesang oft ein Hindernis für die freie Liebe darstellt.
Bereits in der ersten Strophe wird die Geliebte mit der Sonne verglichen – ein klassisches Motiv, das ihre Leuchtkraft, Schönheit und göttliche Erhabenheit unterstreicht. Doch zugleich wird betont, dass sie kaum zu sehen ist, weil sie durch „huote“, also Bewachung oder gesellschaftliche Einschränkung, der Welt entzogen wurde. Ihre Seltenheit macht sie umso kostbarer, aber auch unerreichbar.
In der zweiten Strophe beschreibt das lyrische Ich seine Sehnsucht nach ihr, besonders in der Nacht. Die Geliebte erscheint als „vil liebe sunne“, deren Anblick den Tag bringt, während ihr Fehlen durch trübe Wolken symbolisiert wird. Dieses Bild verleiht der Liebe eine kosmische Dimension: Die Geliebte beeinflusst Licht, Zeit und Empfinden des Ichs.
Die dritte und vierte Strophe entfalten eine Reflexion über den Sinn von Bewachung und das Wesen weiblicher Schönheit. Der Sprecher kritisiert die Kontrolle über Frauen, die nicht etwa deren Tugend schützt, sondern ihre Natürlichkeit einschränkt und sogar ins Gegenteil verkehren kann. Frauen, so das Plädoyer, sollten frei und ohne Zwang angeschaut werden dürfen. Die Warnung, dass übertriebene Verbote ungesund seien – wie „ein sieche“, dem Wasser verweigert wird – bringt diese Kritik pointiert zum Ausdruck.
In der letzten Strophe greift Morungen ein mythologisches Bild auf: den Schönheitswettbewerb der Göttinnen, bei dem Paris der Schönsten den Apfel überreicht. Diese Referenz verleiht der Frau im Gedicht eine göttliche Aura. Der Sprecher ist überzeugt, dass selbst Paris ihr den Apfel geben würde, wären ihm alle Frauen der Welt zur Wahl gestellt. Damit erreicht die Verehrung ihren Höhepunkt: Die Geliebte ist nicht nur die Schönste unter den Lebenden, sondern auch unter den Göttinnen.
„Diu vil guote“ verbindet so höfische Idealisierung mit subtiler Gesellschaftskritik. Die Frau wird als Lichtgestalt gefeiert, deren Wirkung tief in die Existenz des Sprechers eingreift. Doch zugleich klagt das Gedicht über die Regeln, die sie unnahbar machen. Daraus entsteht eine spannungsreiche Mischung aus Lob, Sehnsucht und stiller Rebellion gegen die Grenzen der höfischen Welt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.