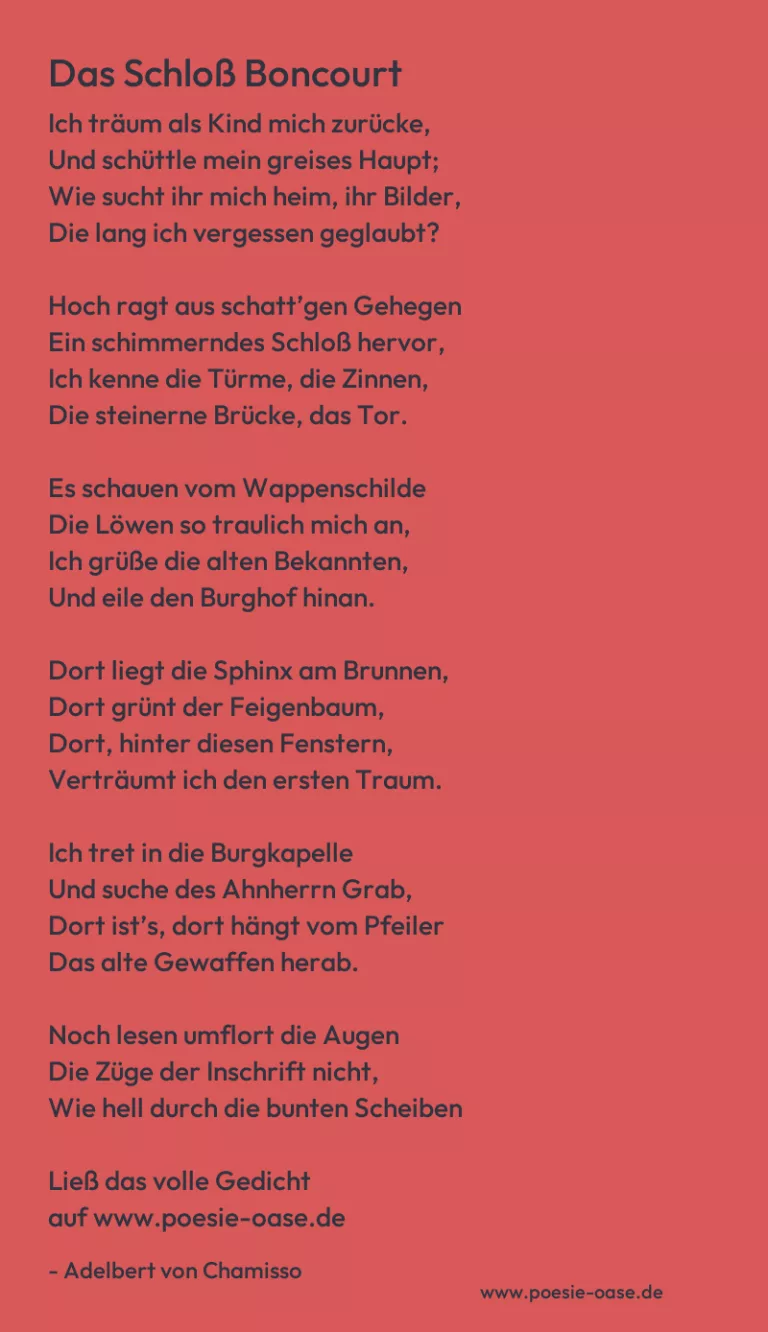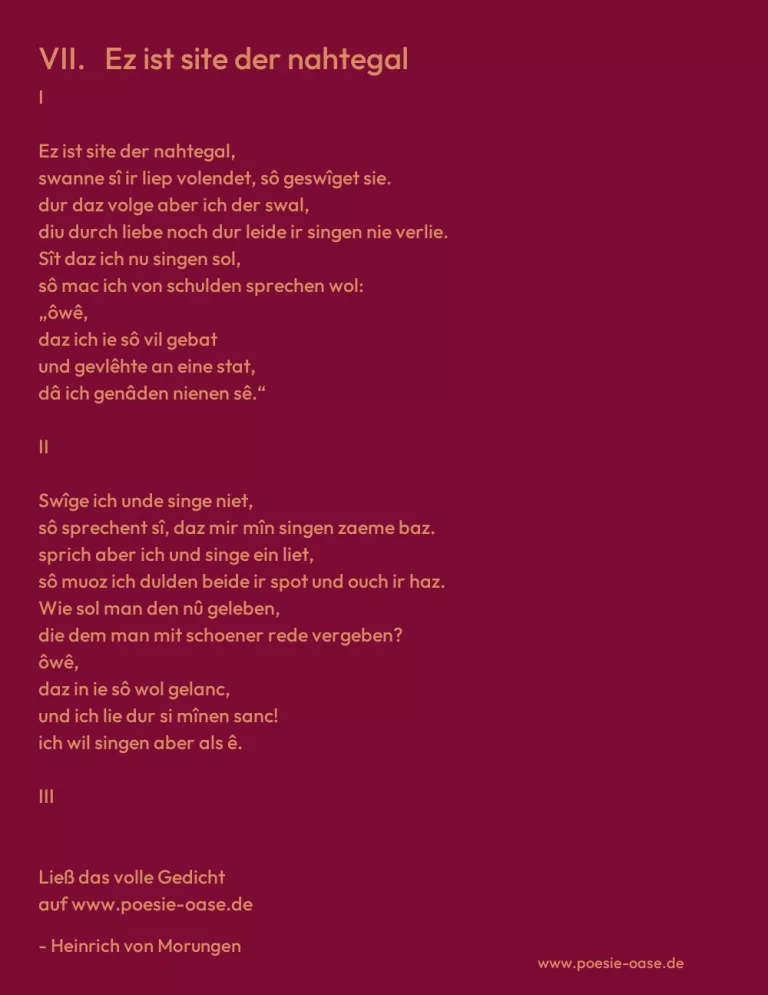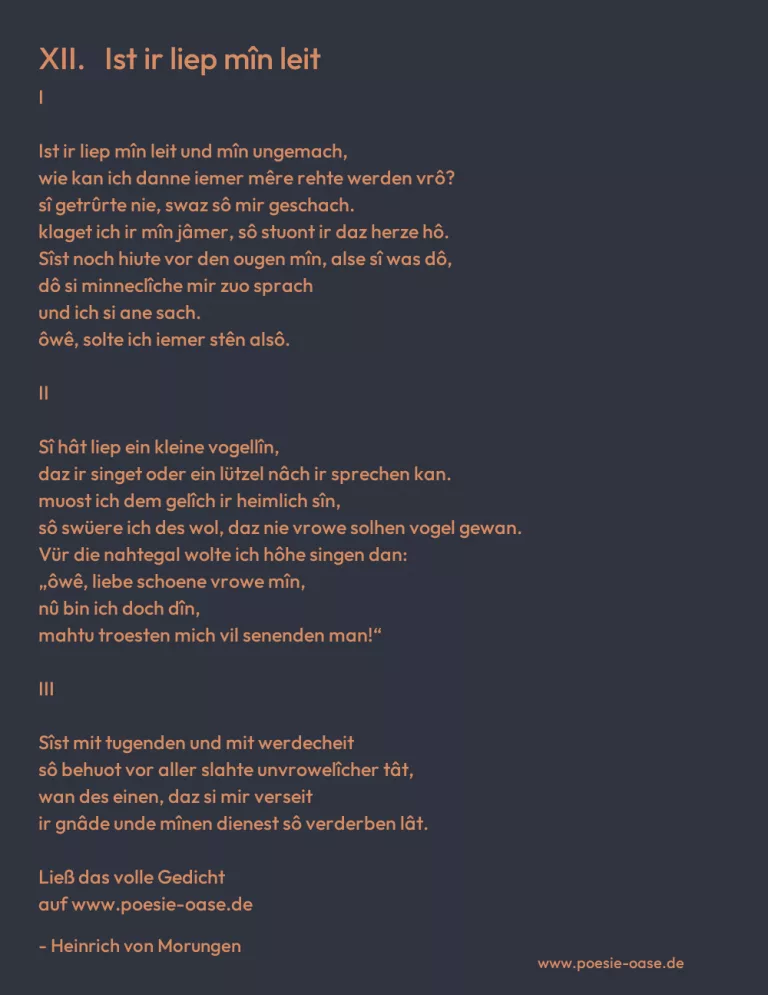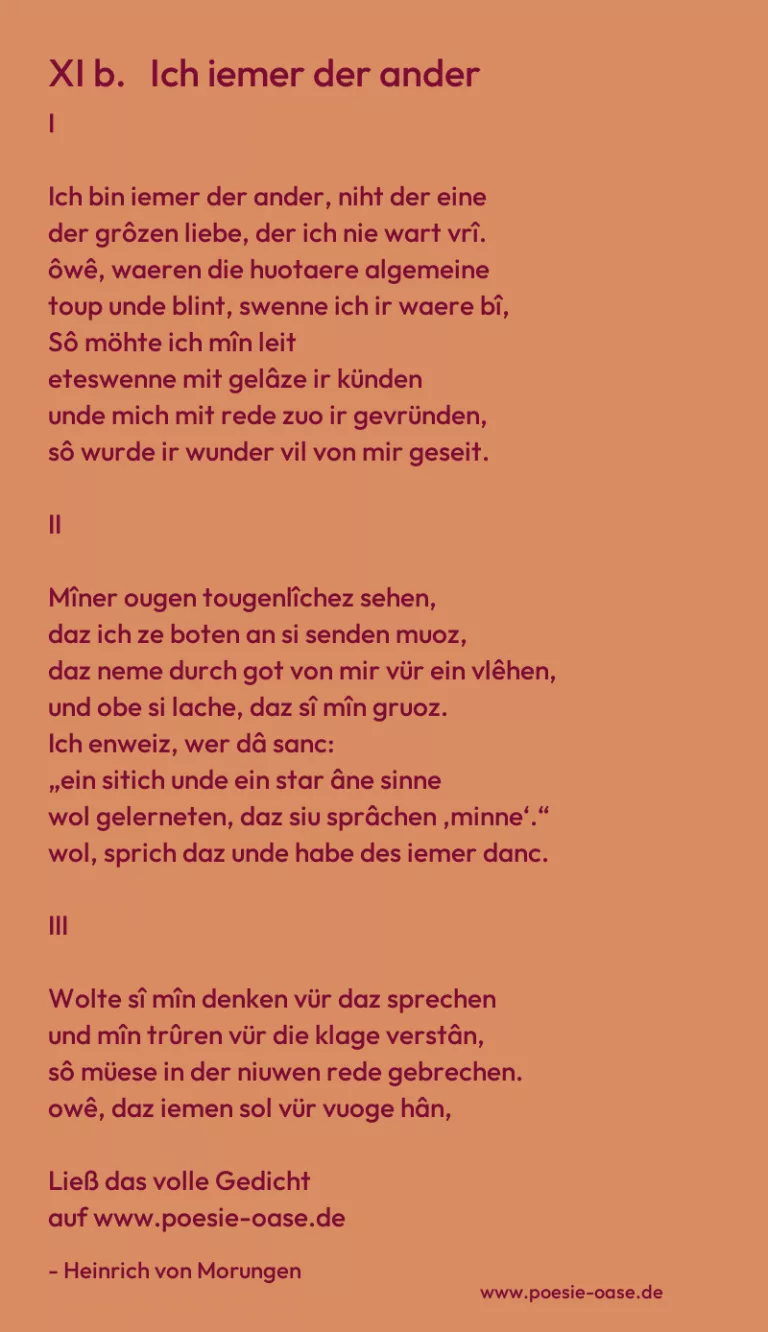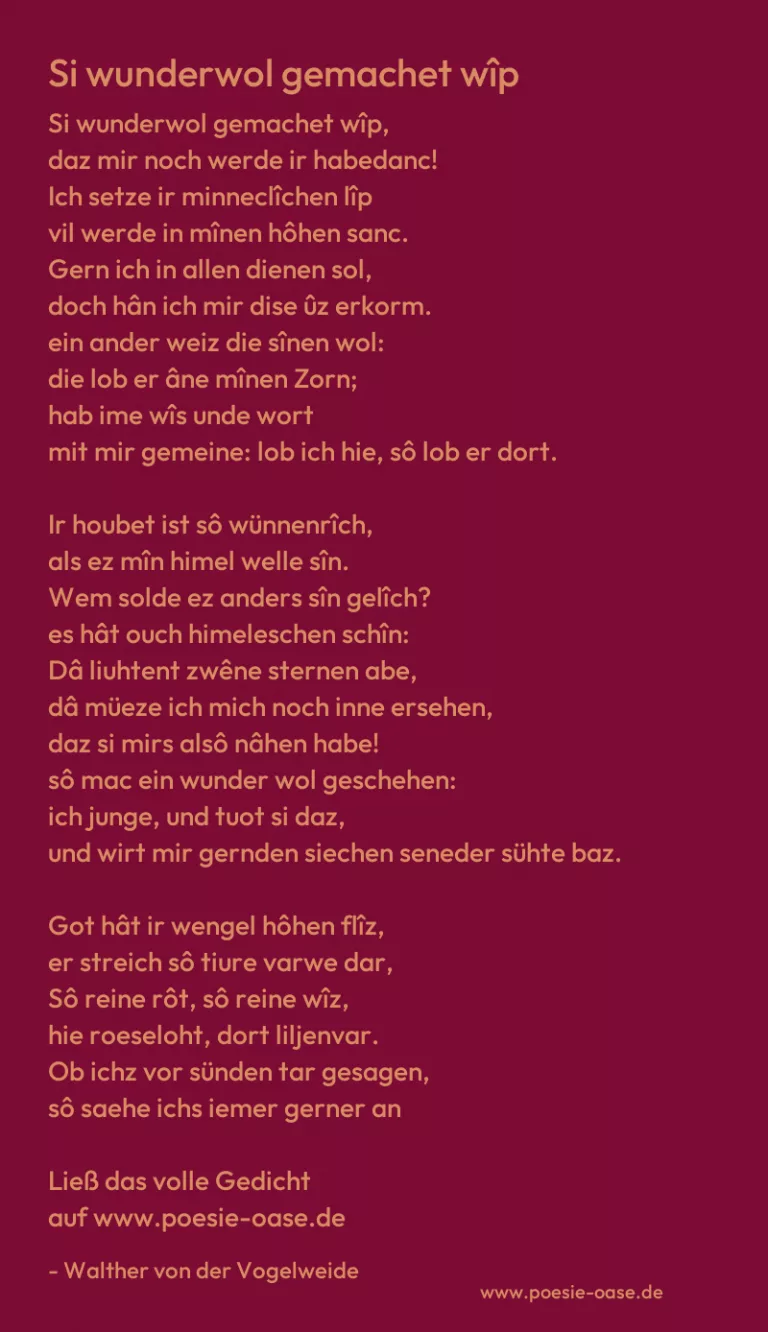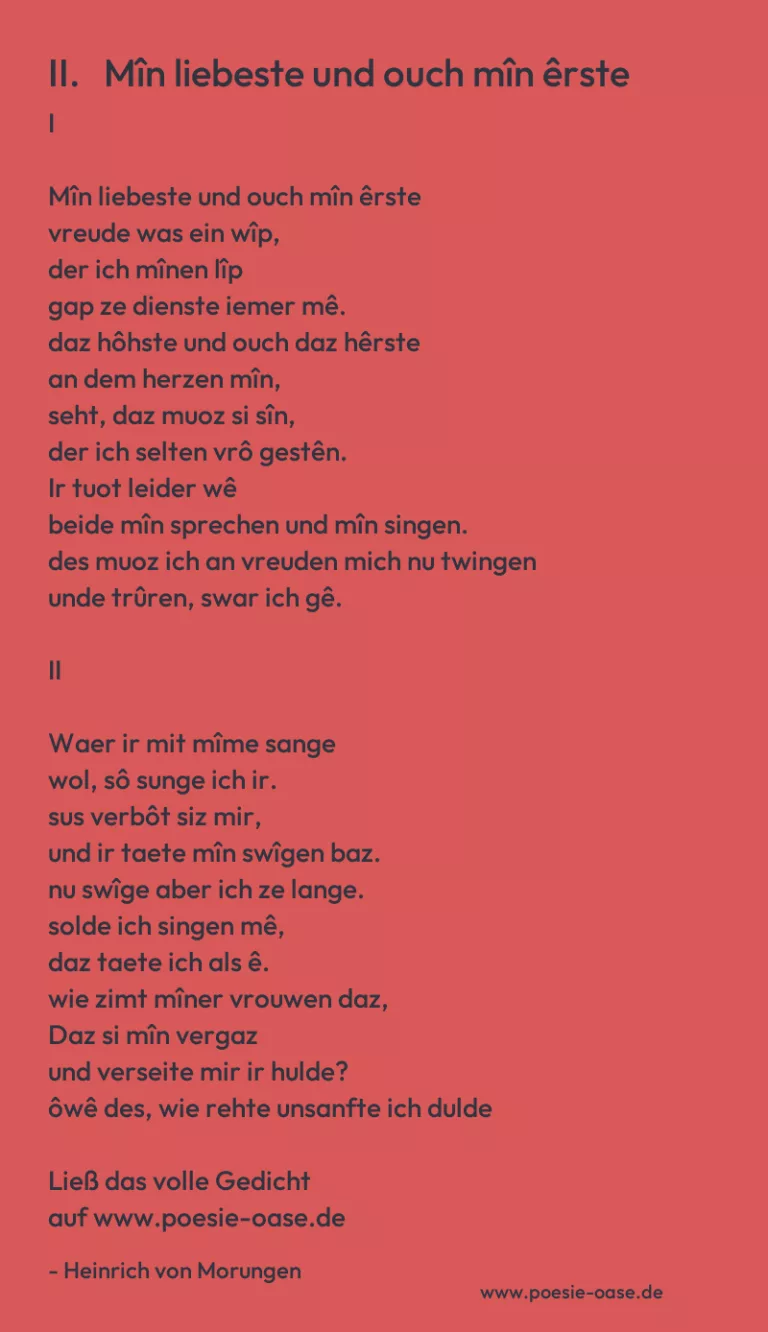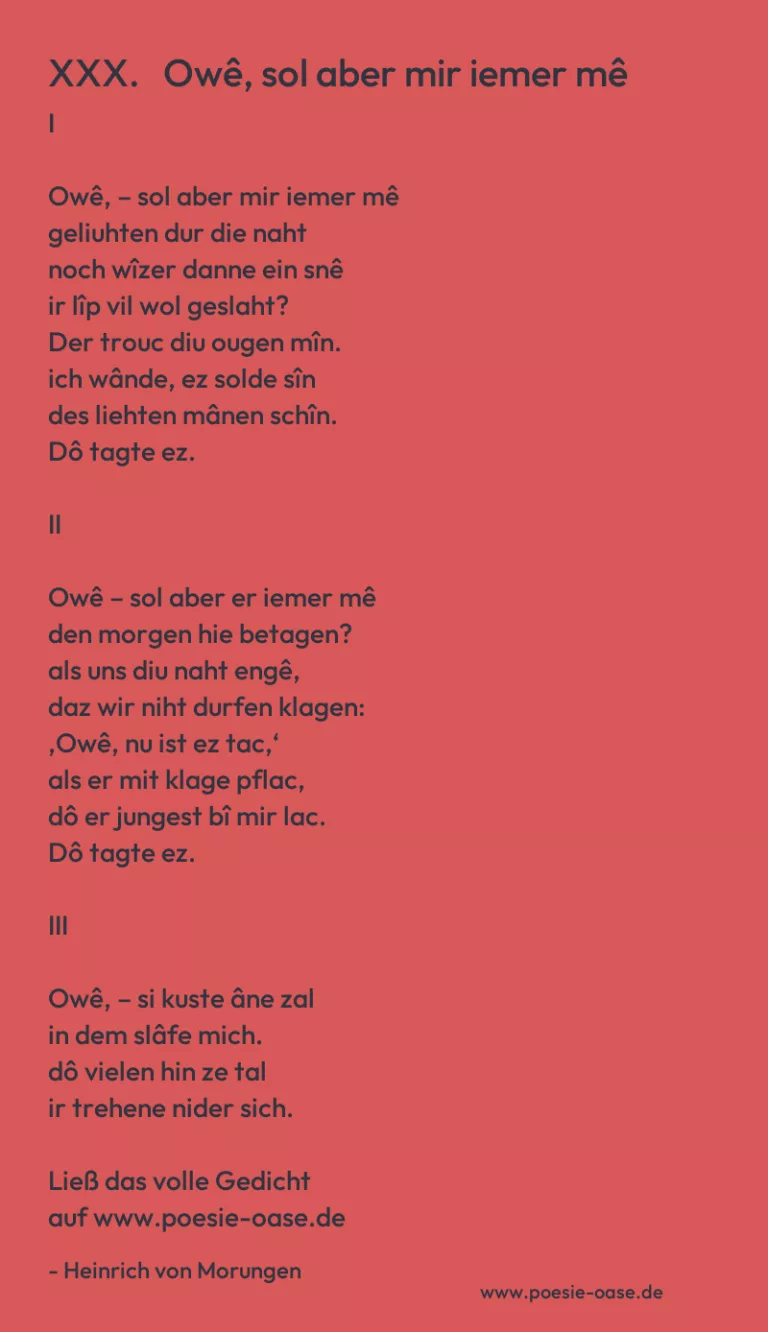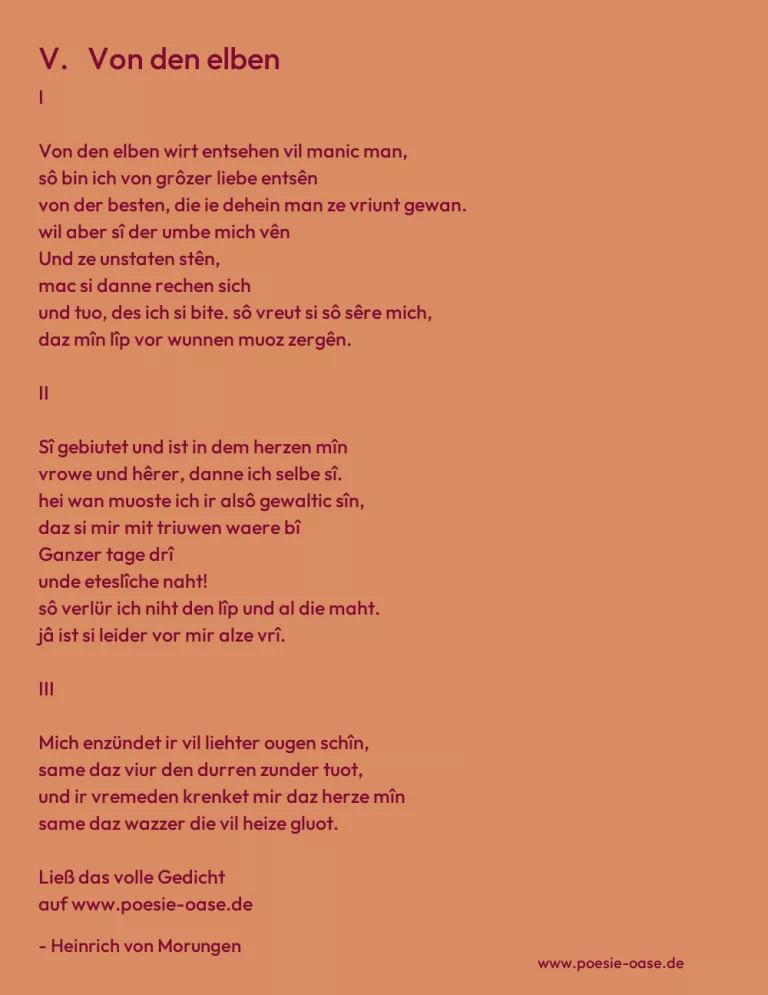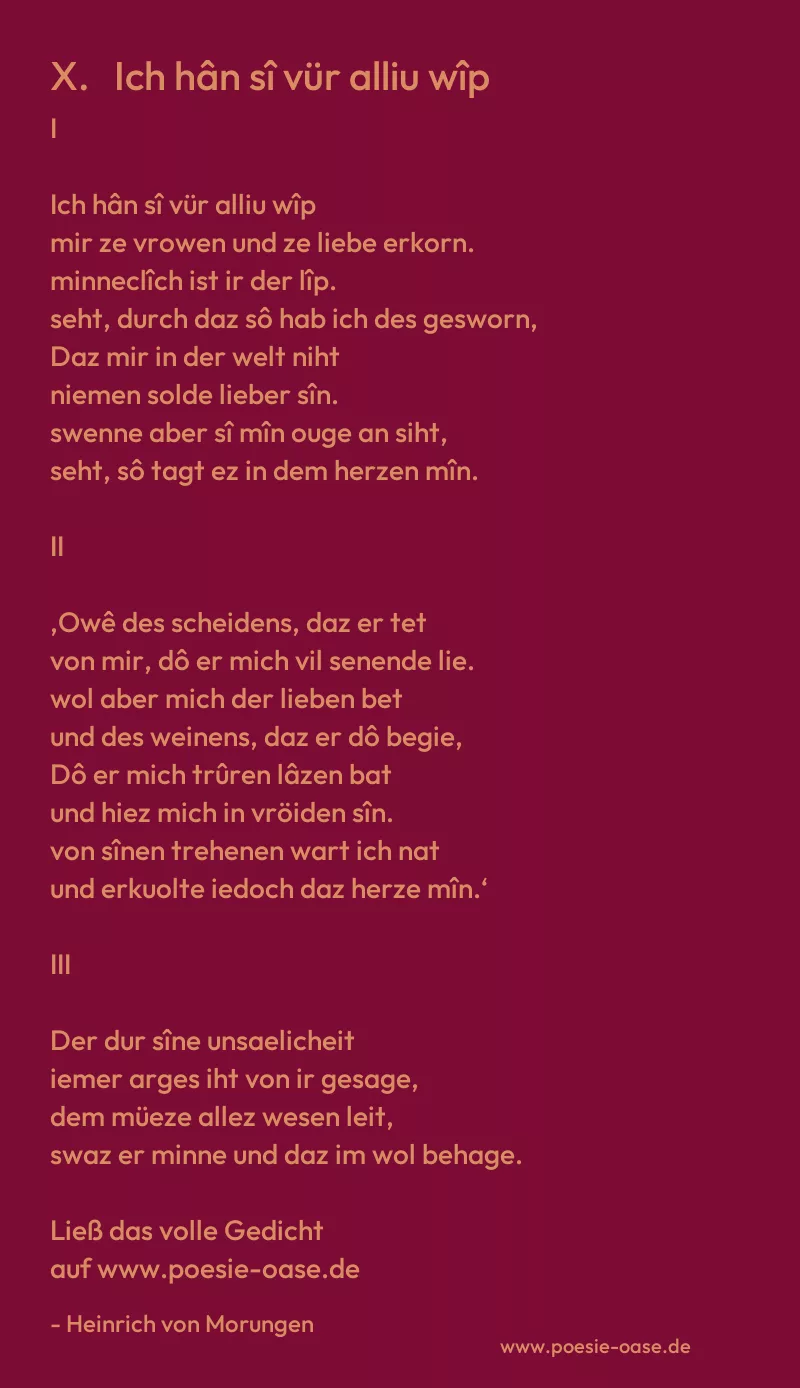X. Ich hân sî vür alliu wîp
I
Ich hân sî vür alliu wîp
mir ze vrowen und ze liebe erkorn.
minneclîch ist ir der lîp.
seht, durch daz sô hab ich des gesworn,
Daz mir in der welt niht
niemen solde lieber sîn.
swenne aber sî mîn ouge an siht,
seht, sô tagt ez in dem herzen mîn.
II
‚Owê des scheidens, daz er tet
von mir, dô er mich vil senende lie.
wol aber mich der lieben bet
und des weinens, daz er dô begie,
Dô er mich trûren lâzen bat
und hiez mich in vröiden sîn.
von sînen trehenen wart ich nat
und erkuolte iedoch daz herze mîn.‘
III
Der dur sîne unsaelicheit
iemer arges iht von ir gesage,
dem müeze allez wesen leit,
swaz er minne und daz im wol behage.
Ich vluoche in, unde schadet in niht,
dur die ich ir muoz vrömde sîn.
als aber sî mîn ouge an siht,
sô taget ez in dem herzen mîn.
IV
‚Owê, waz wîzent si einem man,
der nie vrowen leit noch arc gesprach
und in aller êren gan?
durch daz müet mich sîn ungemach,
Daz si in sô schône grüezent wal
und zuo ime redende gânt
und in doch als einen bal
mit boesen worten umbe slânt.‘
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
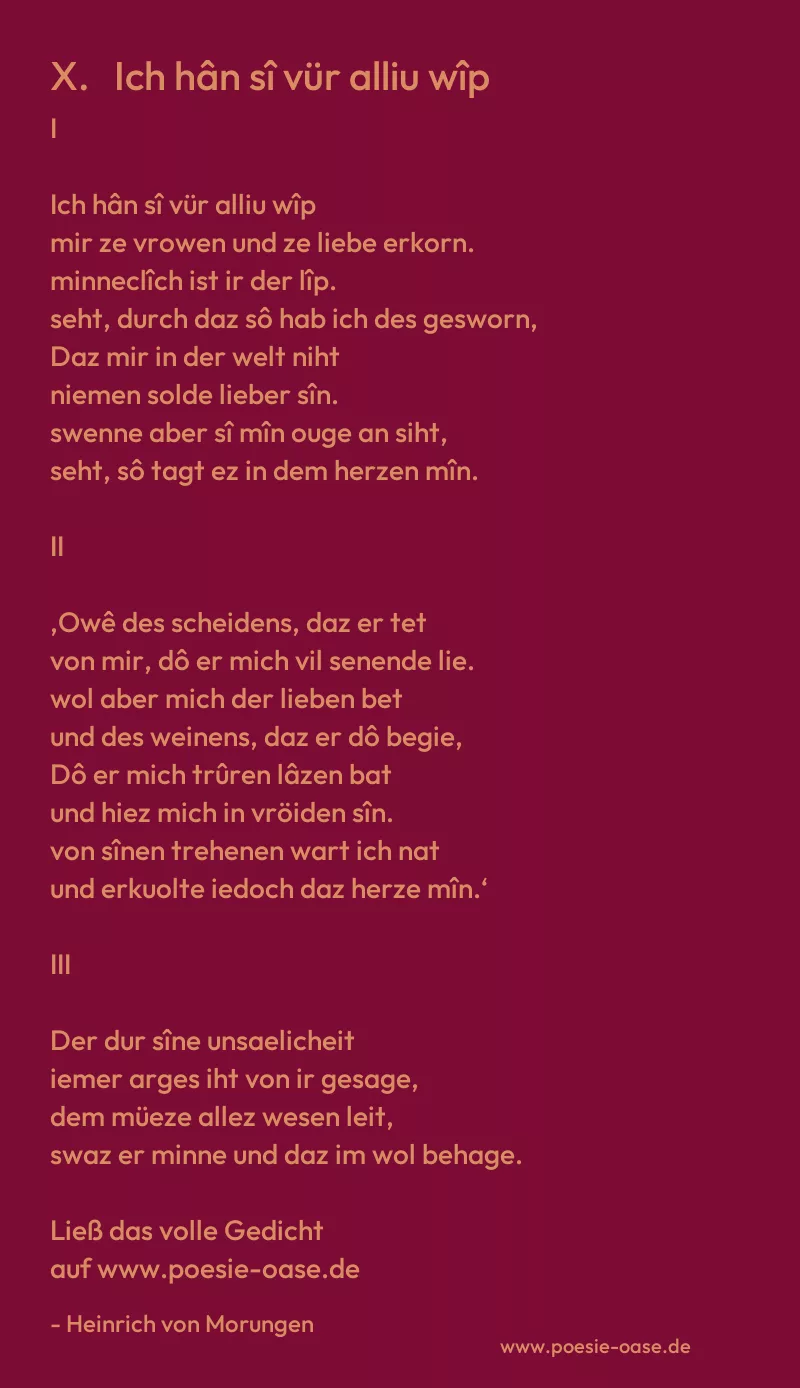
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ich hân sî vür alliu wîp“ von Heinrich von Morungen ist eine eindringliche Darstellung ritterlich-höfischer Minne, in der Verehrung, Schmerz und Unverfügbarkeit der Geliebten im Zentrum stehen. Das lyrische Ich erklärt seine Geliebte zur Einzigen, zur Erwählten „vür alliu wîp“, also über alle anderen Frauen gestellt. Diese ideale Überhöhung steht ganz im Zeichen der mittelalterlichen Minne, bei der die Liebe oft einseitig, unerfüllt und dennoch verpflichtend bleibt.
In der ersten Strophe wird die Wirkung der Geliebten beschrieben: Schon der bloße Anblick lässt das Herz des Sprechers „tagen“ – ein schönes Bild für das Aufleuchten von Freude und Leben. Die Liebe ist hier nicht körperlich, sondern seelisch-spirituell gedacht; sie entfacht Licht im Inneren, selbst ohne Erwiderung.
Die zweite und vierte Strophe sind als direkte Klage der Geliebten formuliert. Das lyrische Ich zitiert sie, wodurch ihre Stimme eine tragende Rolle erhält. In diesen Passagen wird deutlich, dass auch sie unter Trennung, Täuschung und falscher Männerliebe leidet. Besonders im zweiten Teil der vierten Strophe wird ihr Verhalten gegenüber einem anderen Mann thematisiert – sie begegnet ihm freundlich, um ihn dann mit scharfen Worten abzuweisen. Diese Ambivalenz verstärkt das Bild der Frau als widersprüchlich und unergründlich – ein typisches Motiv der Minne-Dichtung.
In der dritten Strophe reagiert der Sprecher auf einen Dritten, der offenbar durch sein Verhalten das Verhältnis zur Geliebten gestört hat. Der Liebende verflucht diesen Nebenbuhler, obwohl er sich dadurch selbst von der Geliebten entfremdet sieht. Trotzdem bleibt sein Gefühl unerschütterlich – sobald er sie sieht, „taget ez in dem herzen mîn“. Diese Wiederholung aus der ersten Strophe wirkt wie ein Refrain und unterstreicht die konstante Wirkung der Geliebten auf ihn, unabhängig von äußeren Umständen.
Insgesamt spiegelt das Gedicht ein zentrales Spannungsverhältnis mittelalterlicher Liebeslyrik: zwischen idealisierter Verehrung, innerer Bindung und äußerer Trennung. Heinrich von Morungen gelingt es, die emotionale Zerrissenheit eines Liebenden darzustellen, der trotz aller Kränkungen und Zweifel in seinem Gefühl verharrt – getrieben von einer Liebe, die sich selbst genügt, aber nicht ohne Schmerz bleibt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.