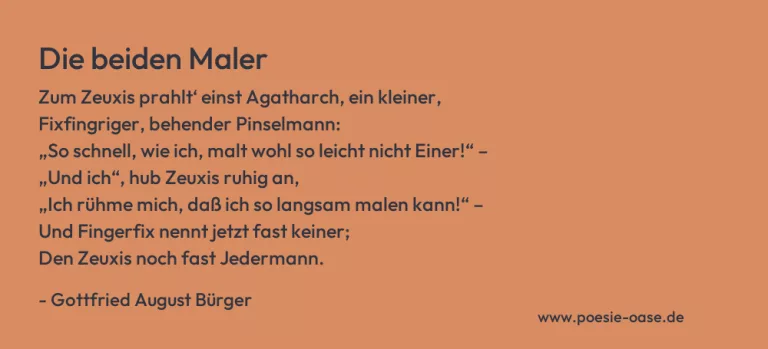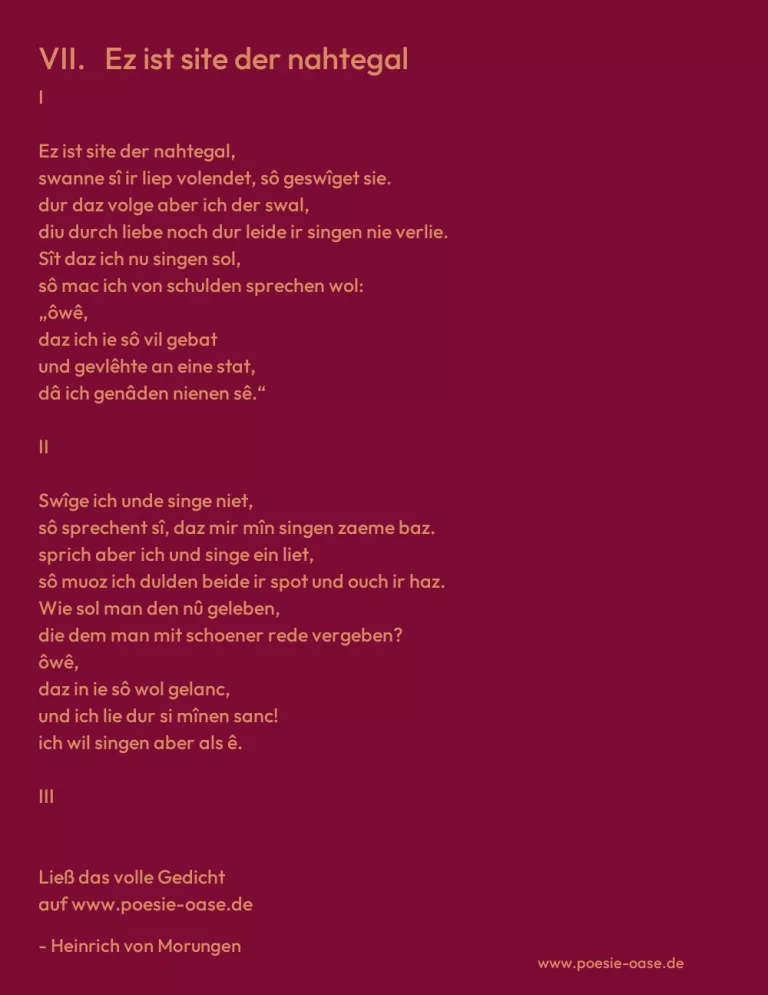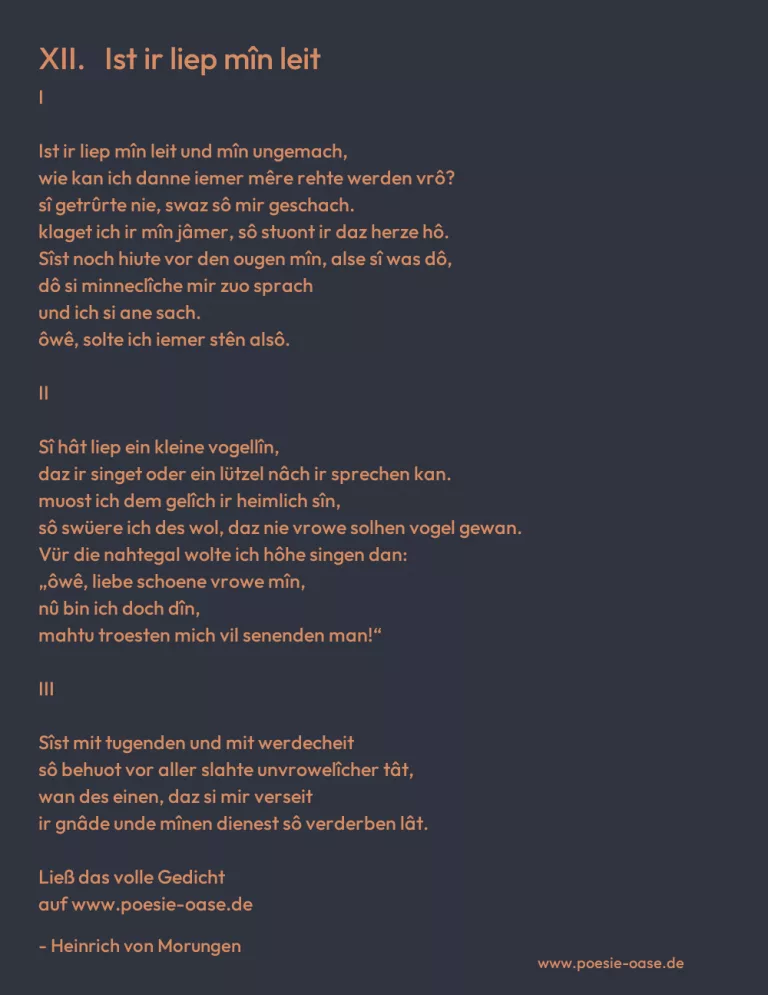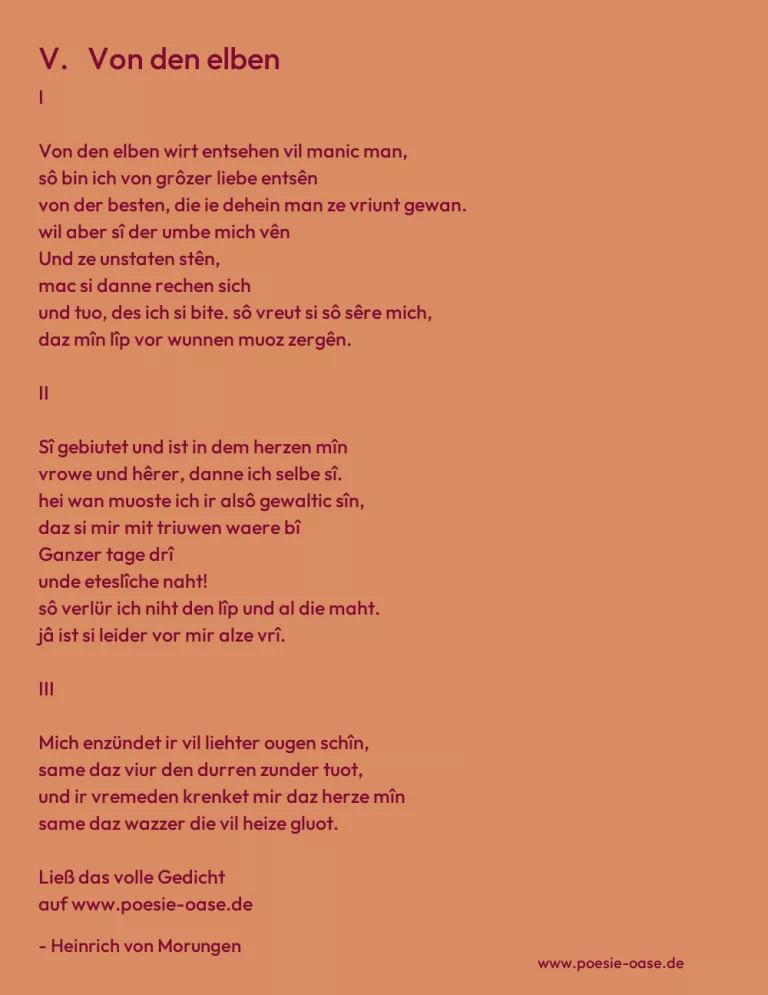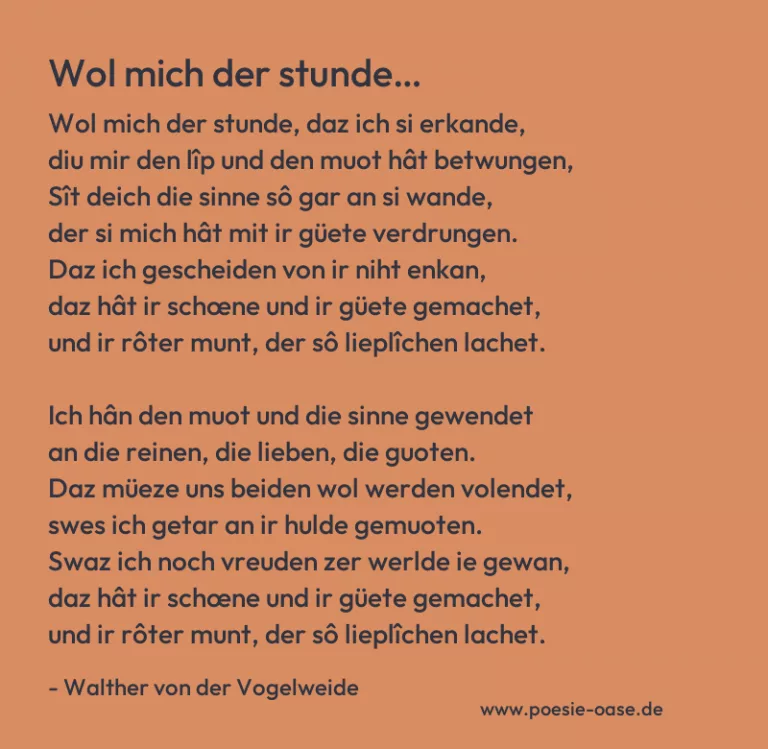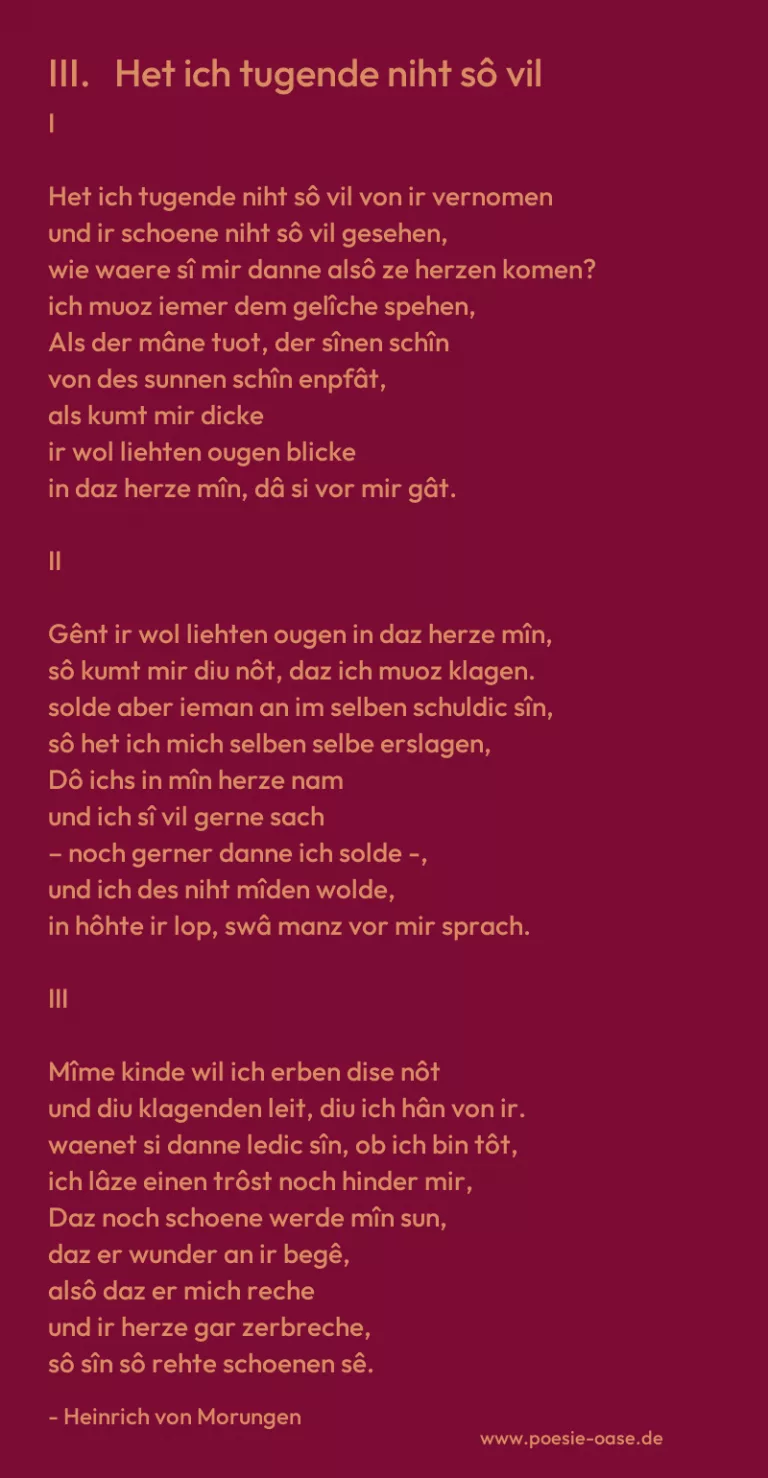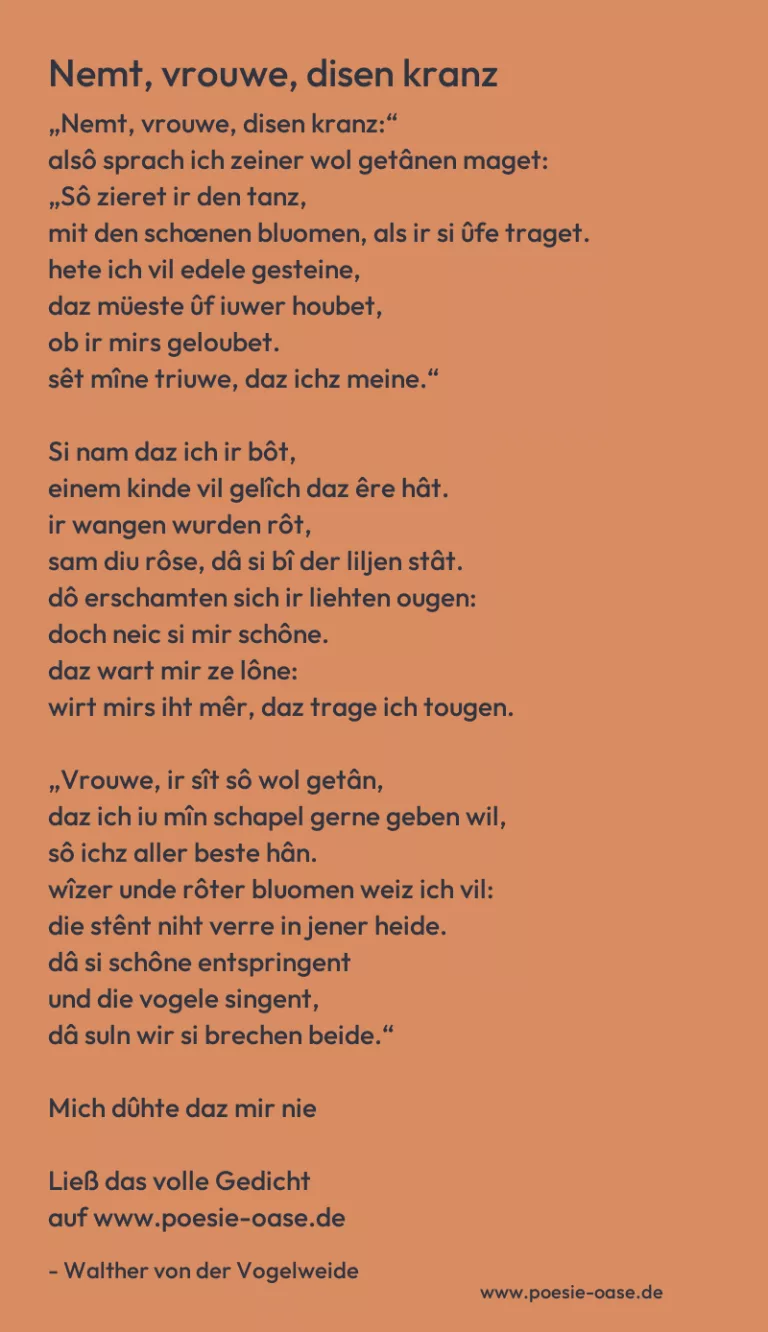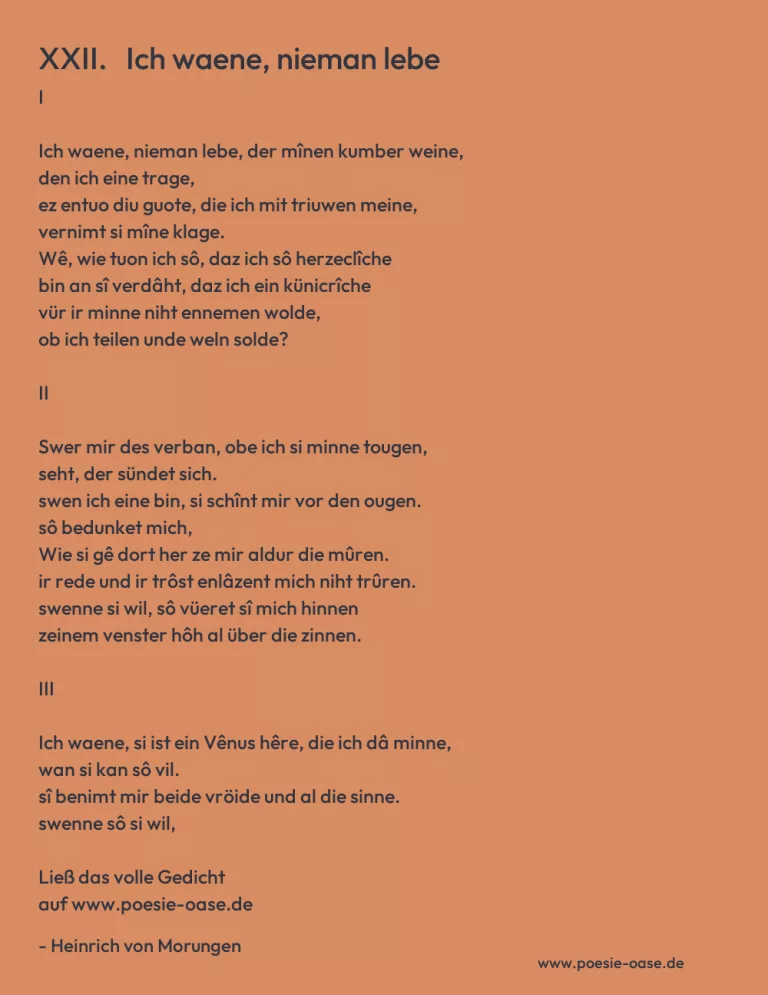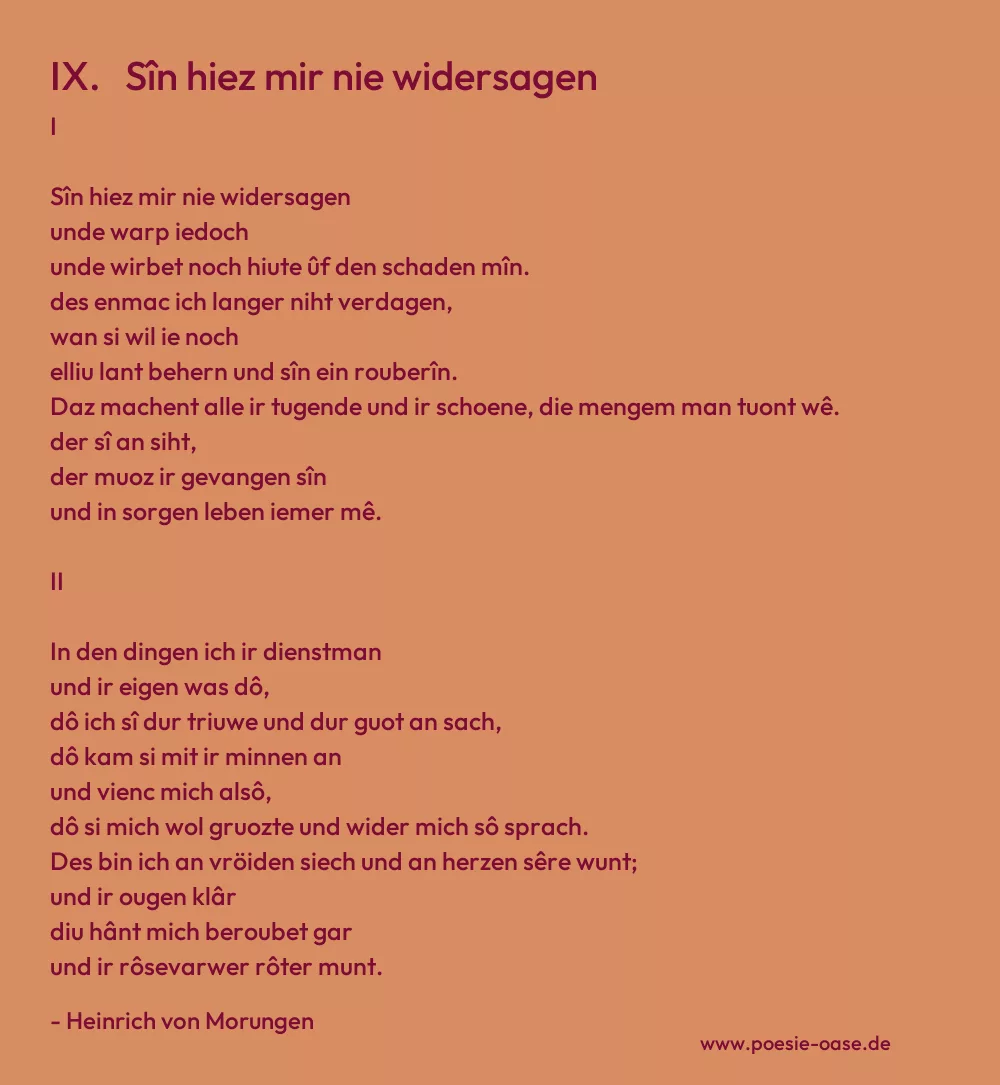IX. Sîn hiez mir nie widersagen
I
Sîn hiez mir nie widersagen
unde warp iedoch
unde wirbet noch hiute ûf den schaden mîn.
des enmac ich langer niht verdagen,
wan si wil ie noch
elliu lant behern und sîn ein rouberîn.
Daz machent alle ir tugende und ir schoene, die mengem man tuont wê.
der sî an siht,
der muoz ir gevangen sîn
und in sorgen leben iemer mê.
II
In den dingen ich ir dienstman
und ir eigen was dô,
dô ich sî dur triuwe und dur guot an sach,
dô kam si mit ir minnen an
und vienc mich alsô,
dô si mich wol gruozte und wider mich sô sprach.
Des bin ich an vröiden siech und an herzen sêre wunt;
und ir ougen klâr
diu hânt mich beroubet gar
und ir rôsevarwer rôter munt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
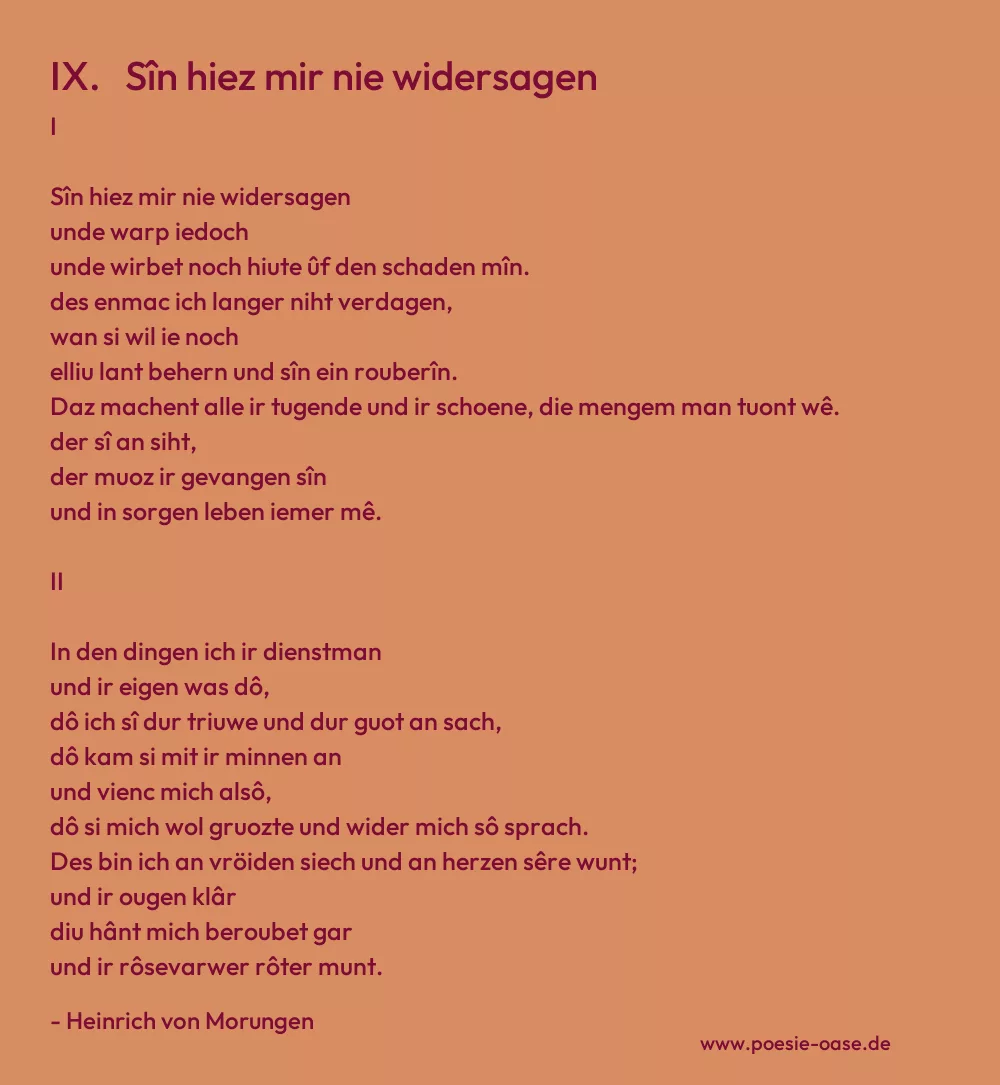
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sîn hiez mir nie widersagen“ von Heinrich von Morungen beschreibt die Qualen und inneren Widersprüche eines Liebenden, der von einer unerreichbaren oder möglicherweise unerfüllten Liebe gequält wird. Im ersten Teil des Gedichts beschreibt der Sprecher, wie er niemals widersprochen hat, doch die Liebe, die ihm entgegenschlägt, fügt ihm tiefe Verletzungen zu. Die „Tugenden“ und „Schönheit“ der Geliebten, die zunächst bewundernswert erscheinen, führen ihn schließlich in eine schmerzhafte und unerbittliche Situation, in der er von ihr „gefangen“ ist und in ständigen Sorgen lebt. Diese Widersprüche verdeutlichen die tragische Natur seiner Liebe, die ihm einerseits Freude und Bewunderung, andererseits aber auch ständigen Schmerz bereitet.
Im zweiten Teil wird die Beziehung weiter entfaltet. Der Sprecher schildert seine frühere Hingabe und Treue zu der Geliebten, die ihn zunächst mit Liebe und Zuneigung überhäuft. Doch diese Liebe führt zu einer unerträglichen Enttäuschung, als er von ihr verletzt wird. Es wird deutlich, dass er in eine Art geistige und emotionale Gefangenschaft geraten ist, in der er zwischen Hoffnung und Schmerz hin- und hergerissen wird. Der Widerspruch zwischen der äußerlichen Zuwendung der Geliebten und der inneren Zerrissenheit des Sprechers ist schmerzhaft, da ihre „Rosenfarbe“ und „roter Mund“ ihm gleichzeitig Glück und Leid bringen.
Das Gedicht verdeutlicht die Unausweichlichkeit des inneren Konflikts des lyrischen Ichs, das sich zwischen Liebe und Schmerz befindet. Heinrich von Morungen zeigt auf, wie eine unerfüllte oder ungleiche Liebe zu einem Zustand der Verzweiflung führen kann. Die Geliebte wird als eine mächtige, aber auch zerstörerische Figur dargestellt, die die emotionalen und physischen Kräfte des Sprechers in Beschlag nimmt. Dabei wird die ambivalente Rolle der Liebe als Quelle sowohl von Schönheit als auch von Qual thematisiert.
Insgesamt spiegelt das Gedicht die Themen von Liebe, Schmerz und emotionaler Gefangenschaft wider, die typisch für die mittelalterliche Liebesdichtung sind. Morungen beschreibt die Liebe als einen Zustand, der den Liebenden mit Hoffnung beglückt, ihn aber auch gleichzeitig in tiefste Not stürzt. Die Unentrinnbarkeit dieser Liebe und die dauerhafte Belastung durch unerfüllte Sehnsüchte sind zentrale Themen des Gedichts.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.