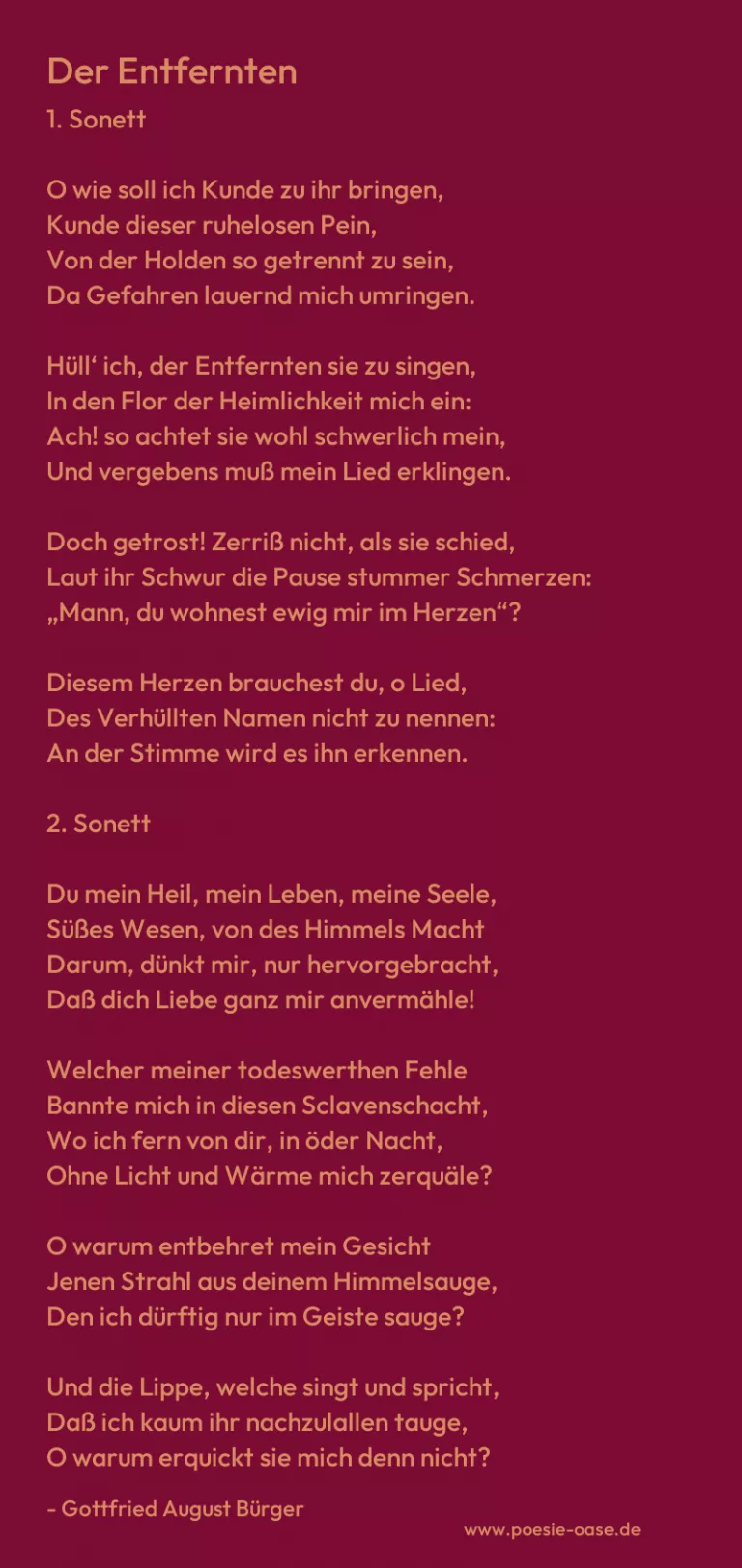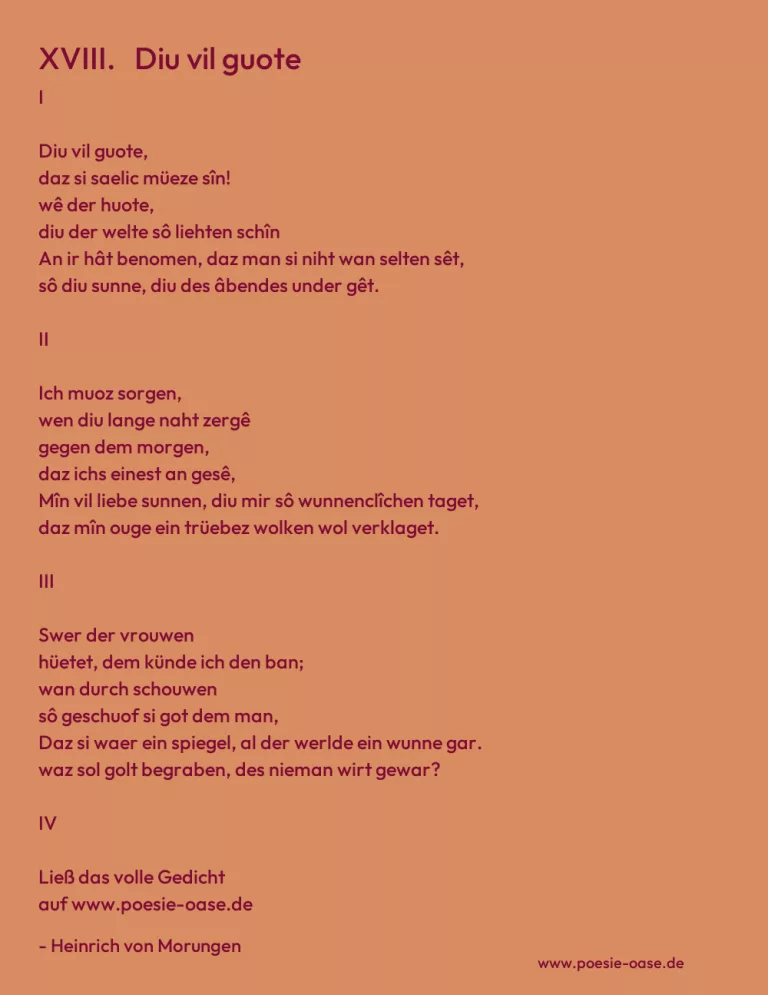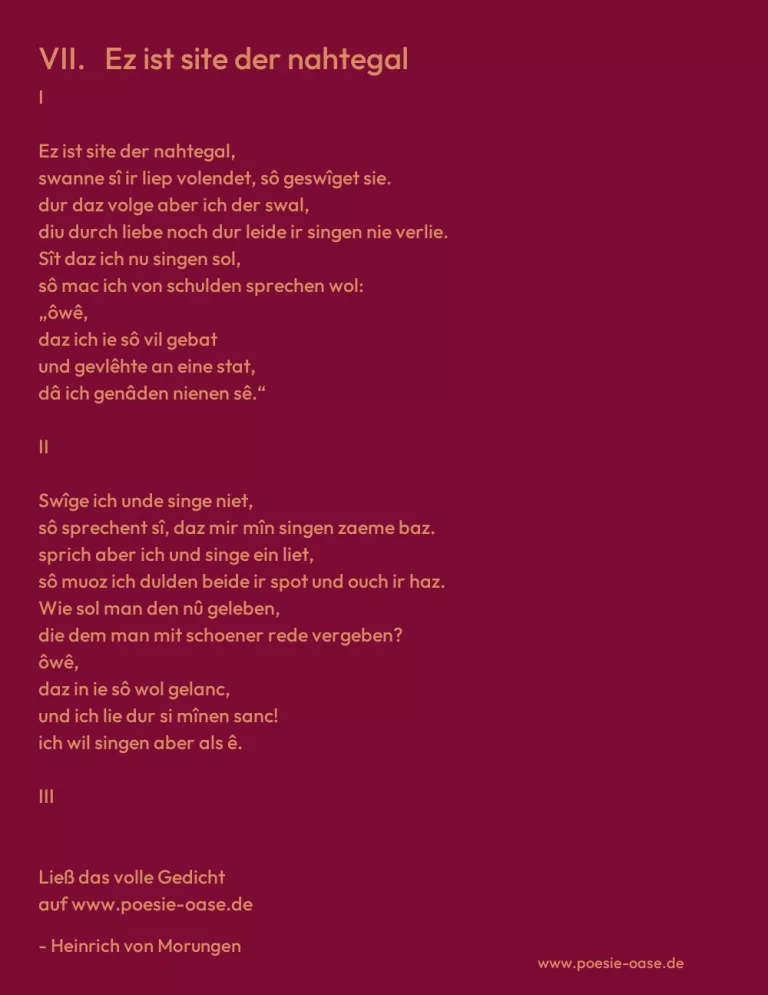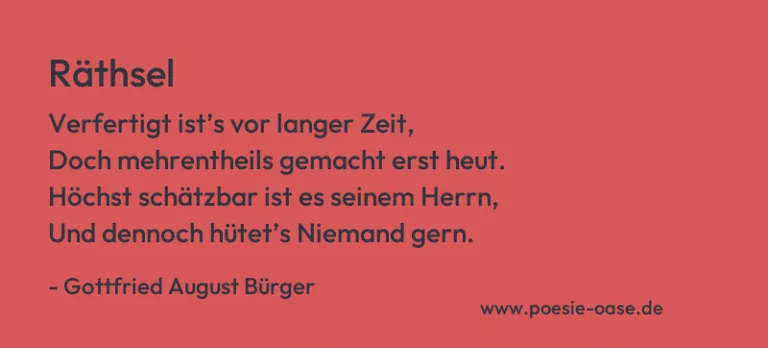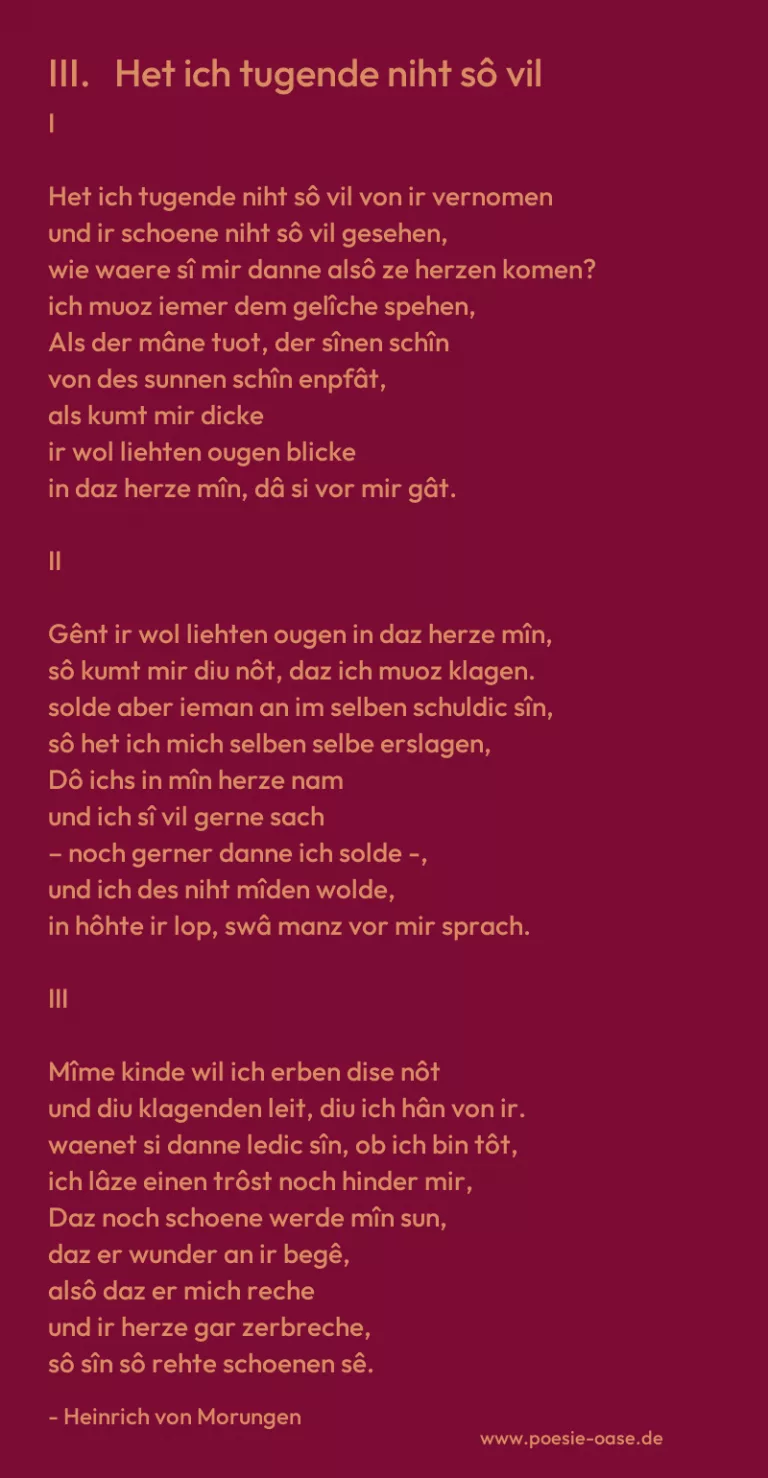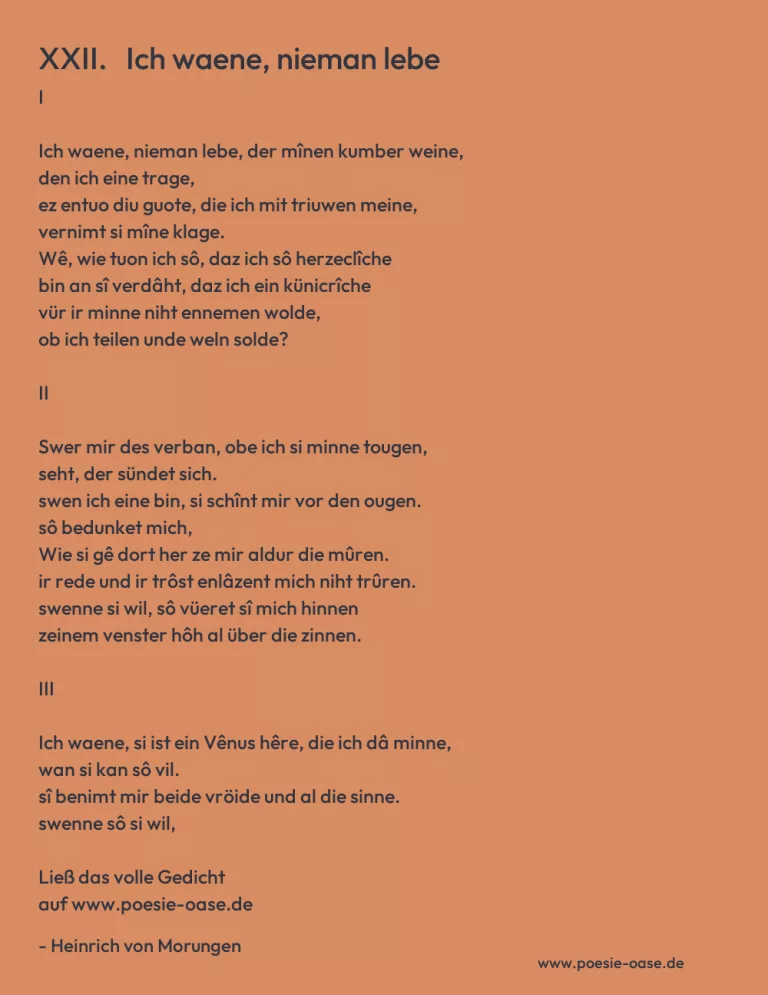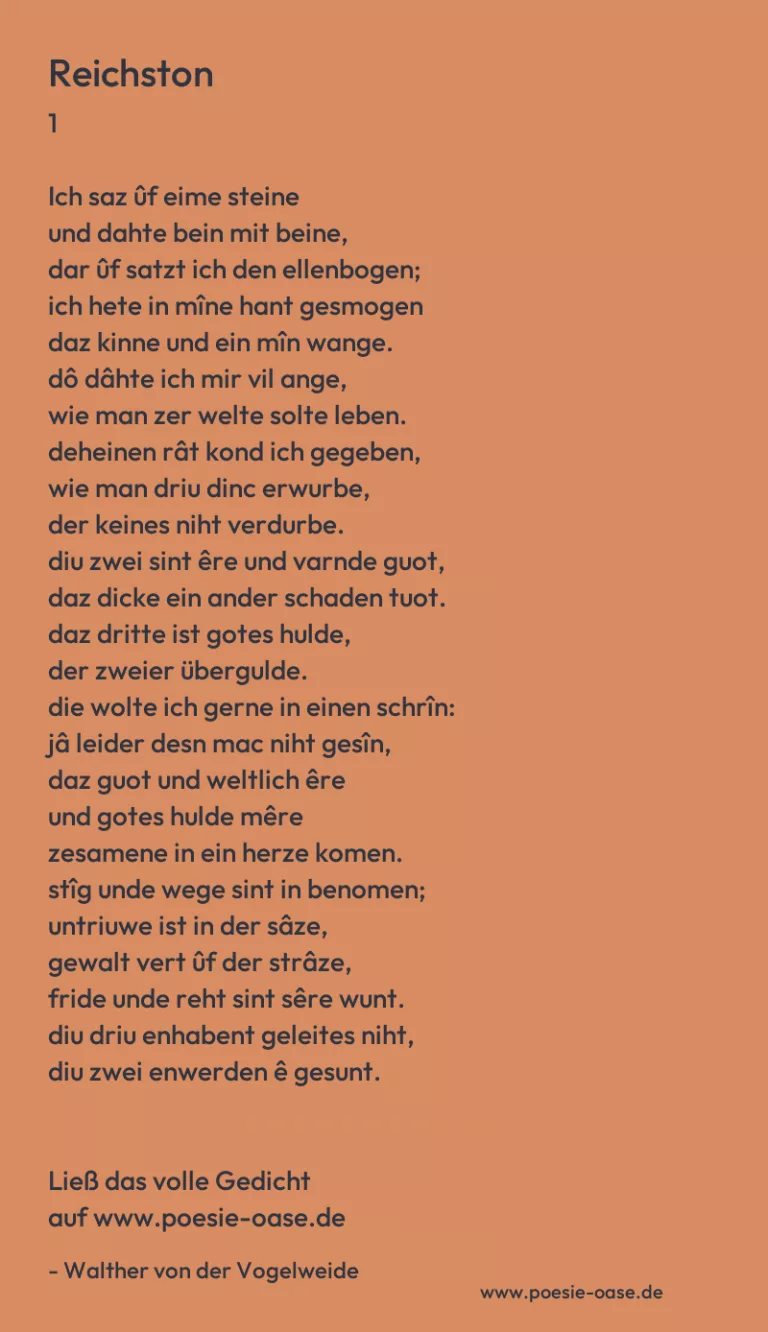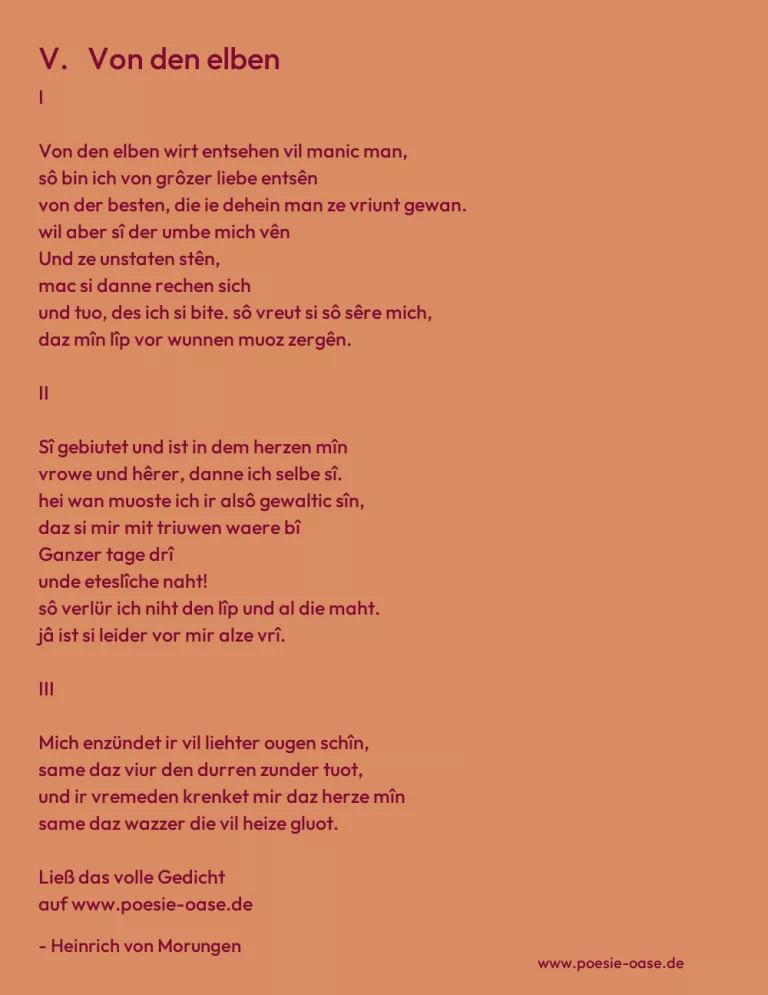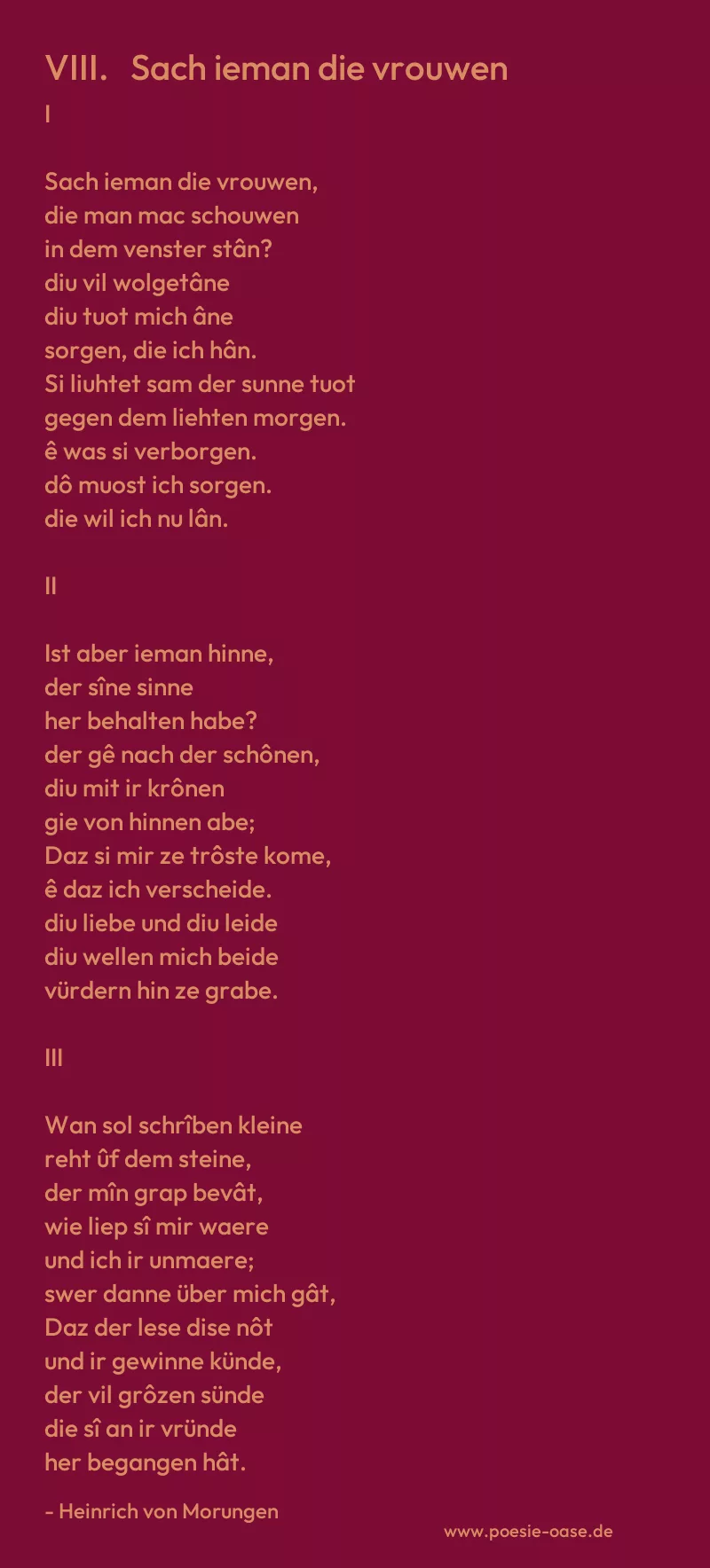VIII. Sach ieman die vrouwen
I
Sach ieman die vrouwen,
die man mac schouwen
in dem venster stân?
diu vil wolgetâne
diu tuot mich âne
sorgen, die ich hân.
Si liuhtet sam der sunne tuot
gegen dem liehten morgen.
ê was si verborgen.
dô muost ich sorgen.
die wil ich nu lân.
II
Ist aber ieman hinne,
der sîne sinne
her behalten habe?
der gê nach der schônen,
diu mit ir krônen
gie von hinnen abe;
Daz si mir ze trôste kome,
ê daz ich verscheide.
diu liebe und diu leide
diu wellen mich beide
vürdern hin ze grabe.
III
Wan sol schrîben kleine
reht ûf dem steine,
der mîn grap bevât,
wie liep sî mir waere
und ich ir unmaere;
swer danne über mich gât,
Daz der lese dise nôt
und ir gewinne künde,
der vil grôzen sünde
die sî an ir vründe
her begangen hât.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
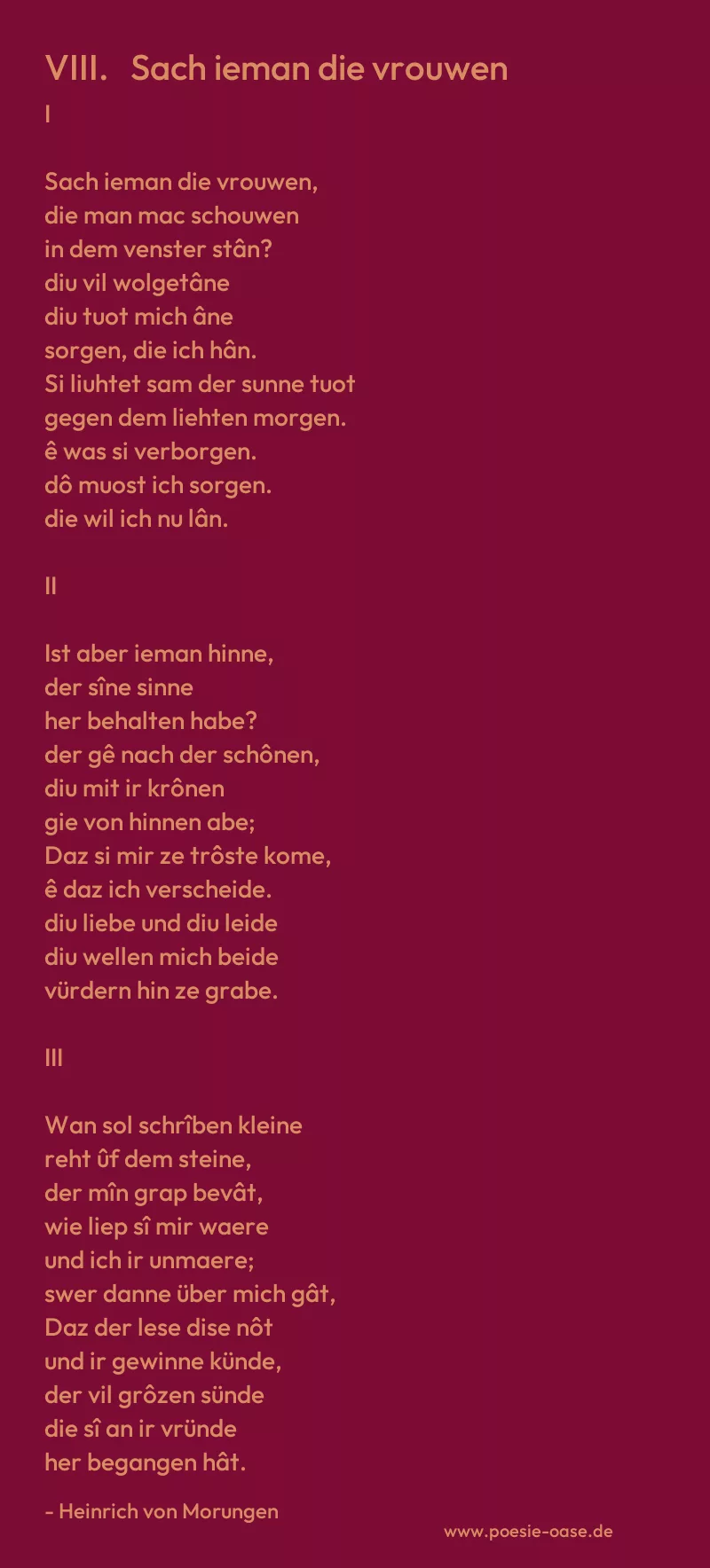
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sach ieman die vrouwen“ von Heinrich von Morungen ist ein leidenschaftlicher Klagegesang eines Minnesängers, der seine Liebe zu einer Frau in schmerzhafter Unerfülltheit erlebt. In drei Strophen entfaltet sich ein dramatisches Bild von Liebe, Sehnsucht, Krankheit und dem nahen Tod – eine Liebeserfahrung, die den Sprecher an den Rand seiner Existenz bringt. Der Text verbindet dabei das typische Motiv der „Hohen Minne“ mit einer fast persönlichen, todesnahen Intimität.
Die erste Strophe beginnt mit einer alltäglichen Szene: Der Blick auf eine Frau, die im Fenster steht, wird zur Offenbarung. Sie ist „vil wolgetâne“, also vollkommen in Haltung und Ausstrahlung, und bringt Licht und Hoffnung – wie die Sonne am Morgen. Diese Lichtmetapher verleiht ihr eine fast göttliche Aura. Doch diese Erscheinung ist nicht nur Trost, sondern Auslöser tiefer Unruhe: Vorher war sie verborgen – da quälte den Sprecher Sehnsucht. Jetzt, da sie sichtbar ist, steigert sich das Empfinden zu solcher Intensität, dass er beschließt, die Sorgen „nu lân“ – also loszulassen.
Die zweite Strophe vertieft die existenzielle Dimension der Minne. Der Sprecher fragt, ob es jemanden gibt, der noch bei Verstand bleibt angesichts solcher Schönheit. Die Frau wird als Krönung („mit ir krônen“) dargestellt, als etwas Erhabenes, das ihn trösten soll, ehe er stirbt. Liebe und Leid werden zu Kräften, die ihn „hin ze grabe“ führen – die Liebe wird nicht zum Heil, sondern zur Ursache seines körperlichen und seelischen Verfalls. Die poetische Verbindung von Liebe und Tod ist ein zentrales Motiv der mittelhochdeutschen Lyrik, hier aber mit auffallender Direktheit ausgesprochen.
Die letzte Strophe spielt mit der Vorstellung des eigenen Grabsteins. Dort, so der Sprecher, soll festgehalten werden, wie sehr er die Geliebte liebte – und dass sie ihn nie erwiderte. Seine „nôt“ (Not, Leid) soll für alle sichtbar sein. Wer auch immer an seinem Grab vorbeigeht, möge seine Klage lesen und erkennen, dass hier eine große „sünde“ (Verfehlung) der Frau vorliegt – nämlich ihr Mangel an Erwiderung. Damit wird das Leiden an der Minne zum bleibenden Zeugnis, zum literarischen und emotionalen Vermächtnis.
„Sach ieman die vrouwen“ ist ein extremes Beispiel für die leidenschaftliche Überhöhung und zugleich das Leiden an einer idealisierten Liebe. Heinrich von Morungen verdichtet hier auf dramatische Weise das innere Ringen des Liebenden, dessen Seelenzustand zwischen Offenbarung, Wahnsinn und Todessehnsucht schwankt. Die Sprache ist bildstark, intensiv und zeugt von einer tiefen, fast schon mystischen Ergriffenheit – ein Höhepunkt höfischer Liebesdichtung in ihrer düstersten Form.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.