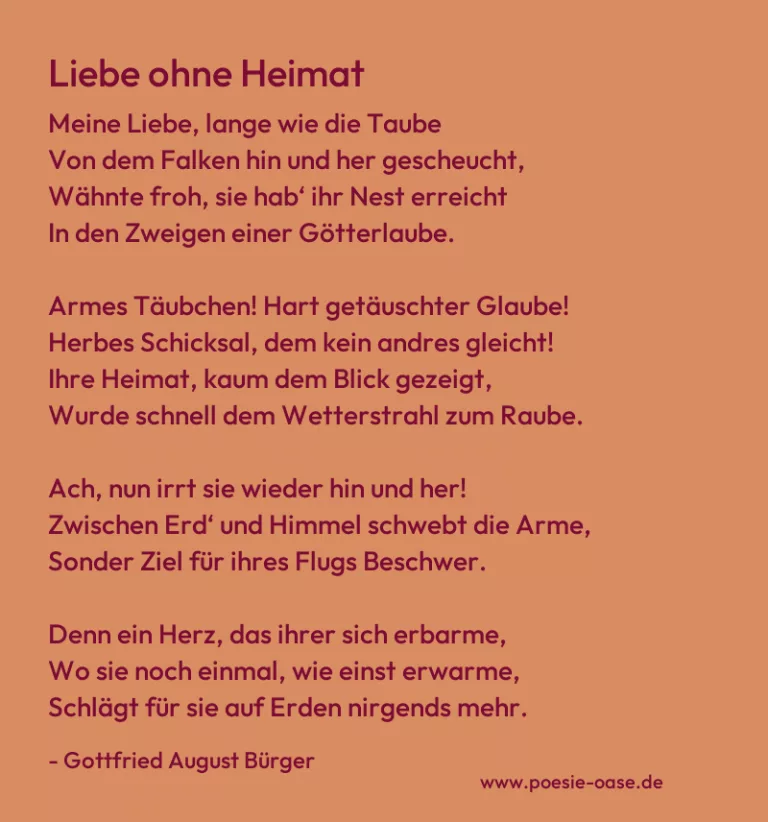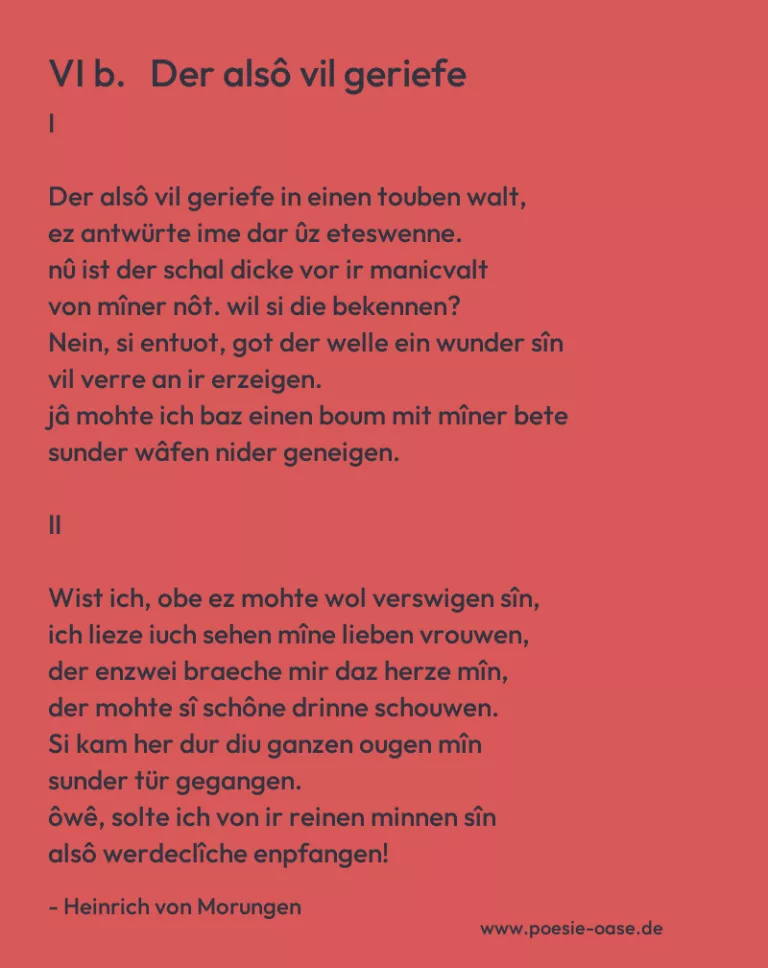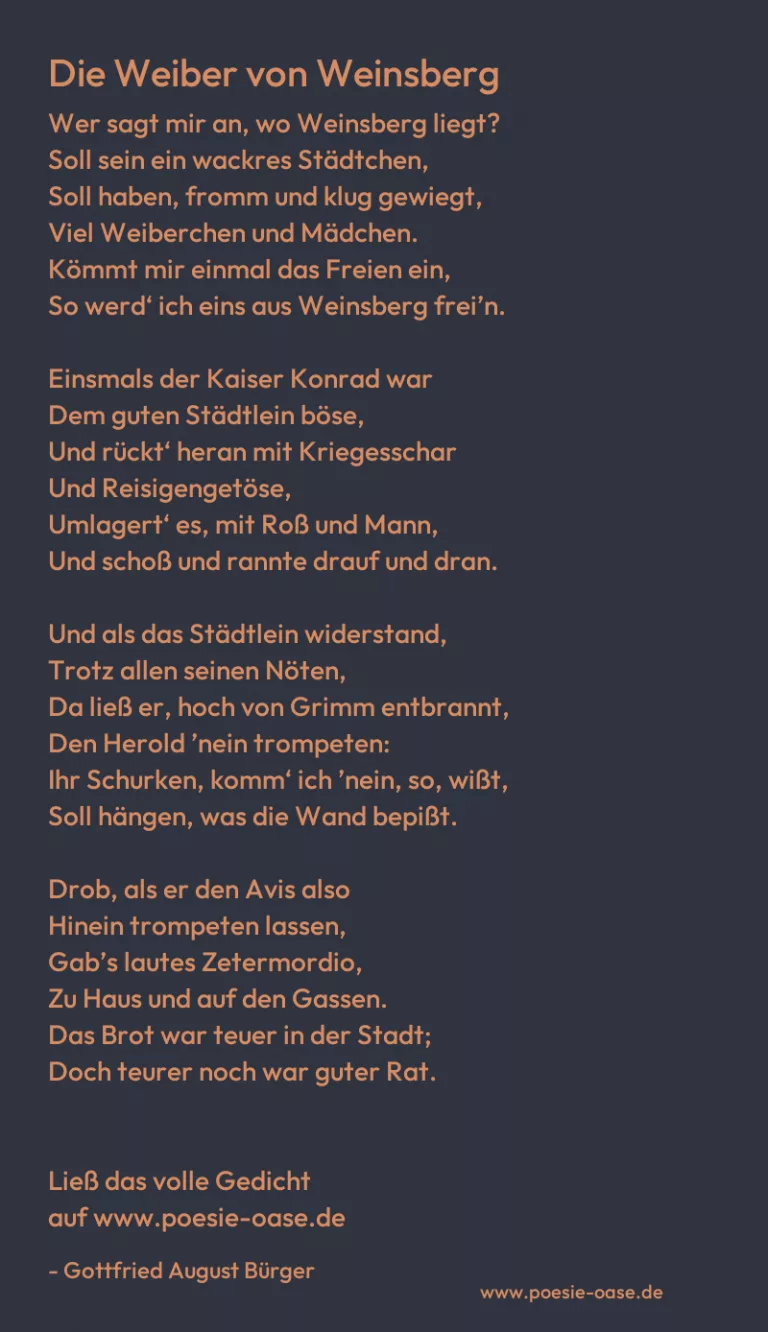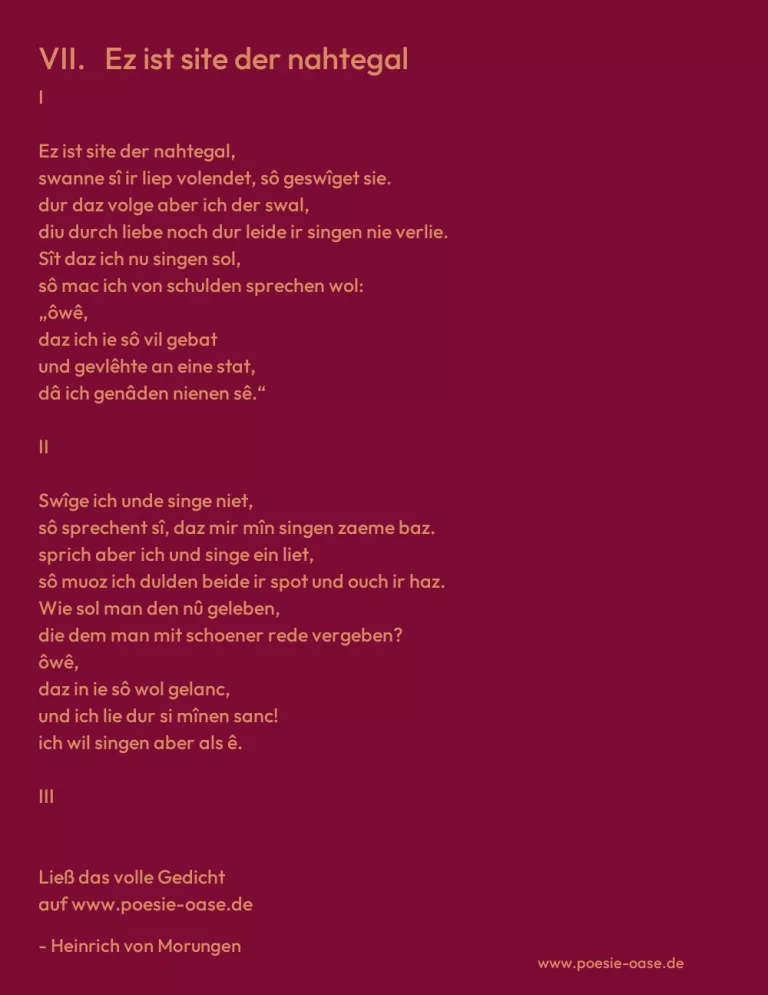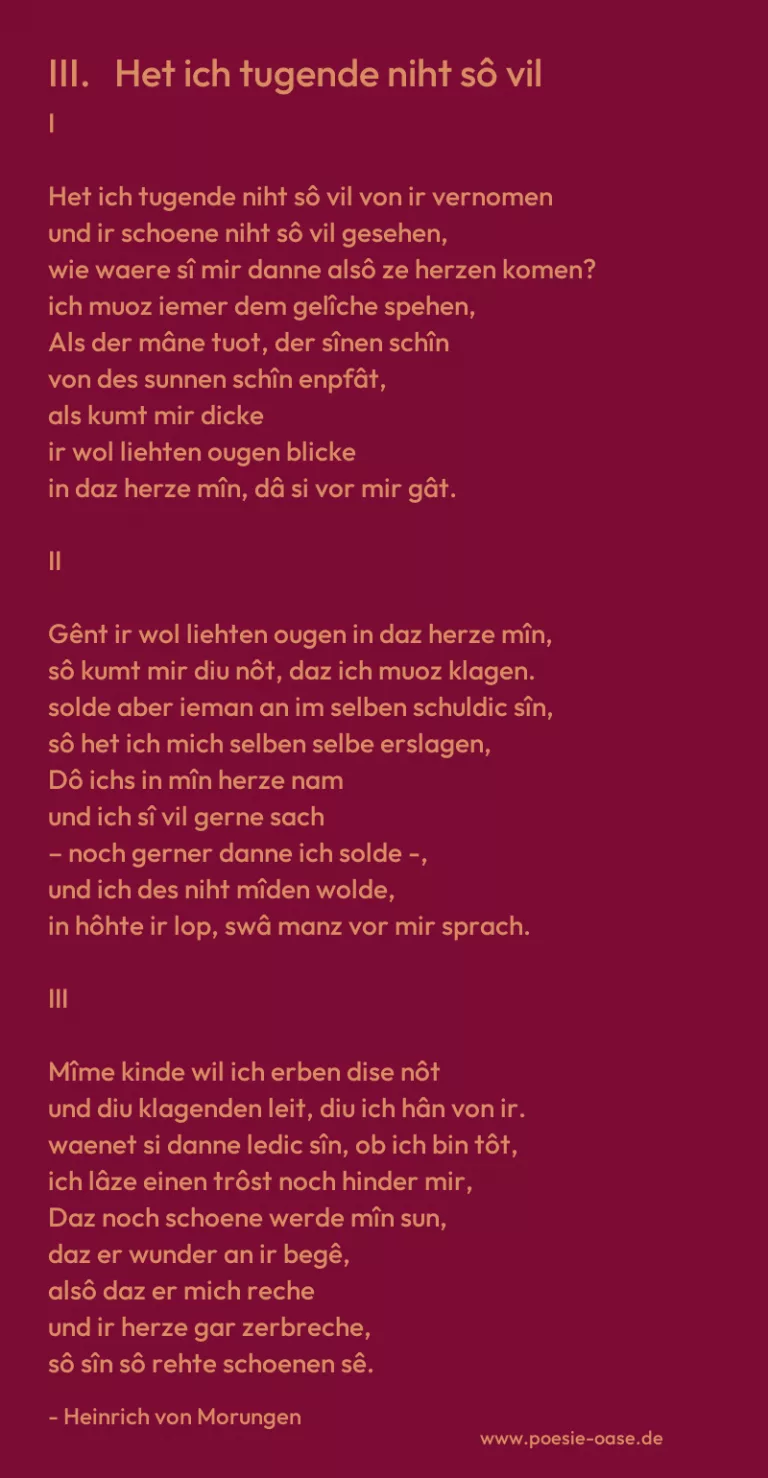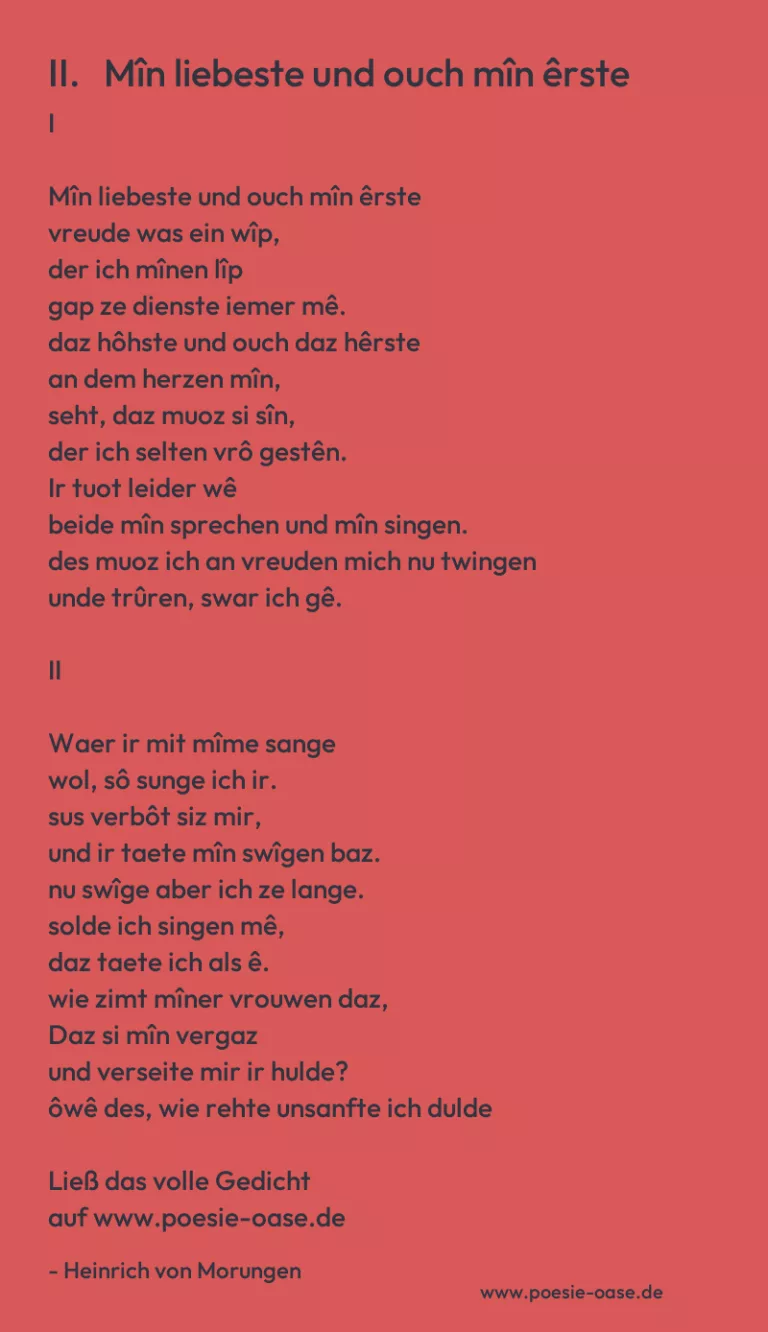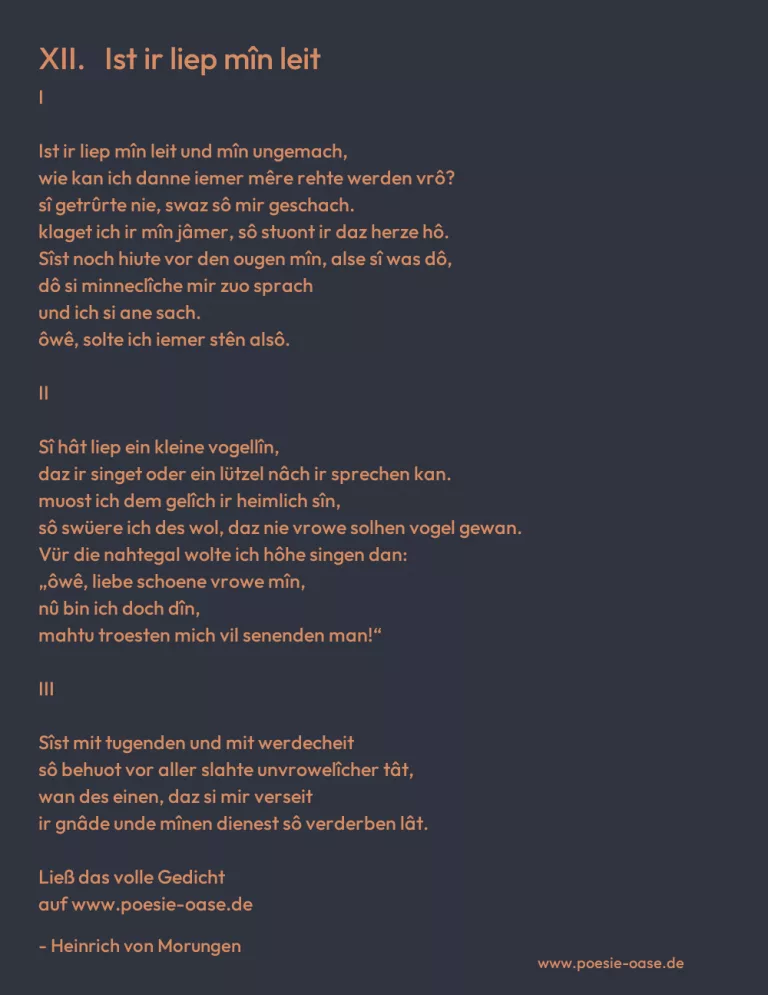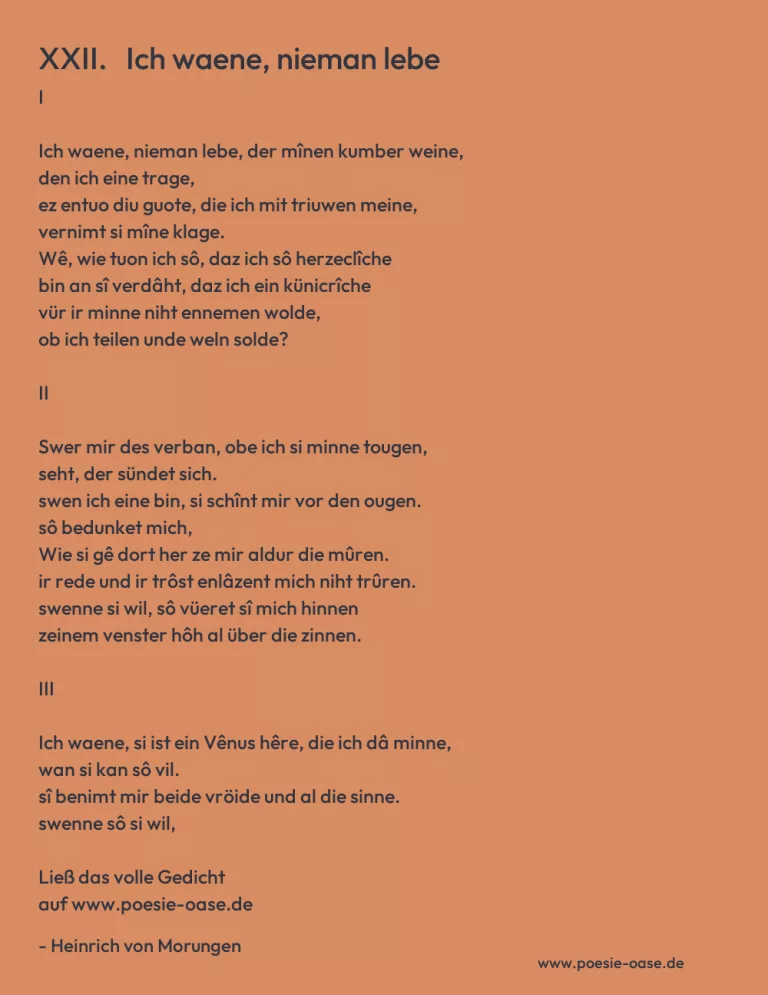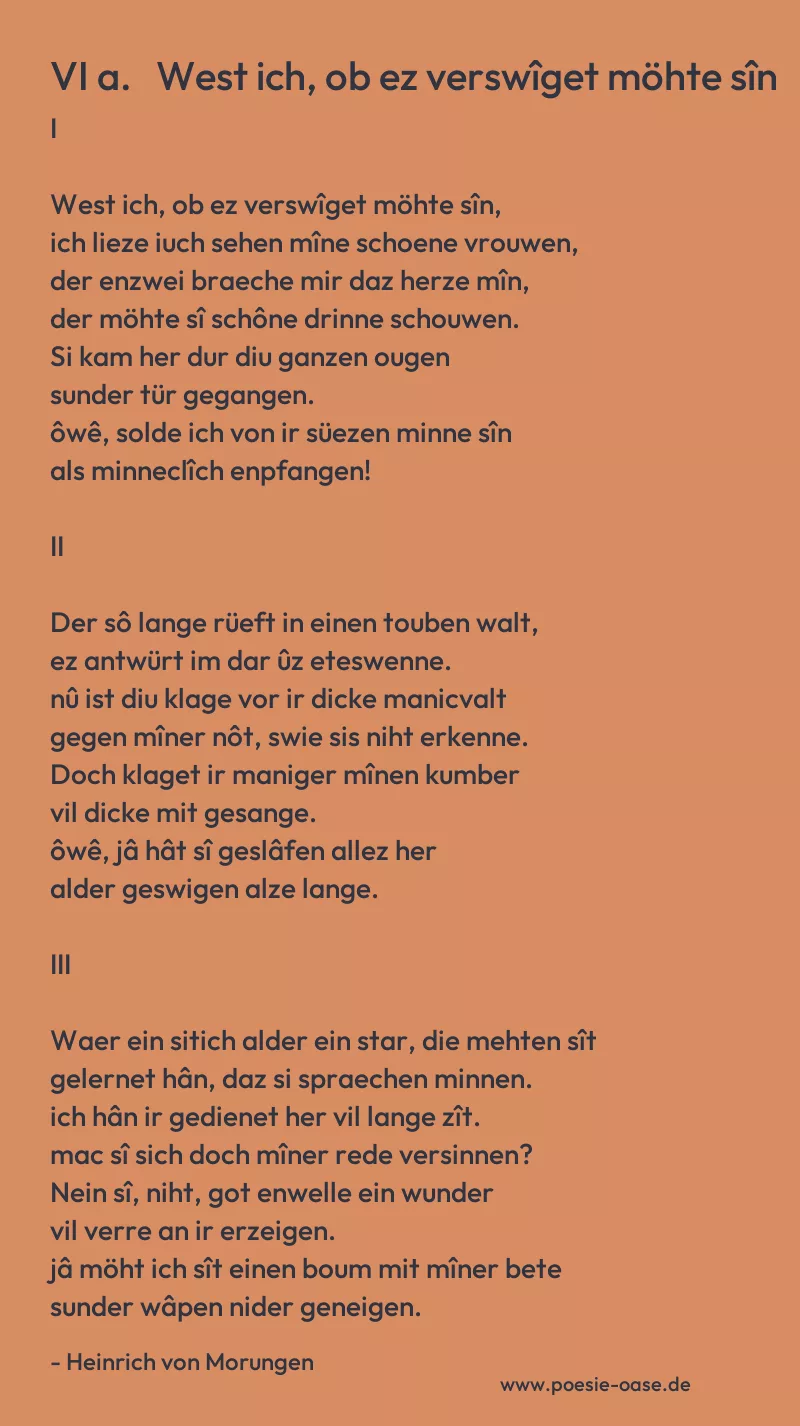VI a. West ich, ob ez verswîget möhte sîn
I
West ich, ob ez verswîget möhte sîn,
ich lieze iuch sehen mîne schoene vrouwen,
der enzwei braeche mir daz herze mîn,
der möhte sî schône drinne schouwen.
Si kam her dur diu ganzen ougen
sunder tür gegangen.
ôwê, solde ich von ir süezen minne sîn
als minneclîch enpfangen!
II
Der sô lange rüeft in einen touben walt,
ez antwürt im dar ûz eteswenne.
nû ist diu klage vor ir dicke manicvalt
gegen mîner nôt, swie sis niht erkenne.
Doch klaget ir maniger mînen kumber
vil dicke mit gesange.
ôwê, jâ hât sî geslâfen allez her
alder geswigen alze lange.
III
Waer ein sitich alder ein star, die mehten sît
gelernet hân, daz si spraechen minnen.
ich hân ir gedienet her vil lange zît.
mac sî sich doch mîner rede versinnen?
Nein sî, niht, got enwelle ein wunder
vil verre an ir erzeigen.
jâ möht ich sît einen boum mit mîner bete
sunder wâpen nider geneigen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
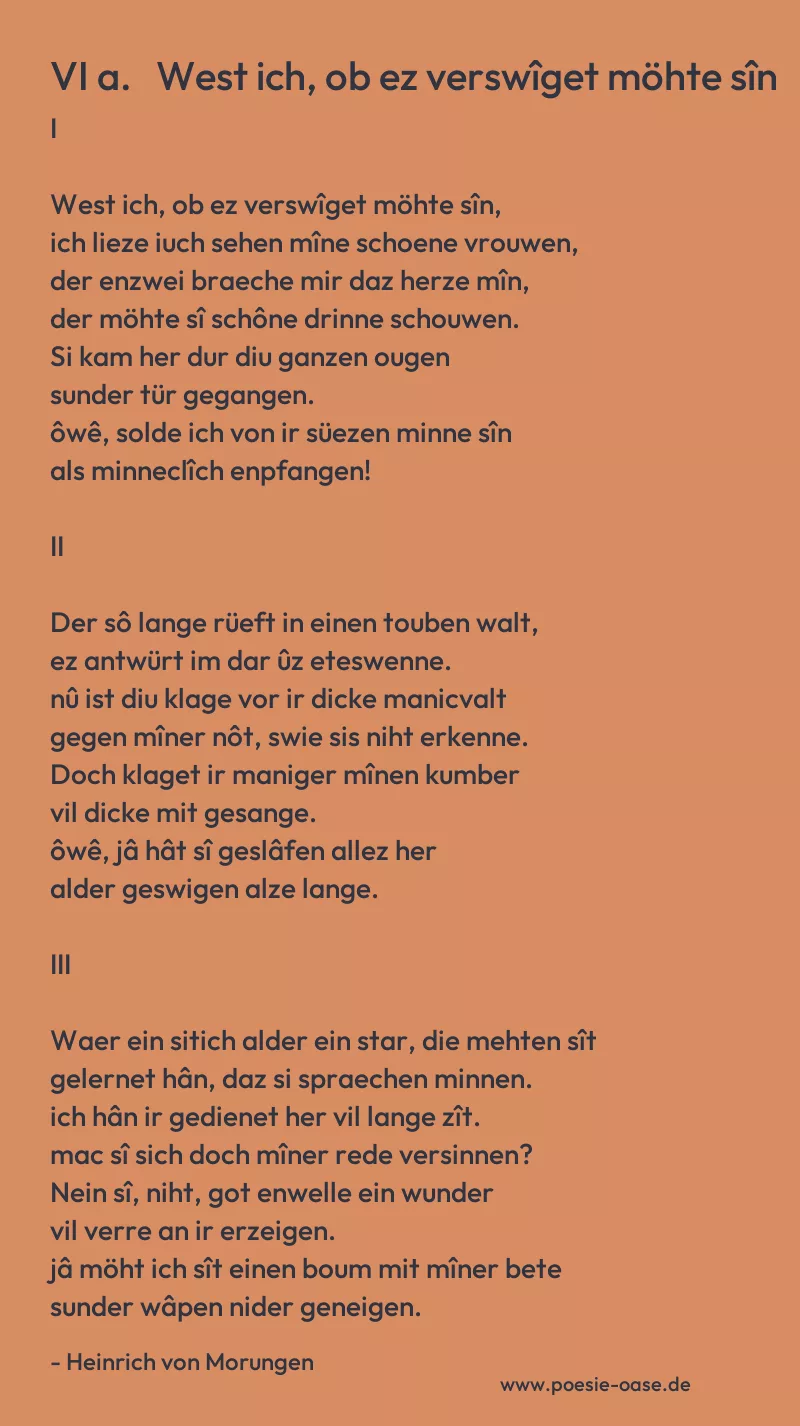
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „West ich, ob ez verswîget möhte sîn“ von Heinrich von Morungen gehört zur mittelhochdeutschen Minnelyrik und beschreibt auf eindringliche Weise die Not des unerwidert Liebenden. In drei Strophen wird das innere Leiden des lyrischen Ichs dargestellt, das seine Liebe zu einer Frau nicht offenbaren kann – oder darf – und das dennoch nach Ausdruck und Erhörung sucht. Dabei zeigt sich eine typische Konstellation der Hohen Minne: Das Liebesverhältnis ist einseitig, idealisiert und bleibt in der Schwebe zwischen heimlicher Verehrung und verzweifelter Hoffnung.
Gleich die erste Strophe umkreist das zentrale Motiv des Verschweigens. Der Sprecher möchte der Frau seine Liebe zeigen, kann es aber nicht – aus Angst vor Ablehnung oder aus Rücksicht auf die gesellschaftlichen Konventionen. Die Vorstellung, dass sie durch seine Augen „sunder tür“ (ohne Tür, also direkt) in sein Herz eintritt, bringt die radikale Offenheit und Verletzlichkeit seiner Empfindung zum Ausdruck. Der Ausruf „ôwê“ betont das Leiden an einer Liebe, die zwar süß ist, aber keine Erwiderung findet.
In der zweiten Strophe vergleicht der Sprecher seine Situation mit dem Ruf in einen „tauben Wald“ – ein klassisches Bild für das Ausbleiben von Antwort. Seine Klage ist vielfältig und wiederholt sich in Liedern anderer, wird also vielleicht sogar weitergetragen, ohne dass die Geliebte davon berührt scheint. Die Möglichkeit, dass sie seine Not „nicht erkenne“, bringt die Ungewissheit und die Kluft zwischen innerem Erleben und äußerer Wirklichkeit auf den Punkt. Ihr Schweigen wird als unerträglich empfunden, es ist zu lang, zu vollkommen – fast schon grausam.
Die dritte Strophe greift das beliebte Motiv der sprechenden Vögel („ein sitich alder ein star“) auf, das bereits in anderen Gedichten Morungens vorkommt. Wenn Tiere von der Liebe sprechen könnten, so der Gedanke, wären sie geeigneter als der Liebende selbst, dessen Dienst lange währt, aber ungehört bleibt. Die Hoffnung auf ein göttliches Wunder, das die Geliebte zur Erkenntnis bringt, wird ironisch gebrochen: Die Aussicht, mit bloßem Flehen einen Baum zu beugen, scheint realistischer als ihr Herz zu bewegen. Diese Schlusswendung verbindet Verzweiflung mit bitterem Witz – ein typisches Stilmittel in der späten Minnelyrik.
„West ich, ob ez verswîget möhte sîn“ ist somit ein tief melancholisches Gedicht über das Spannungsverhältnis zwischen innerer Leidenschaft und äußerem Schweigen. Morungen gelingt es, das Leiden am Ungesagten und Ungesehenen in eindrückliche Bilder zu fassen und zugleich die vergebliche Hoffnung in eine beinahe magische Bildsprache zu kleiden. Das Gedicht zeigt exemplarisch, wie die Hohe Minne nicht auf Erfüllung zielt, sondern auf das kultivierte Ertragen der Unerfüllbarkeit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.