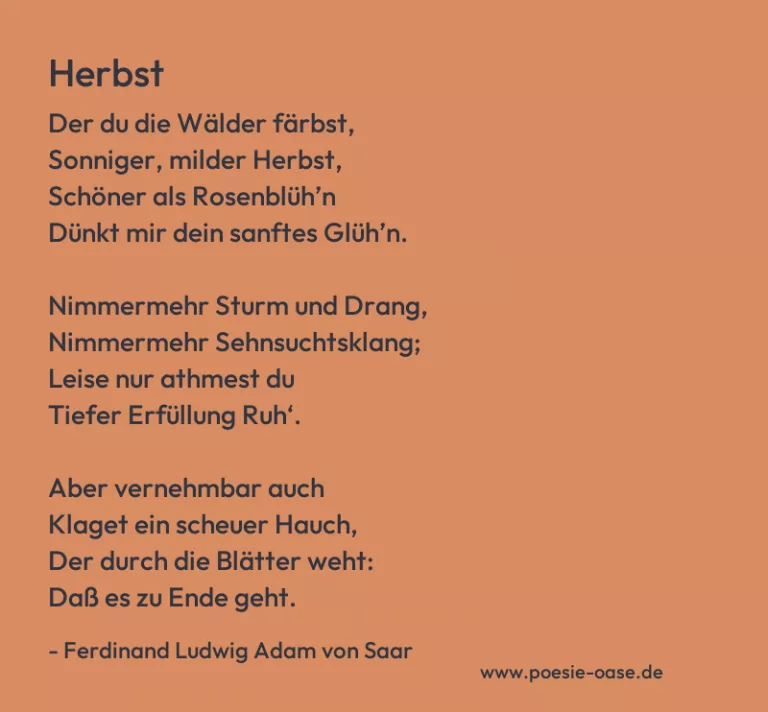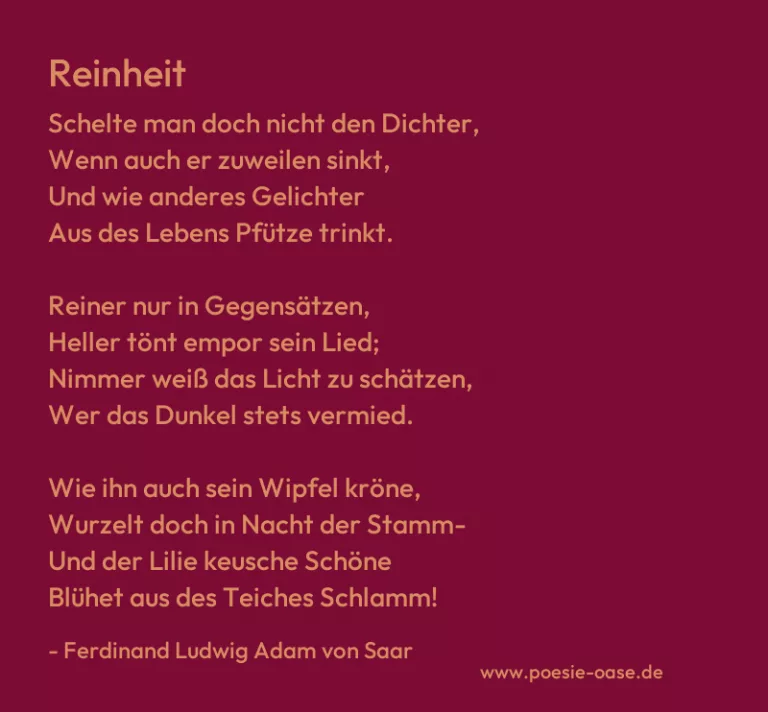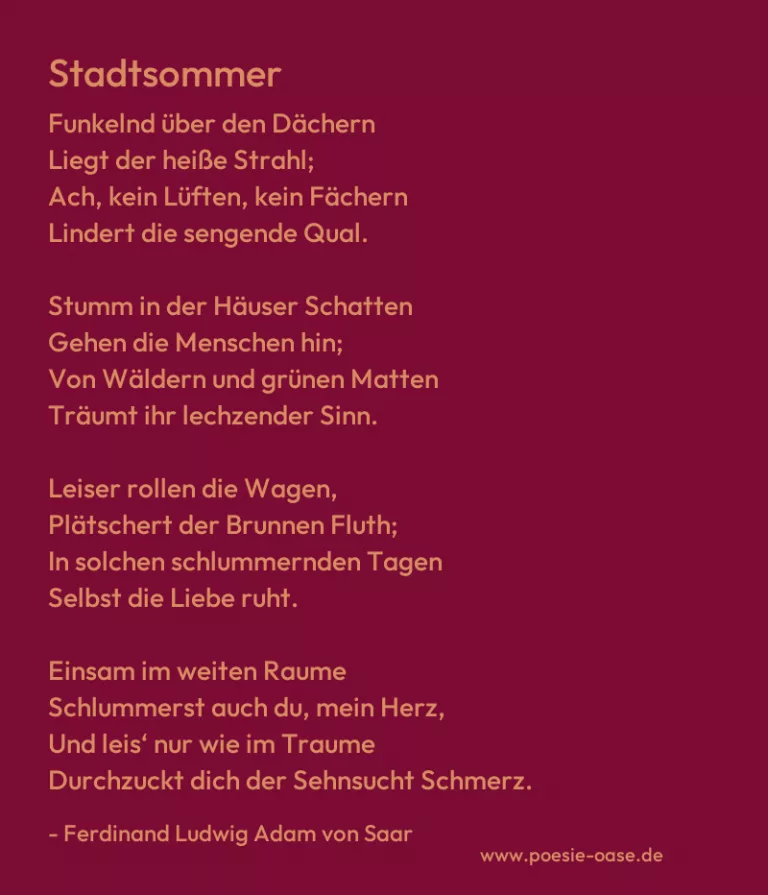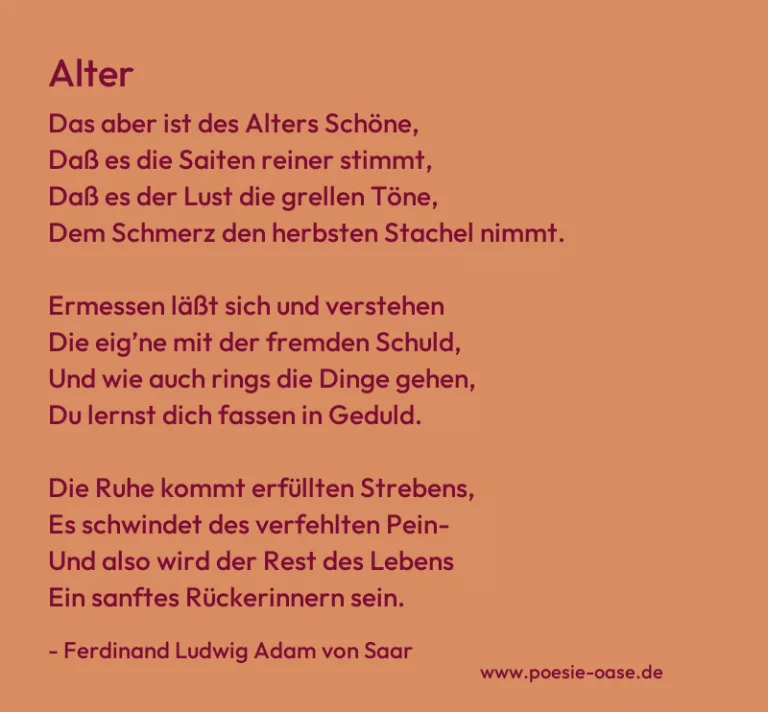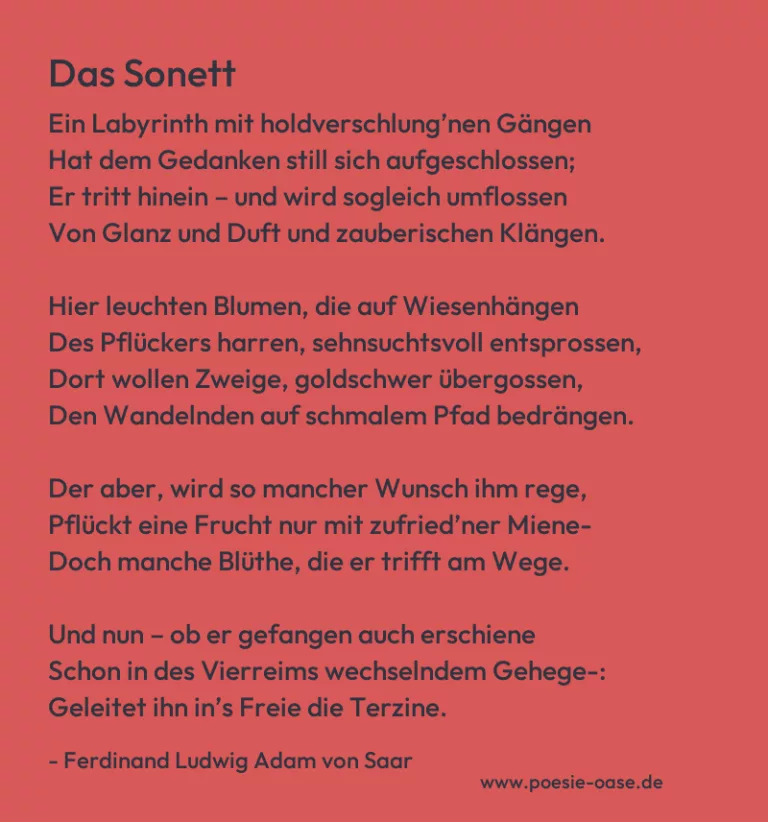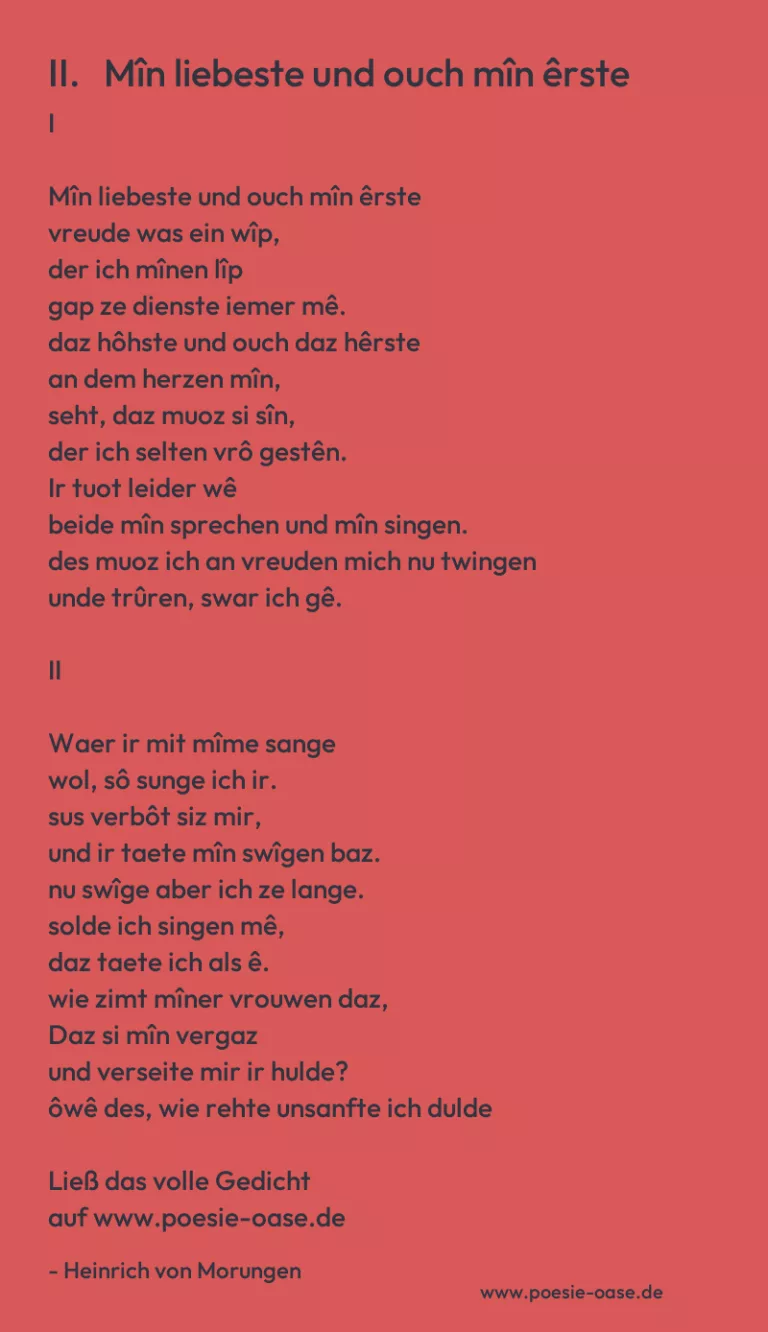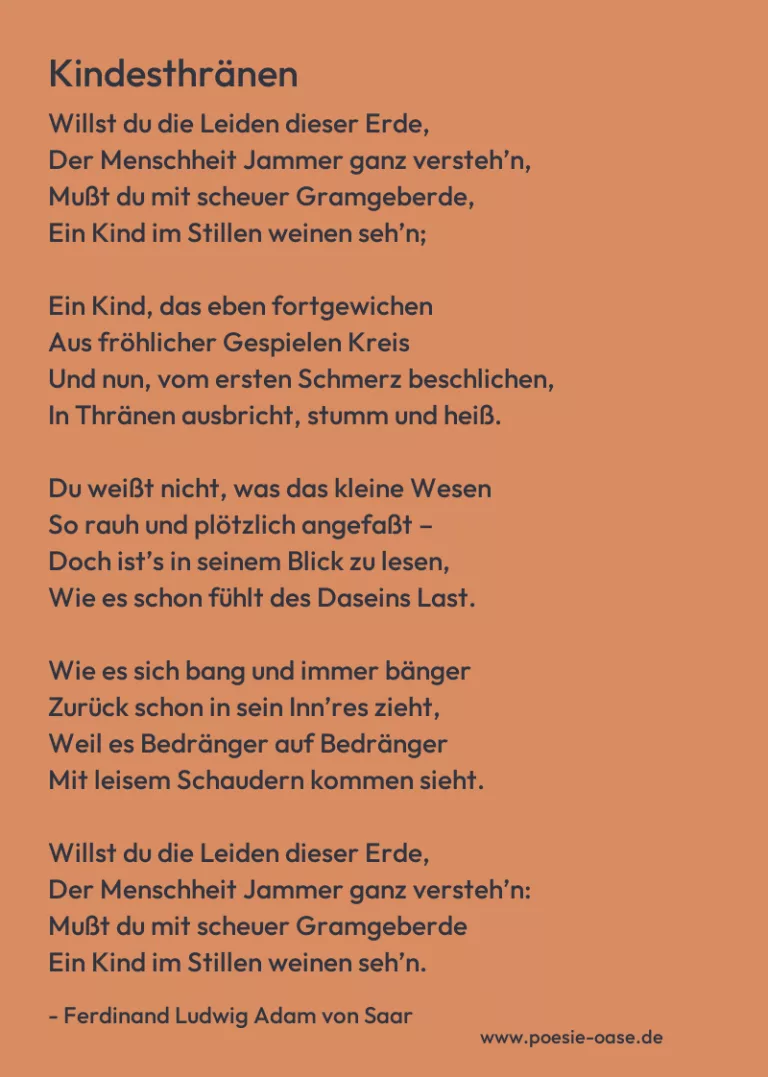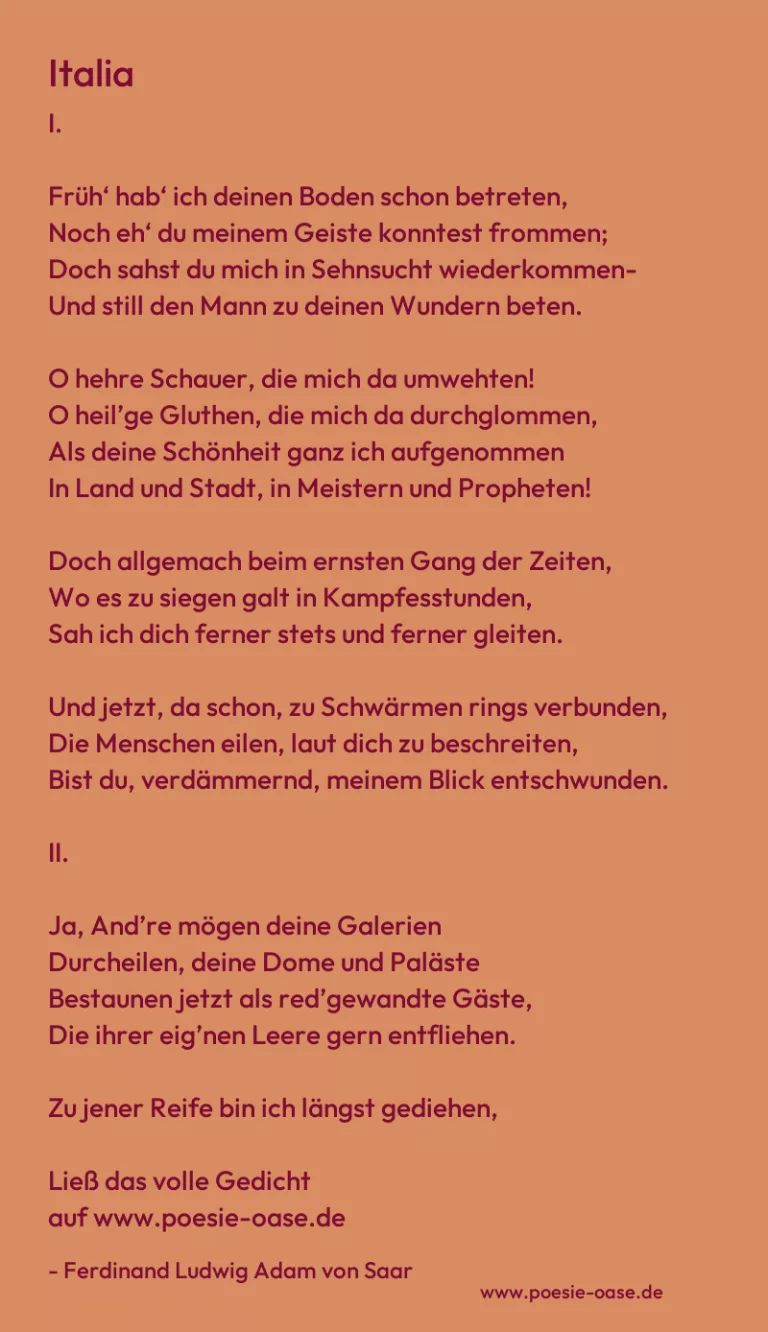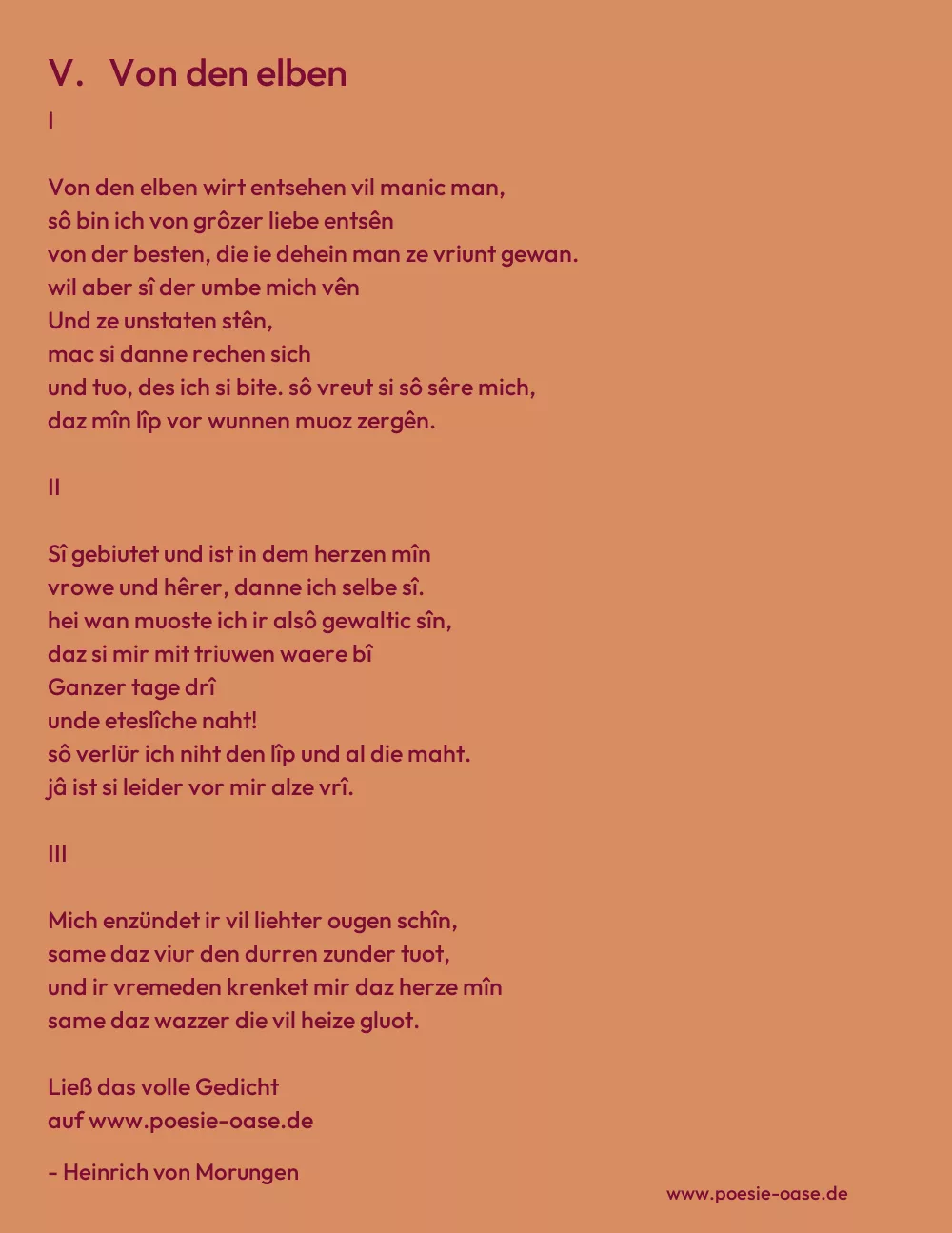V. Von den elben
I
Von den elben wirt entsehen vil manic man,
sô bin ich von grôzer liebe entsên
von der besten, die ie dehein man ze vriunt gewan.
wil aber sî der umbe mich vên
Und ze unstaten stên,
mac si danne rechen sich
und tuo, des ich si bite. sô vreut si sô sêre mich,
daz mîn lîp vor wunnen muoz zergên.
II
Sî gebiutet und ist in dem herzen mîn
vrowe und hêrer, danne ich selbe sî.
hei wan muoste ich ir alsô gewaltic sîn,
daz si mir mit triuwen waere bî
Ganzer tage drî
unde eteslîche naht!
sô verlür ich niht den lîp und al die maht.
jâ ist si leider vor mir alze vrî.
III
Mich enzündet ir vil liehter ougen schîn,
same daz viur den durren zunder tuot,
und ir vremeden krenket mir daz herze mîn
same daz wazzer die vil heize gluot.
Und ir hôher muot
und ir schoene und ir werdecheit
und daz wunder, daz man von ir tugenden seit,
daz wirt mir vil übel – oder lîhte guot?
IV
Swenne ir liehten ougen sô verkêrent sich,
daz si mir aldur mîn herze sên,
swer dâ enzwischen danne gêt und irret mich,
dem muoze al sîn wunne gar zergên!
Ich muoz vor ir stên
unde warten der vröiden mîn
rehte alsô des tages diu kleinen vogellîn.
wenne sol mir iemer liep geschên?
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
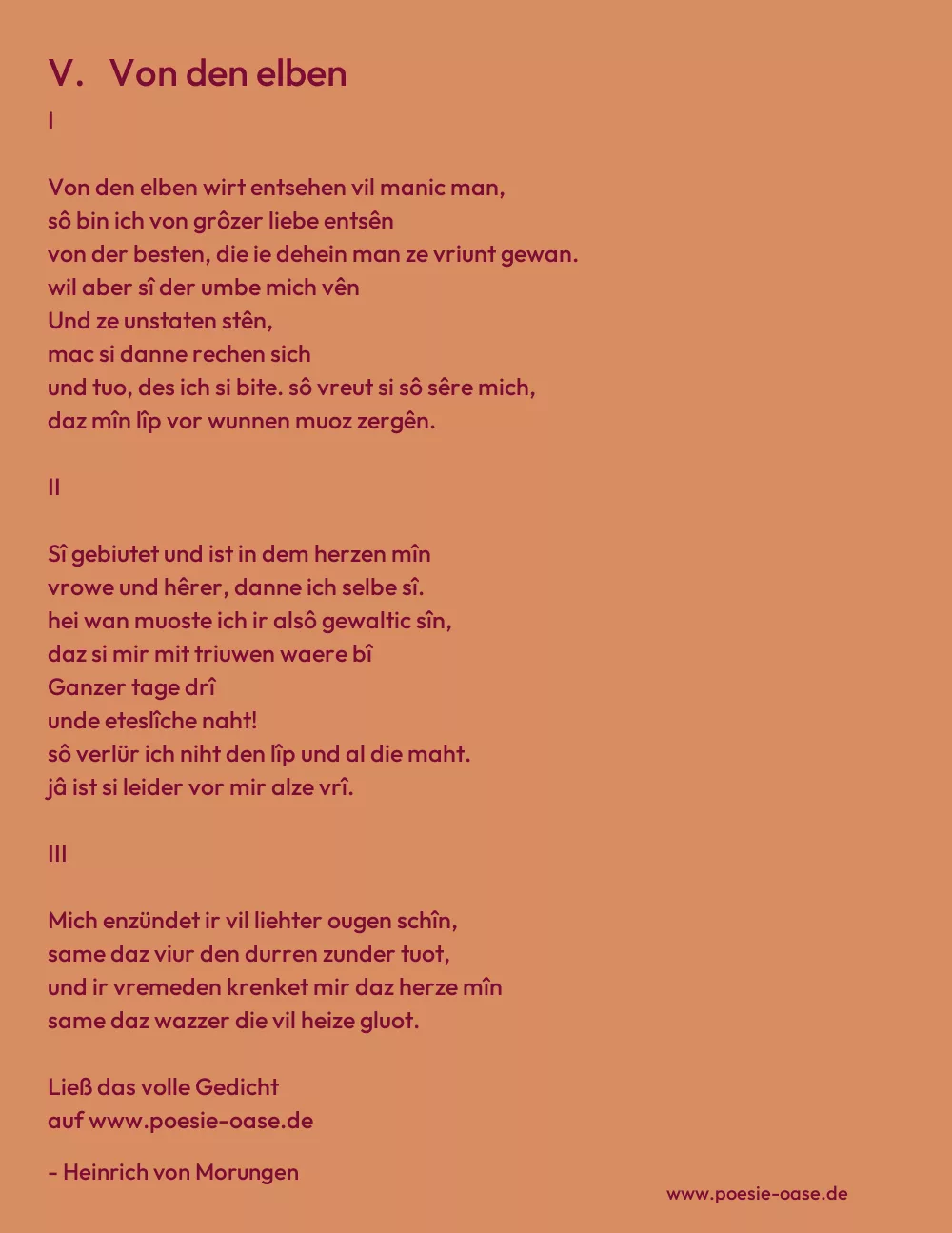
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Von den elben“ von Heinrich von Morungen verbindet das Motiv überirdischer Verführung mit der Erfahrung leidenschaftlicher, aber schmerzhafter Minne. Der Vergleich mit den „elben“, also den Elben oder Elfen, weist auf eine mythische Dimension der Liebe hin: Sie ist verführerisch, schön und machtvoll – aber auch gefährlich und ungreifbar.
In der ersten Strophe beschreibt das lyrische Ich seine Liebe als eine Art „Verzauberung“, wie sie Elben bewirken können. Die Geliebte hat ihn durch ihre Schönheit und ihr Wesen „entzündet“, zugleich aber auch ferngehalten. Diese Ambivalenz – Lust und Leid, Nähe und Unerreichbarkeit – ist ein zentrales Motiv der höfischen Liebesdichtung. Die Wirkung der Geliebten ist so stark, dass der Sprecher vor Wonne fast vergeht.
Die zweite Strophe steigert die Verehrung: Die Frau ist ihm „vrowe und hêrer“, also Herrin und höhergestellt als er selbst. Der Wunsch nach wechselseitiger Treue bleibt dabei nur ein Ideal, denn tatsächlich ist sie ihm „alze vrî“, völlig frei und unabhängig. Hier zeigt sich die klassische Konstellation der Minne: Der Dienende liebt in Demut, während die Angebetete souverän bleibt. Die Vorstellung, sie auch nur für „drî tage“ bei sich zu wissen, bleibt unerfüllt.
In der dritten Strophe nutzt Heinrich von Morungen starke Naturvergleiche, um das Wechselspiel von Begehren und Schmerz zu beschreiben: Der Blick der Geliebten entzündet ihn wie Feuer auf trockenem Zunder, ihr fernes Wesen aber kühlt und verletzt ihn wie kaltes Wasser eine glühende Flamme. Diese widersprüchlichen Empfindungen sind Ausdruck einer tiefen inneren Zerrissenheit – zwischen Verlangen und Enttäuschung, Hoffnung und Resignation.
Die letzte Strophe kulminiert in der Darstellung absoluter Abhängigkeit: Sobald sich der Blick der Geliebten abwendet, ist jede Freude dahin. Das lyrische Ich fühlt sich wie ein kleiner Vogel am Morgen, der auf den Tag wartet – ein schönes, aber auch zartes Bild für die Sehnsucht nach Zuwendung. Am Ende bleibt die Frage offen, ob je etwas „liebes“, also Gutes, geschehen kann. So kreist das Gedicht um die Unerreichbarkeit idealer Liebe, die durch ihre Schönheit betört, aber nie ganz greifbar wird – fast wie ein Wesen aus einer anderen Welt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.