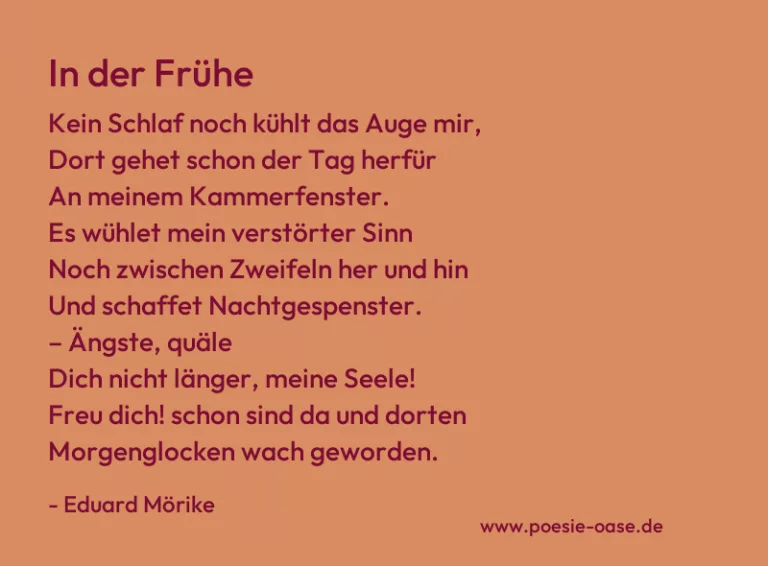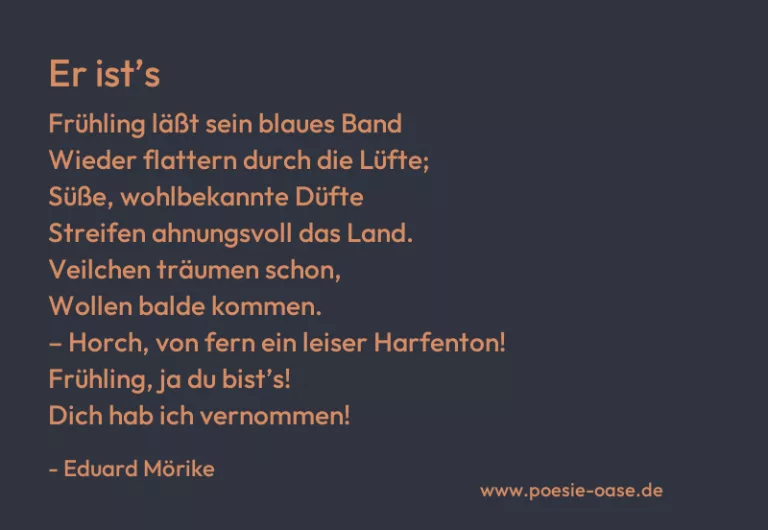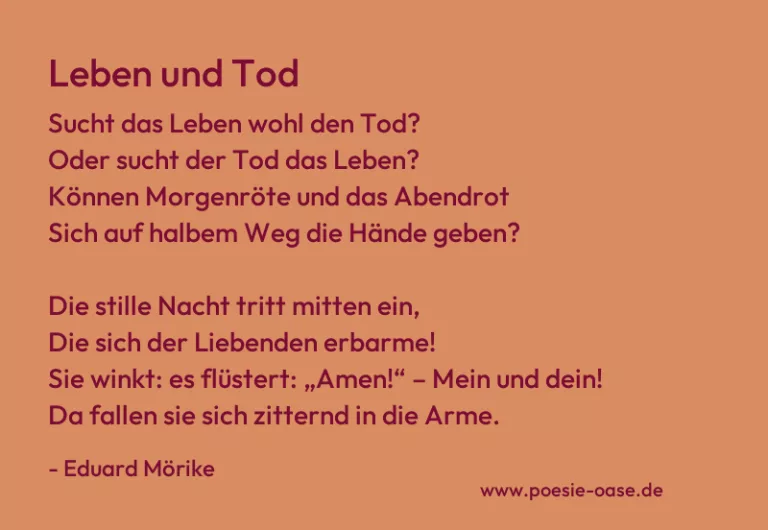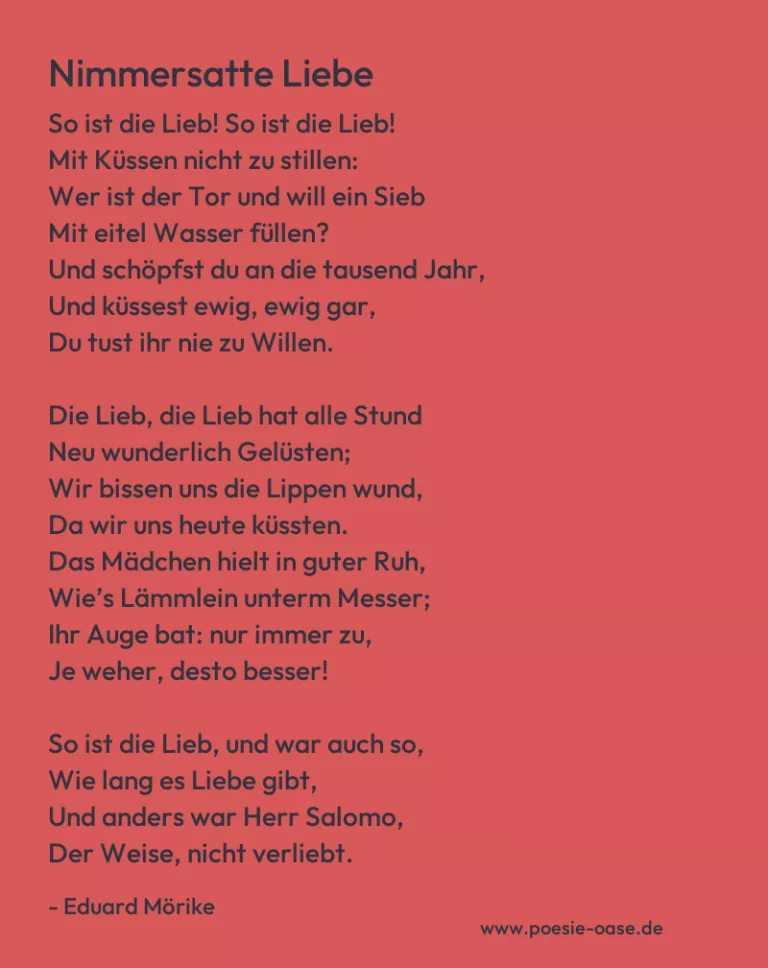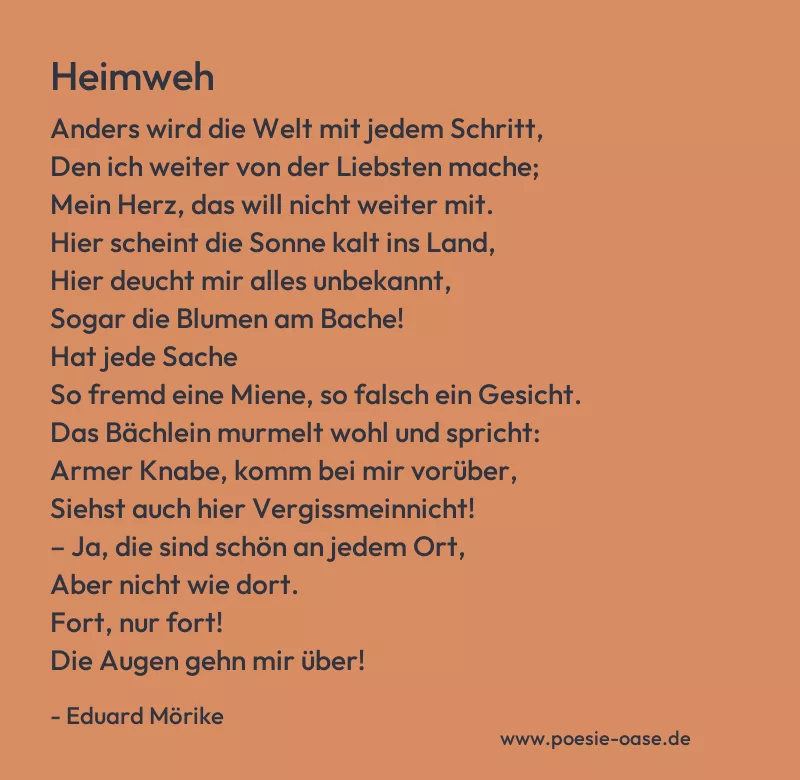Heimweh
Anders wird die Welt mit jedem Schritt,
Den ich weiter von der Liebsten mache;
Mein Herz, das will nicht weiter mit.
Hier scheint die Sonne kalt ins Land,
Hier deucht mir alles unbekannt,
Sogar die Blumen am Bache!
Hat jede Sache
So fremd eine Miene, so falsch ein Gesicht.
Das Bächlein murmelt wohl und spricht:
Armer Knabe, komm bei mir vorüber,
Siehst auch hier Vergissmeinnicht!
– Ja, die sind schön an jedem Ort,
Aber nicht wie dort.
Fort, nur fort!
Die Augen gehn mir über!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
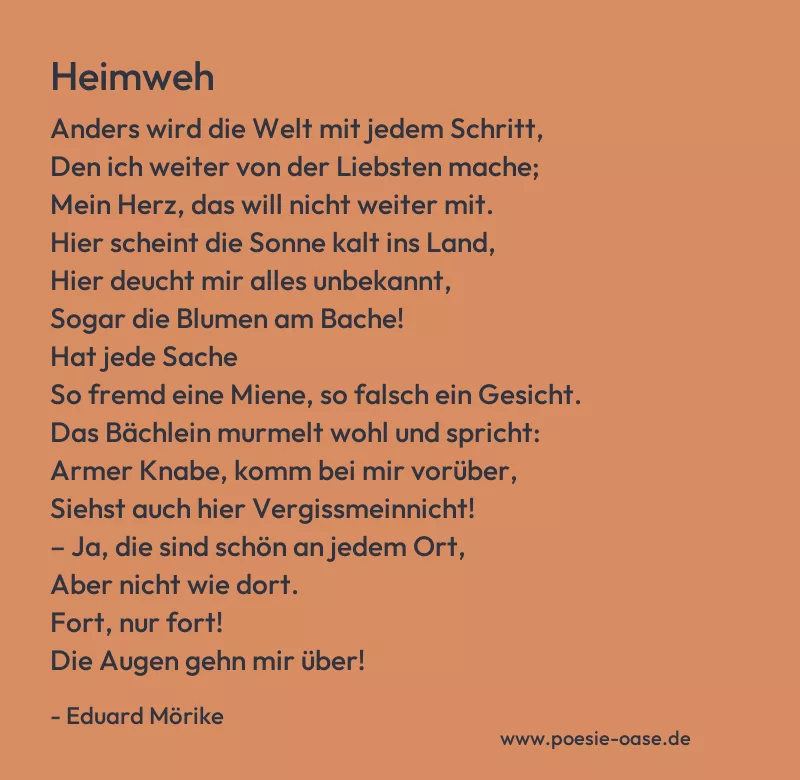
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Heimweh“ von Eduard Mörike vermittelt auf eindrucksvolle Weise die emotionale Zerrissenheit des lyrischen Ichs, das sich von seiner „Liebsten“ entfernt. Mit jedem Schritt von ihr entfernt sich die Welt für den Erzähler, und er spürt, dass er in einer fremden, nicht mehr vertrauten Umgebung lebt. Die anfängliche Klarheit und Wärme, die er mit seiner Heimat und der Nähe zu seiner Geliebten verbindet, werden zunehmend durch Kälte und Fremdheit ersetzt. Diese Entfremdung wird durch die Beschreibung der Natur verstärkt: „Hier scheint die Sonne kalt ins Land“, und „alles scheint unbekannt“, selbst die Blumen am Bache, die er früher vielleicht mit anderen Augen gesehen hätte.
Das lyrische Ich empfindet die Welt als fremd und entäuscht. Sogar das Bächlein, das ihm vertraut und tröstlich erscheinen sollte, spricht mit einem Ton von Bedauern, als wollte es sagen: „Armer Knabe, komm bei mir vorüber.“ Doch der Erzähler weist diesen Trost zurück, da die Blumen – obwohl sie ebenso „Vergissmeinnicht“ sind – nicht dieselbe Bedeutung haben wie die an dem Ort, den er verlassen hat. Der Vergleich der Blumen an verschiedenen Orten zeigt, dass der Erzähler die Welt nur durch seine Sehnsucht und seine verlorene Liebe wahrnimmt.
Die Wiederholung des Ausrufs „Fort, nur fort!“ und die Tränen, die ihm „über die Augen gehen“, verdeutlichen die innere Unruhe und das starke Heimweh des lyrischen Ichs. Es ist nicht nur die physische Distanz zur Geliebten, die ihn quält, sondern die innere Leere und der Verlust von Vertrautem und Verlangtem. Die Schönheit der Blumen und der Natur kann nicht mit der Bedeutung des ursprünglichen Ortes und der geliebten Person verglichen werden, was die tiefe emotionale Belastung des Erzählers noch verstärkt.
Mörike nutzt in diesem Gedicht eine prägnante, fast wehmütige Sprache, die das Gefühl des Heimwehs intensiv spürbar macht. Der Kontrast zwischen der äußeren Welt und der inneren Empfindung des lyrischen Ichs wird in den Bildmotiven der Natur und der Verweigerung des Trostes durch die Blumen eindrucksvoll gezeigt. Das Gedicht spricht damit universelle Themen wie Sehnsucht, Verlust und die Unfähigkeit, die neue Welt mit den Augen des Herzens zu sehen, an.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.