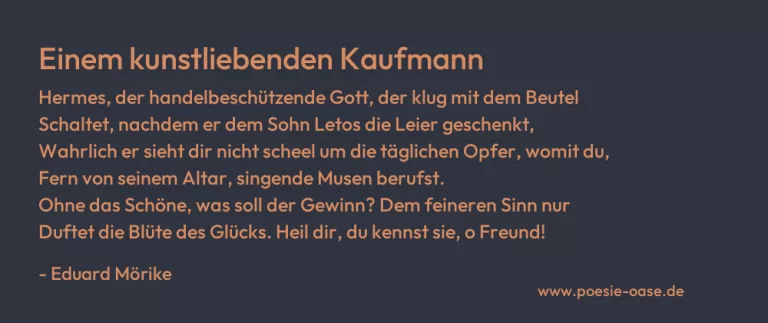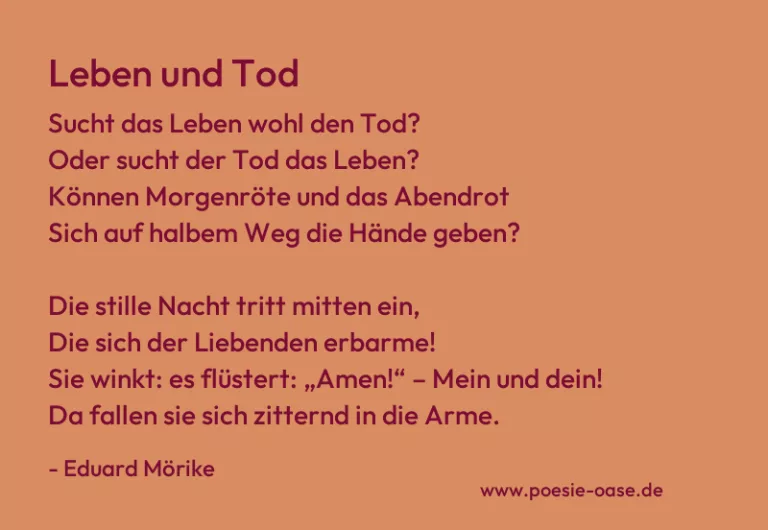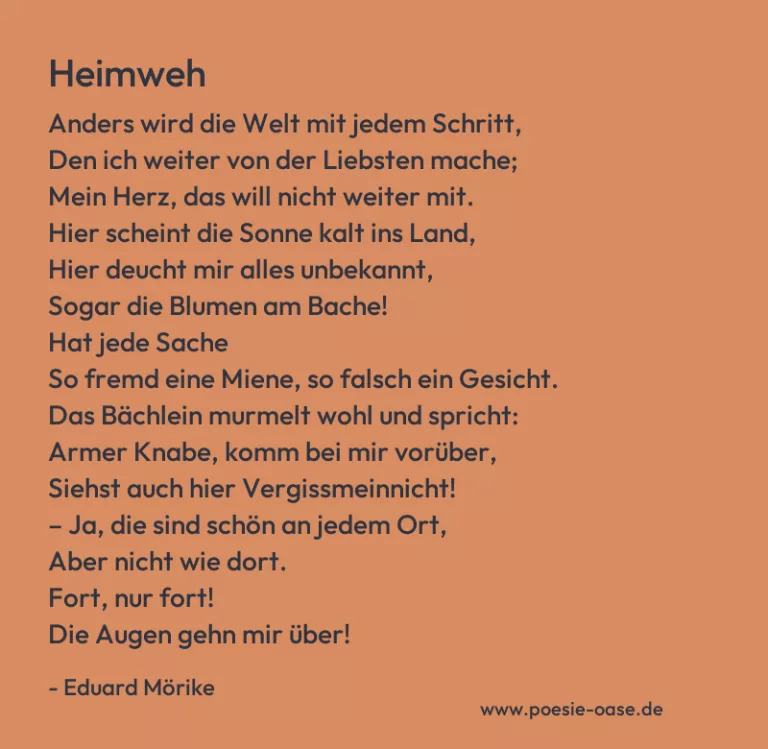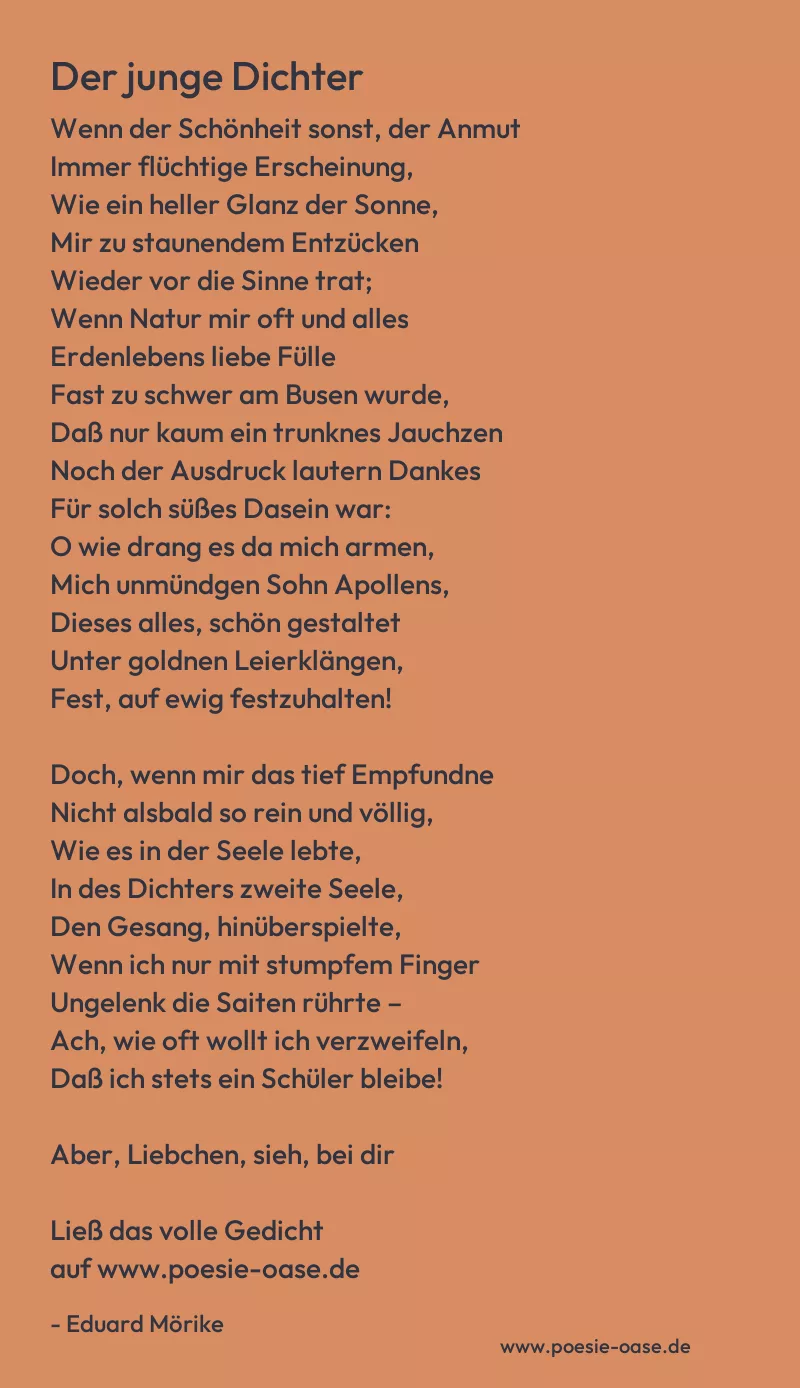Wenn der Schönheit sonst, der Anmut
Immer flüchtige Erscheinung,
Wie ein heller Glanz der Sonne,
Mir zu staunendem Entzücken
Wieder vor die Sinne trat;
Wenn Natur mir oft und alles
Erdenlebens liebe Fülle
Fast zu schwer am Busen wurde,
Daß nur kaum ein trunknes Jauchzen
Noch der Ausdruck lautern Dankes
Für solch süßes Dasein war:
O wie drang es da mich armen,
Mich unmündgen Sohn Apollens,
Dieses alles, schön gestaltet
Unter goldnen Leierklängen,
Fest, auf ewig festzuhalten!
Doch, wenn mir das tief Empfundne
Nicht alsbald so rein und völlig,
Wie es in der Seele lebte,
In des Dichters zweite Seele,
Den Gesang, hinüberspielte,
Wenn ich nur mit stumpfem Finger
Ungelenk die Saiten rührte –
Ach, wie oft wollt ich verzweifeln,
Daß ich stets ein Schüler bleibe!
Aber, Liebchen, sieh, bei dir
Bin ich plötzlich wie verwandelt:
Im erwärmten Winterstübchen,
Bei dem Schimmer dieser Lampe,
Wo ich deinen Worten lausche,
Hold bescheidnen Liebesworten!
Wie du dann geruhig deine
Braunen Lockenhaare schlichtest,
Also legt sich mir geglättet
All dies wirre Bilderwesen,
All des Herzens eitle Sorge,
Viel-zerteiltes Tun und Denken.
Froh begeistert, leicht gefiedert,
Flieg ich aus der Dichtung engen
Rosenbanden, daß ich nur
Noch in ihrem reinen Dufte,
Als im Elemente, lebe.
O du Liebliche, du lächelst,
Schüttelst, küssend mich, das Köpfchen,
Und begreifst nicht, was ich meine.
Möcht ich selber es nicht wissen,
Wissen nur, daß du mich liebest,
Daß ich in dem Flug der Zeit
Deine kleinen Hände halte!