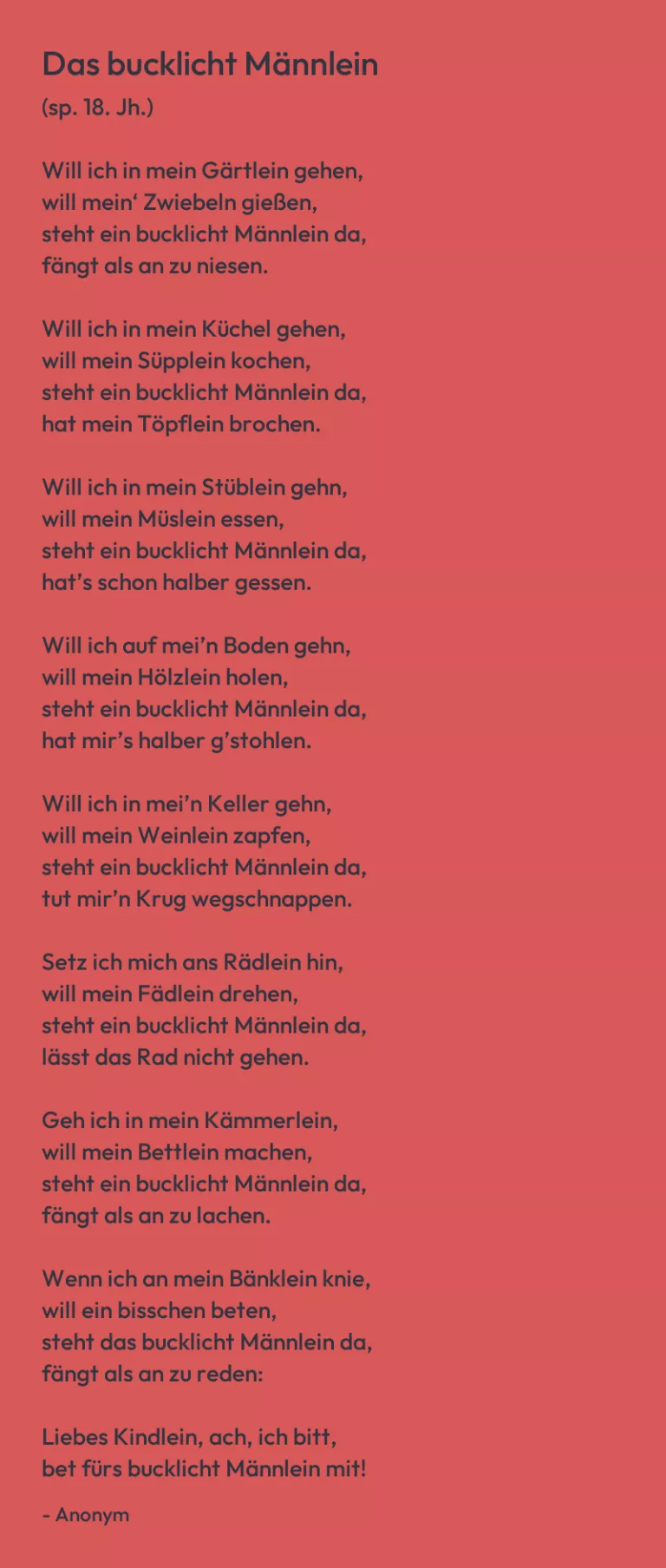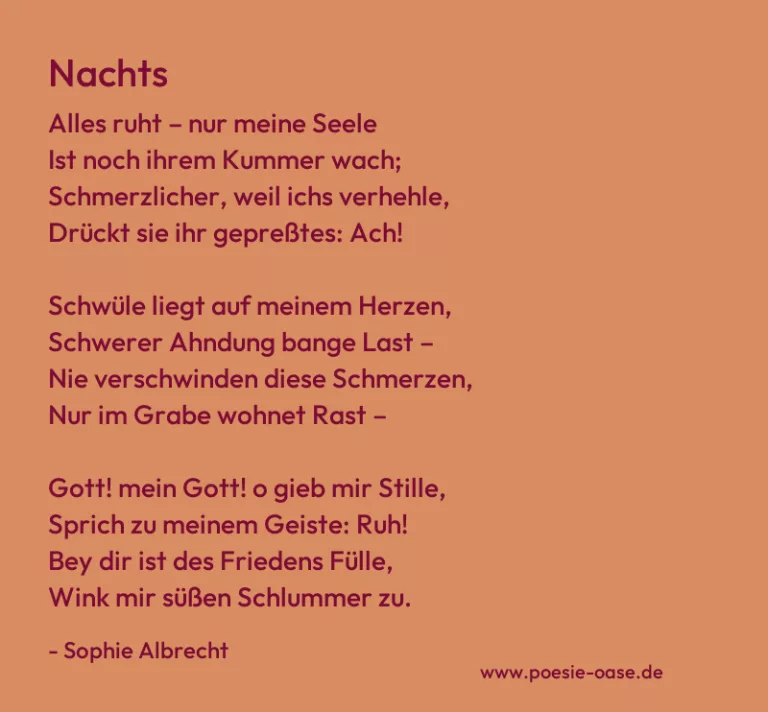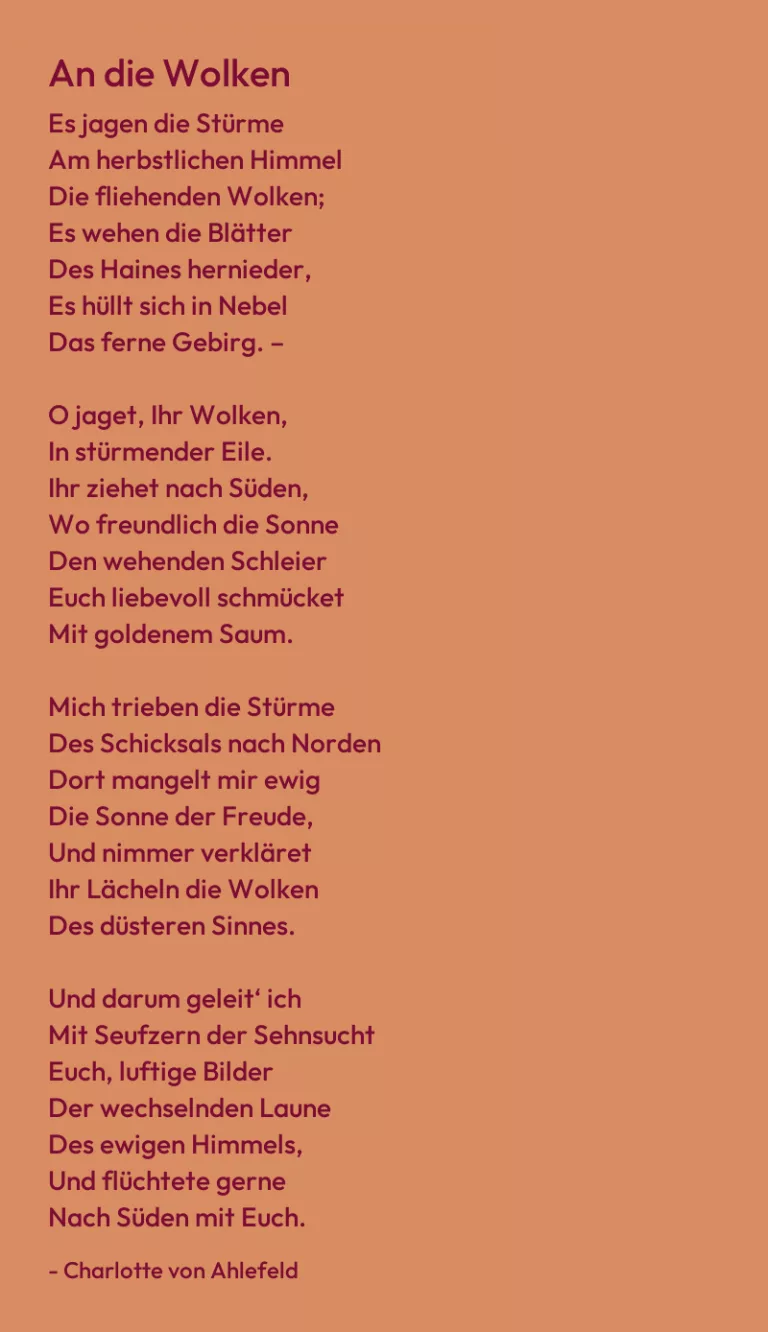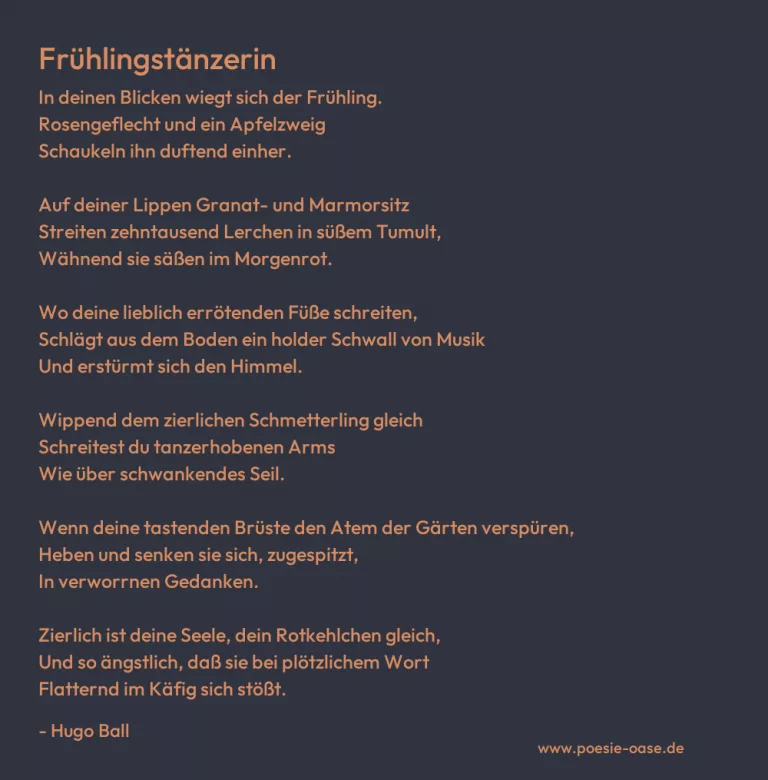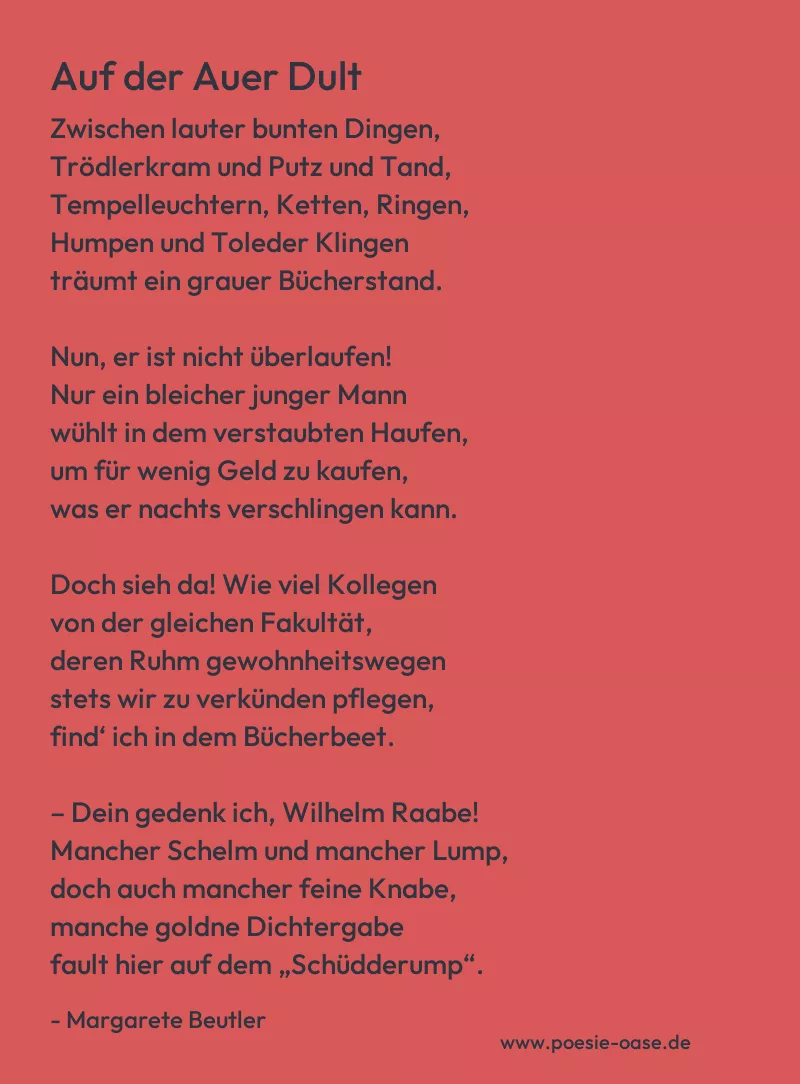Auf der Auer Dult
Zwischen lauter bunten Dingen,
Trödlerkram und Putz und Tand,
Tempelleuchtern, Ketten, Ringen,
Humpen und Toleder Klingen
träumt ein grauer Bücherstand.
Nun, er ist nicht überlaufen!
Nur ein bleicher junger Mann
wühlt in dem verstaubten Haufen,
um für wenig Geld zu kaufen,
was er nachts verschlingen kann.
Doch sieh da! Wie viel Kollegen
von der gleichen Fakultät,
deren Ruhm gewohnheitswegen
stets wir zu verkünden pflegen,
find‘ ich in dem Bücherbeet.
– Dein gedenk ich, Wilhelm Raabe!
Mancher Schelm und mancher Lump,
doch auch mancher feine Knabe,
manche goldne Dichtergabe
fault hier auf dem „Schüdderump“.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
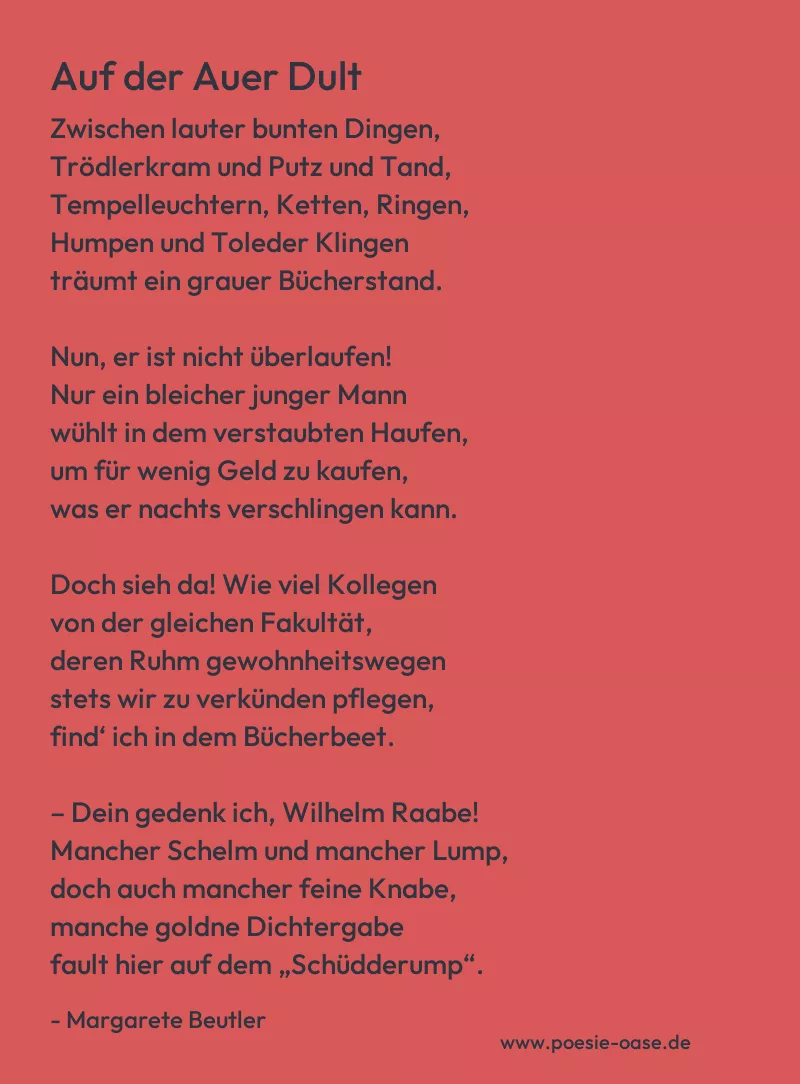
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Auf der Auer Dult“ von Margarete Beutler beschreibt eine Szene auf einem Flohmarkt, der von einer Vielzahl bunter, oft wertlos erscheinender Dinge überflutet wird. Inmitten des Trödlerkrams und des „Putz und Tand“ sticht der „graue Bücherstand“ hervor. Die Farben und Gegenstände der ersten Zeilen vermitteln die bunte, aber auch chaotische und überflüssige Atmosphäre des Marktes. Die „Tempelleuchter“, „Ketten“ und „Ringe“ symbolisieren vielleicht Konsum und Materialismus, während der „graue Bücherstand“ eine Insel der Ruhe und der intellektuellen Beschäftigung darstellt, die inmitten dieses Trubels eine kontrastierende Bedeutung hat.
In der zweiten Strophe wird der „bleiche junge Mann“ eingeführt, der in dem „verstaubten Haufen“ nach etwas sucht. Dieser junge Mann ist offensichtlich ein leidenschaftlicher Leser, der nach Büchern sucht, „um für wenig Geld zu kaufen, / was er nachts verschlingen kann“. Die Vorstellung, dass der Mann die Bücher „nachts verschlingen“ kann, deutet auf eine tiefgehende, fast besessene Liebe zur Literatur hin. Diese Bücher sind für ihn nicht nur geistige Nahrung, sondern auch ein Mittel der Zuflucht oder des persönlichen Wachstums.
In der dritten Strophe bemerkt der Sprecher, dass dieser junge Mann nicht alleine ist. „Kollegen von der gleichen Fakultät“ – vermutlich ebenfalls Literaturinteressierte oder Studenten – stöbern ebenfalls im „Bücherbeet“. Die Erwähnung von „Ruhm“ und „Gewohnheit“ könnte auf die Gesellschaft oder das akademische Milieu anspielen, in dem diese Personen eine gemeinsame Basis haben. Es wird jedoch auch ein gewisses ironisches Bild erzeugt, da diese Bücher, die einst von „Ruhm“ umgeben waren, jetzt in einem „Bücherbeet“ liegen und von den Suchenden nach vergessenen, vernachlässigten Schätzen durchwühlt werden.
Die letzte Zeile des Gedichts, in der der Sprecher Wilhelm Raabe, einen bekannten deutschen Schriftsteller, erwähnt, verstärkt diese Ironie und betont den Verlust des ehemaligen Ruhms. Raabe, der hier als Symbol für die wertvollen, aber vergessenen „Dichtergaben“ dient, liegt zusammen mit „manchem Schelm und manchem Lump“ in einem Zustand der Vernachlässigung. Die Bücher, die einst als wertvoll und bedeutend galten, sind nun „verfault“ und abgelegt auf dem „Schüdderump“ – einem möglicherweise imaginären oder metaphorischen Ort des Verfalls.
Insgesamt thematisiert das Gedicht die Vergänglichkeit von Ruhm und die Veränderung der Wahrnehmung von Literatur im Laufe der Zeit. Die Bücher, die einst gefeiert wurden, sind nun Teil eines Trödlermarktes, auf dem sie von der nächsten Generation entdeckt werden – oft nicht mehr mit dem Respekt, den sie einst genossen. Beutler spiegelt in diesem Gedicht die Ironie und den Verfall des kulturellen Gedächtnisses wider, während sie gleichzeitig die unaufhörliche Suche nach Wissen und der Freude an Literatur würdigt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.