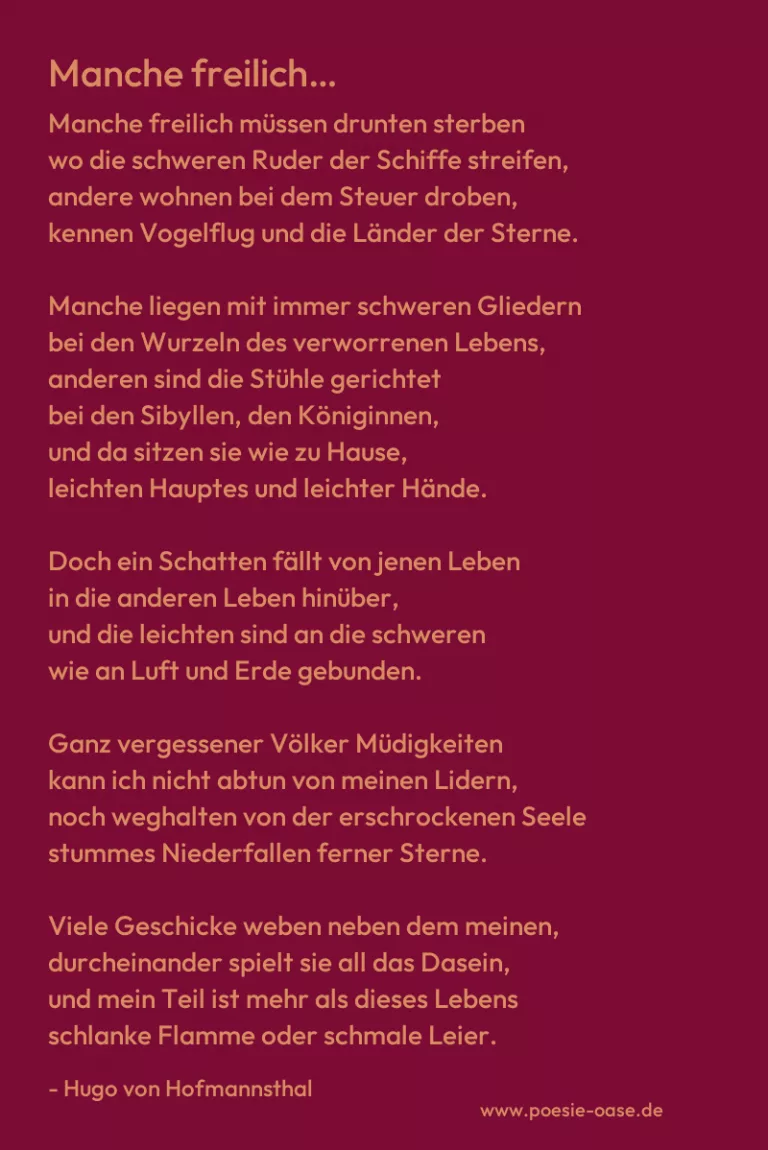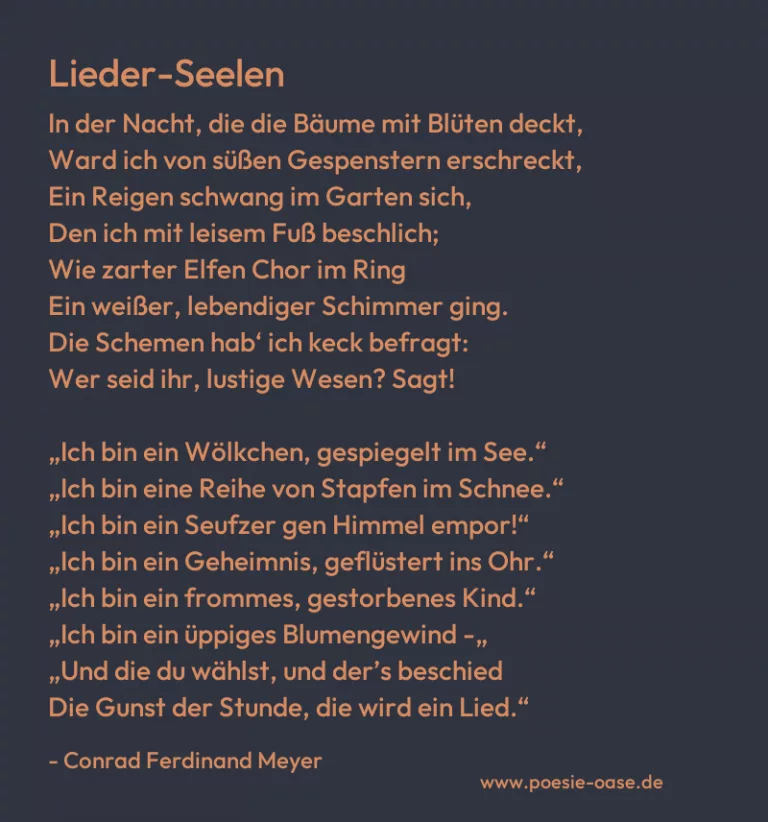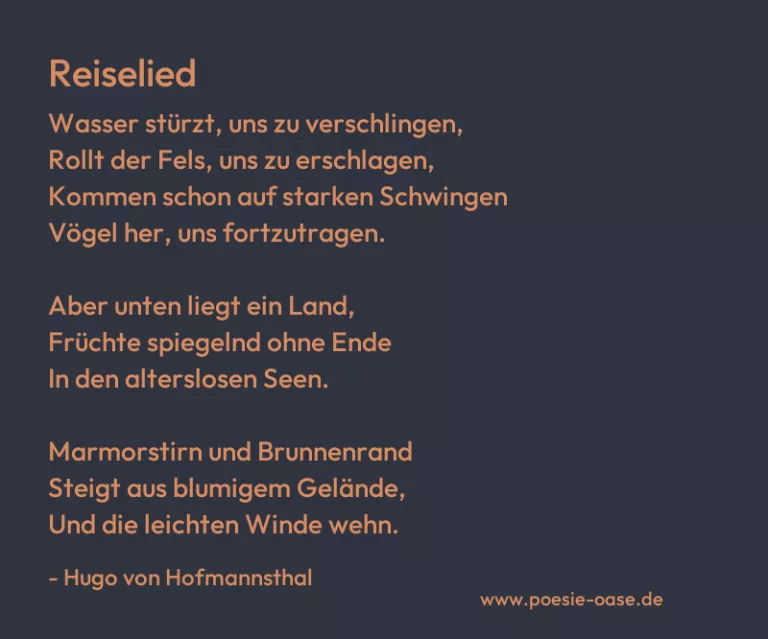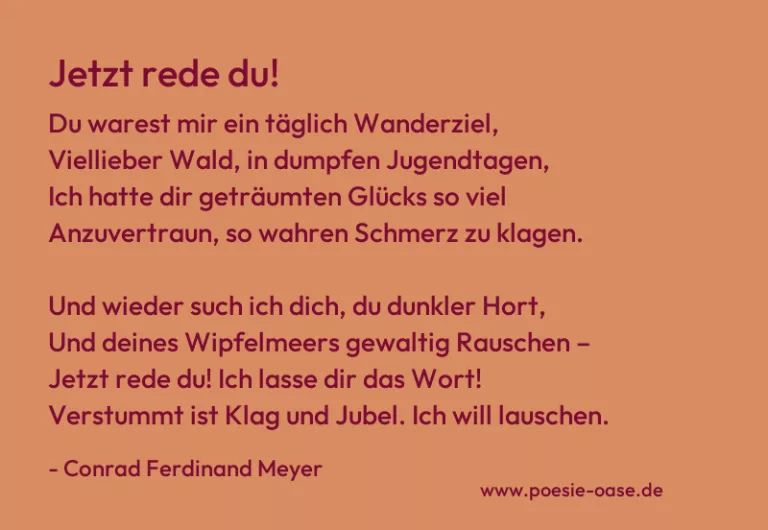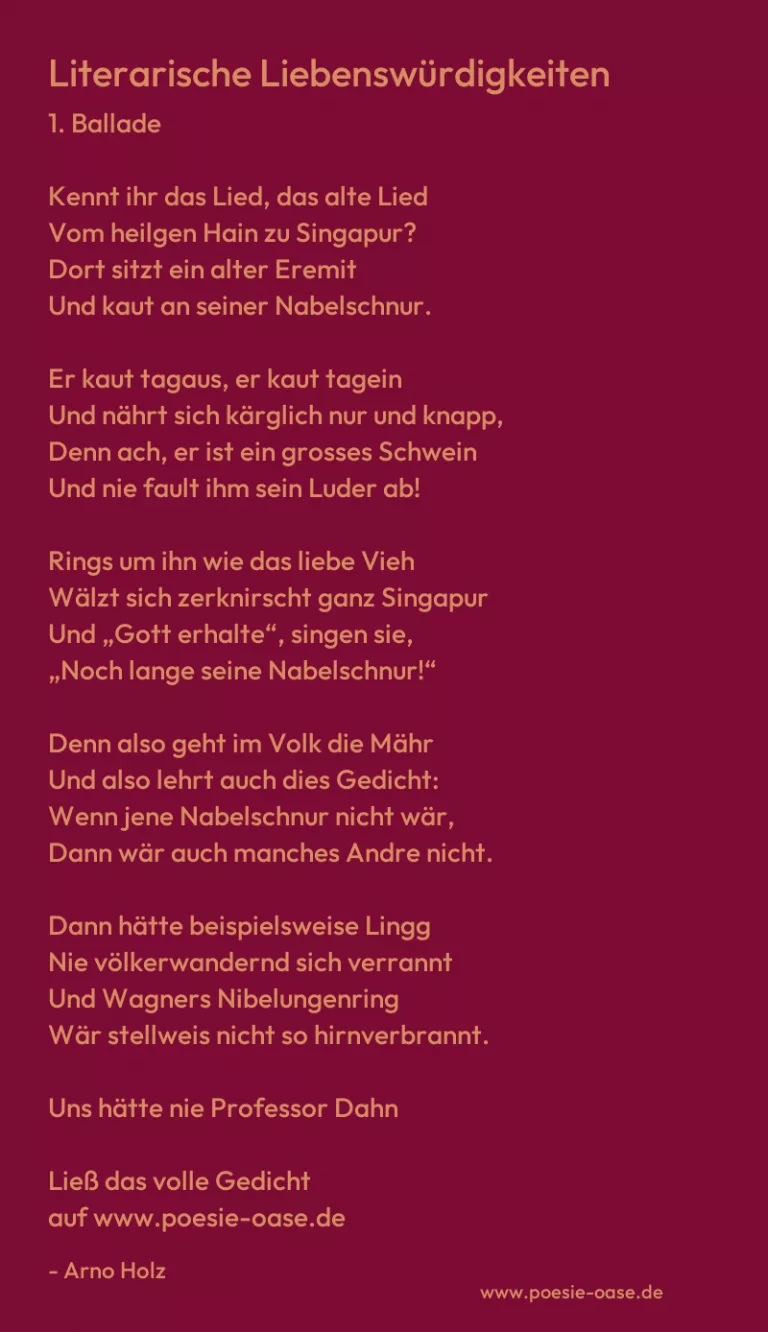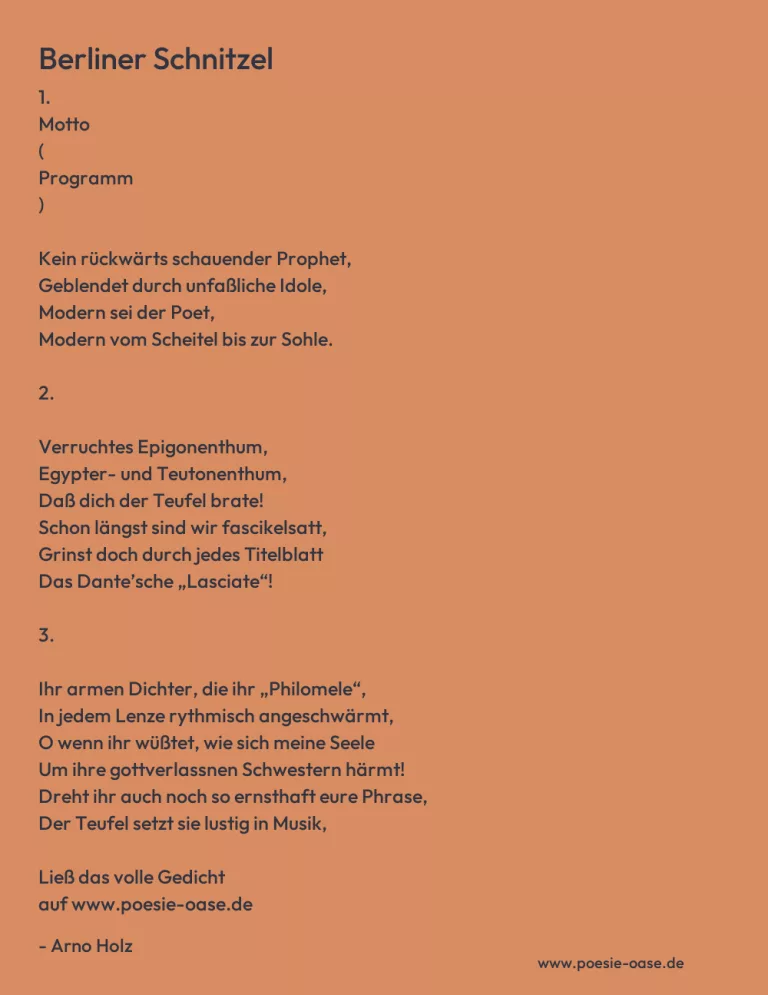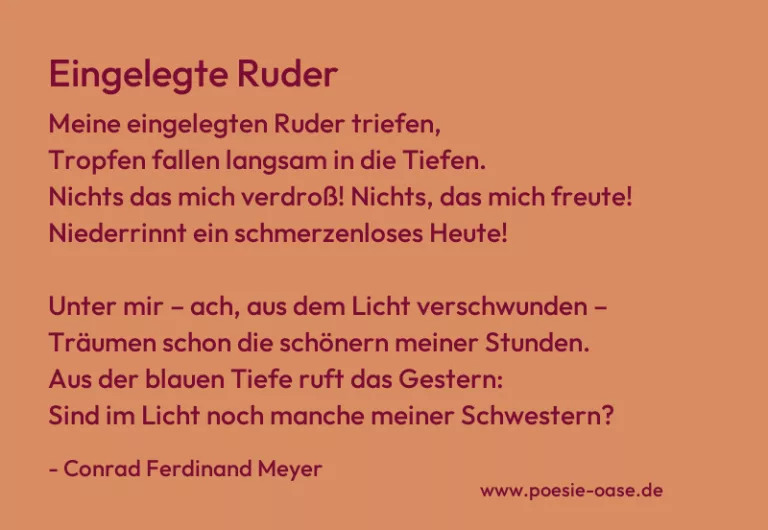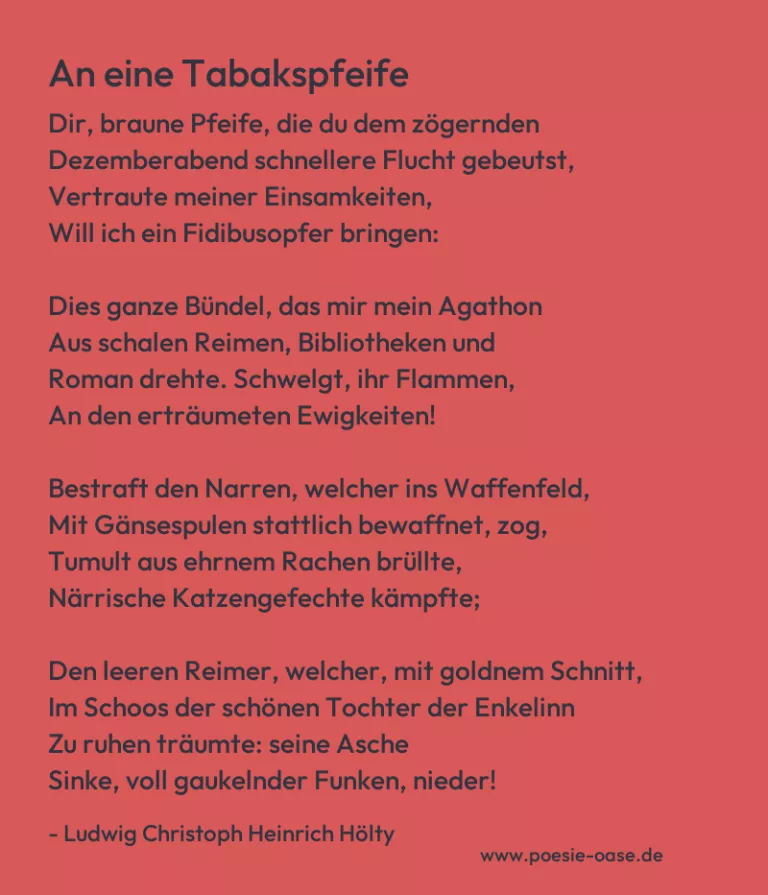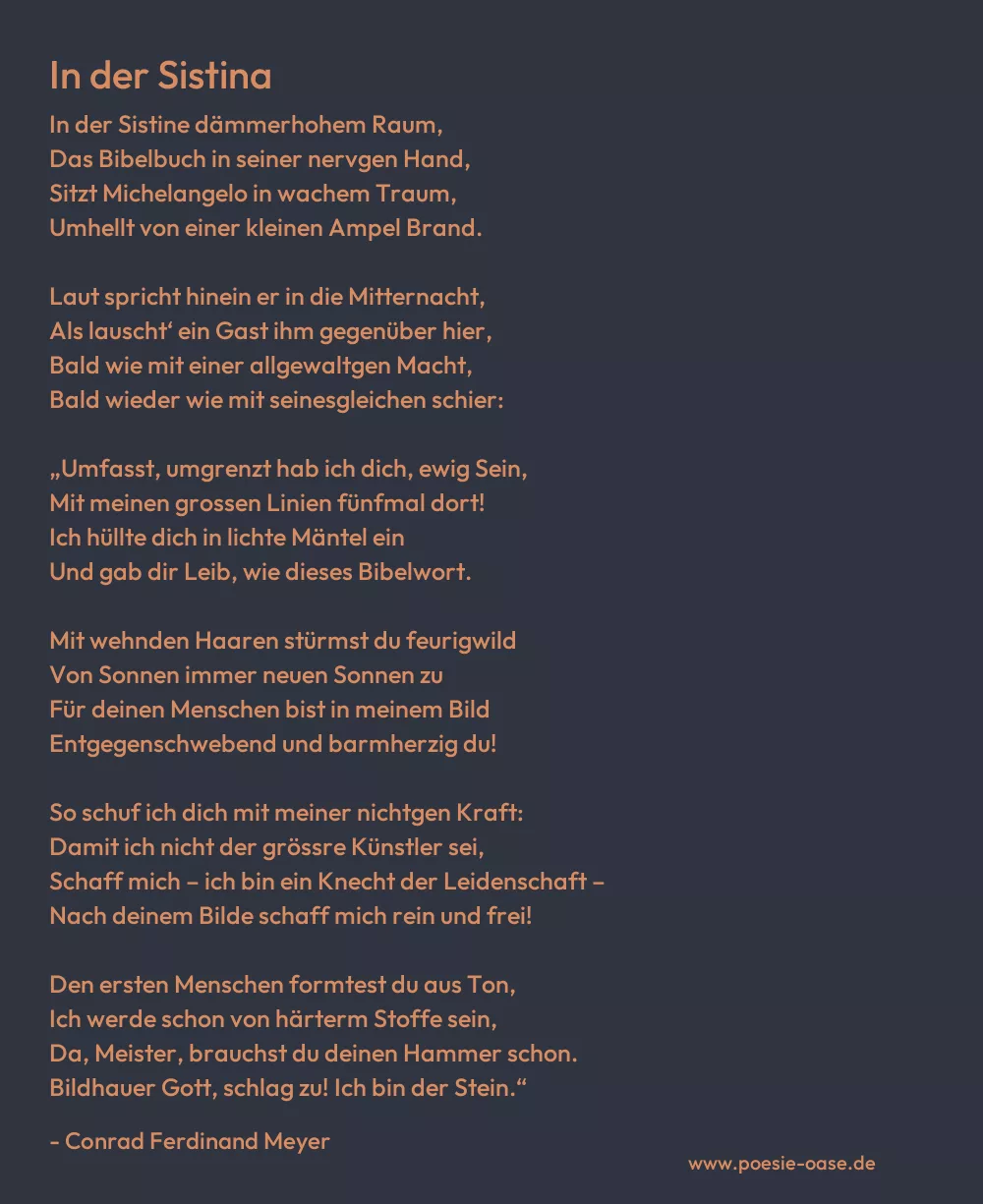In der Sistina
In der Sistine dämmerhohem Raum,
Das Bibelbuch in seiner nervgen Hand,
Sitzt Michelangelo in wachem Traum,
Umhellt von einer kleinen Ampel Brand.
Laut spricht hinein er in die Mitternacht,
Als lauscht‘ ein Gast ihm gegenüber hier,
Bald wie mit einer allgewaltgen Macht,
Bald wieder wie mit seinesgleichen schier:
„Umfasst, umgrenzt hab ich dich, ewig Sein,
Mit meinen grossen Linien fünfmal dort!
Ich hüllte dich in lichte Mäntel ein
Und gab dir Leib, wie dieses Bibelwort.
Mit wehnden Haaren stürmst du feurigwild
Von Sonnen immer neuen Sonnen zu
Für deinen Menschen bist in meinem Bild
Entgegenschwebend und barmherzig du!
So schuf ich dich mit meiner nichtgen Kraft:
Damit ich nicht der grössre Künstler sei,
Schaff mich – ich bin ein Knecht der Leidenschaft –
Nach deinem Bilde schaff mich rein und frei!
Den ersten Menschen formtest du aus Ton,
Ich werde schon von härterm Stoffe sein,
Da, Meister, brauchst du deinen Hammer schon.
Bildhauer Gott, schlag zu! Ich bin der Stein.“
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
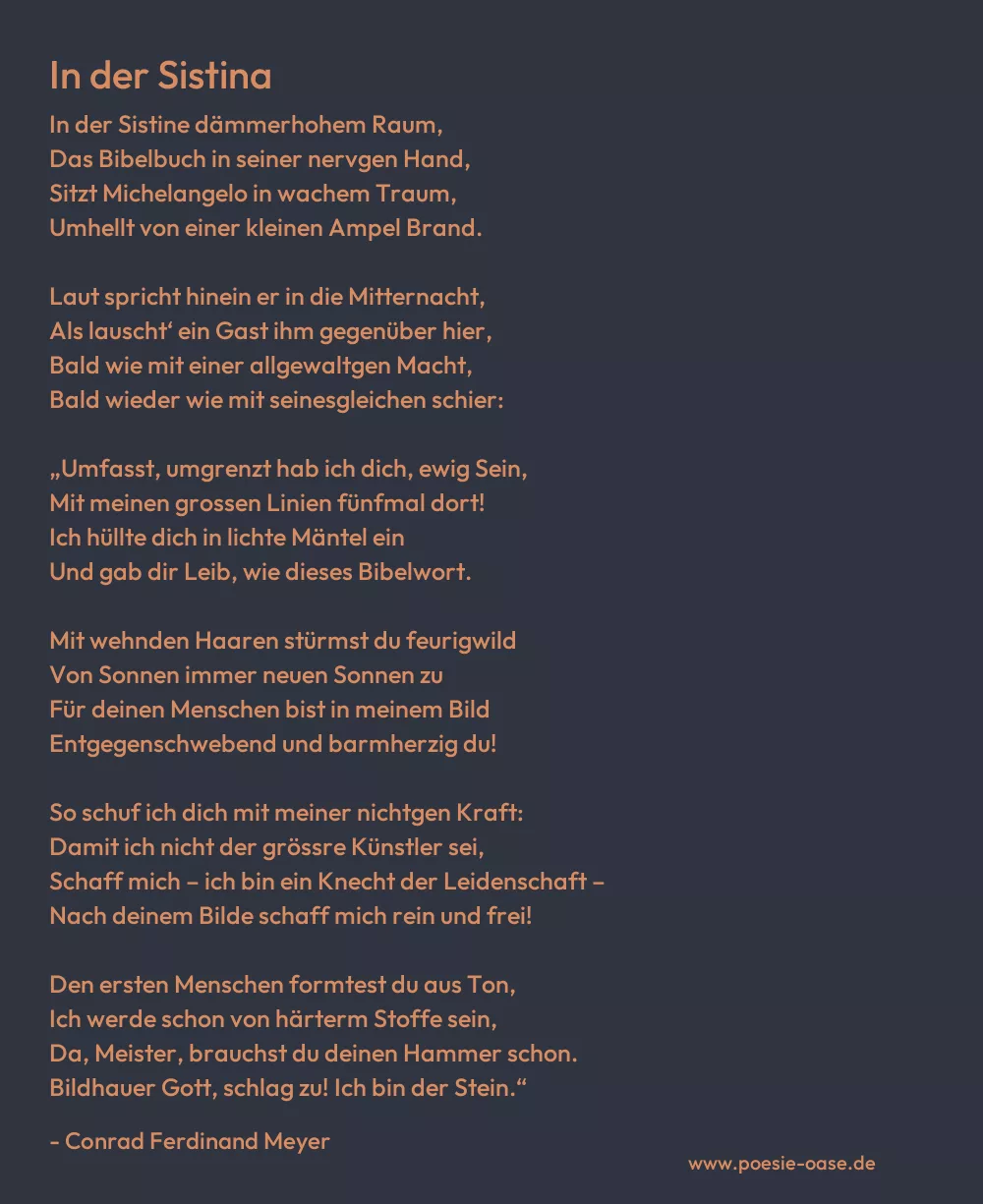
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „In der Sistina“ von Conrad Ferdinand Meyer beschreibt eine tiefgründige Begegnung zwischen Michelangelo und einer mystischen, fast göttlichen Stimme, die in der Luft der Kapelle der Sixtinischen Kirche zu schweben scheint. Die Szenerie ist von einer intensiven, fast übernatürlichen Atmosphäre geprägt: Michelangelo sitzt in einem „dämmerhohen Raum“ der Sixtinischen Kapelle, umgeben von der Dunkelheit der Nacht und nur von einer kleinen „Ampel Brand“ erleuchtet. Diese Dämmerung und das gedämpfte Licht schaffen eine geheimnisvolle Stimmung, die die Kunst und die göttliche Schöpfungskraft in den Mittelpunkt rückt.
In diesem mystischen Zustand spricht Michelangelo in die Mitternacht, als würde er mit einer höheren Macht kommunizieren. Die „laut sprechende“ Stimme ist sowohl „mit einer allgewaltigen Macht“ als auch „mit seinesgleichen schier“ – sie schwankt zwischen einer überlegenen göttlichen Autorität und einer Form der Gleichheit, die dem Künstler selbst zu eigen ist. Die Stimme beschreibt eine Art schöpferische Einheit zwischen dem Künstler und dem Göttlichen. Sie betont, wie Michelangelo selbst „ewig“ von den „großen Linien“ umgrenzt wurde und wie seine Werke aus „lichte Mäntel“ gehüllt wurden, um den menschlichen Körper zu erschaffen.
Michelangelo wird als Schöpfer dargestellt, der „vom Sonnen immer neuen Sonnen“ stürmt, ein Bild für seine unermüdliche Kreativität und seine ewige Suche nach Vollkommenheit. Doch diese Stimme fordert auch eine Kehrtwende, indem sie ihm befiehlt, sich „nach deinem Bilde“ zu schaffen. Der Künstler wird dazu aufgefordert, sich selbst zu „schaffen“ und sich aus dem „Ton“ zu erheben, was die Selbstverwirklichung und die Aufgabe des Künstlers als Schöpfer in einem größeren Kontext des göttlichen Plans betont. Es ist ein Akt der Transformation, bei dem Michelangelo nicht nur der Schöpfer, sondern auch der „Knecht der Leidenschaft“ wird, der sich von seiner eigenen kreativen Leidenschaft leiten lässt.
Der Höhepunkt des Gedichts ist der Moment, in dem die Stimme sich selbst als „Stein“ bezeichnet, der von Michelangelo bearbeitet werden muss. Diese Zeile zeigt die Demut der Stimme, die sich als Material für die Kunst darstellt, während sie gleichzeitig die Verantwortung des Künstlers betont. Der „Bildhauer Gott“ wird aufgefordert, mit seinem „Hammer“ zu schlagen, was auf die harte Arbeit und den kreativen Prozess des Bildhauens hinweist. Michelangelo selbst ist nicht nur ein Schöpfer, sondern ein Vermittler zwischen göttlicher Inspiration und menschlicher Kreativität, und der „Stein“ wird zu einem Symbol für die rohe, ungeschliffene Materie, die durch Kunst in ihre höchste Form verwandelt werden soll.
Insgesamt stellt das Gedicht die tiefere Verbindung zwischen Kunst und Göttlichkeit dar, wobei Michelangelo als der Künstler gesehen wird, der den göttlichen Funken in sich trägt. Die Aufforderung, sich selbst zu „schaffen“ und in „Stein“ zu verwandeln, verweist auf den ständigen kreativen Prozess, in dem der Künstler sowohl Schöpfer als auch Geschöpf wird, der gleichzeitig die Kunst in sich selbst und in der Welt um sich herum bearbeitet.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.