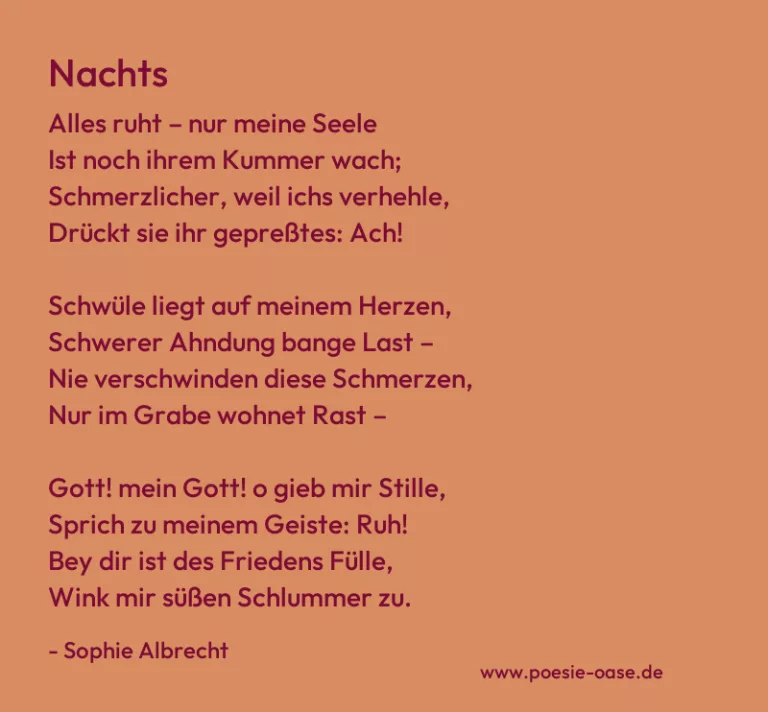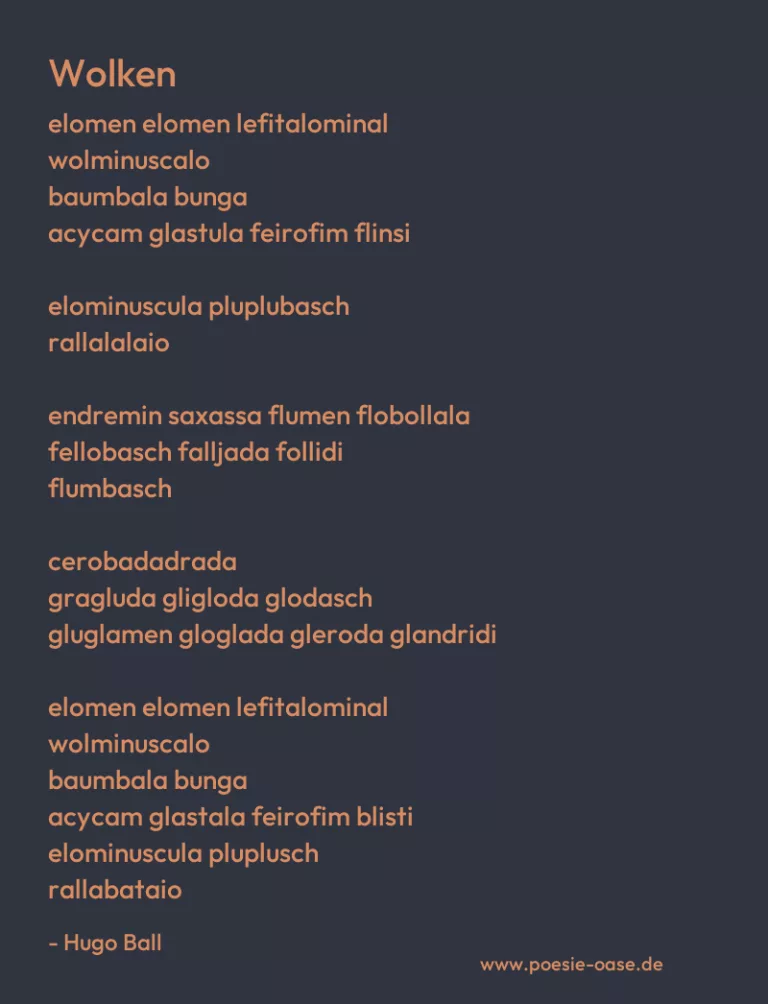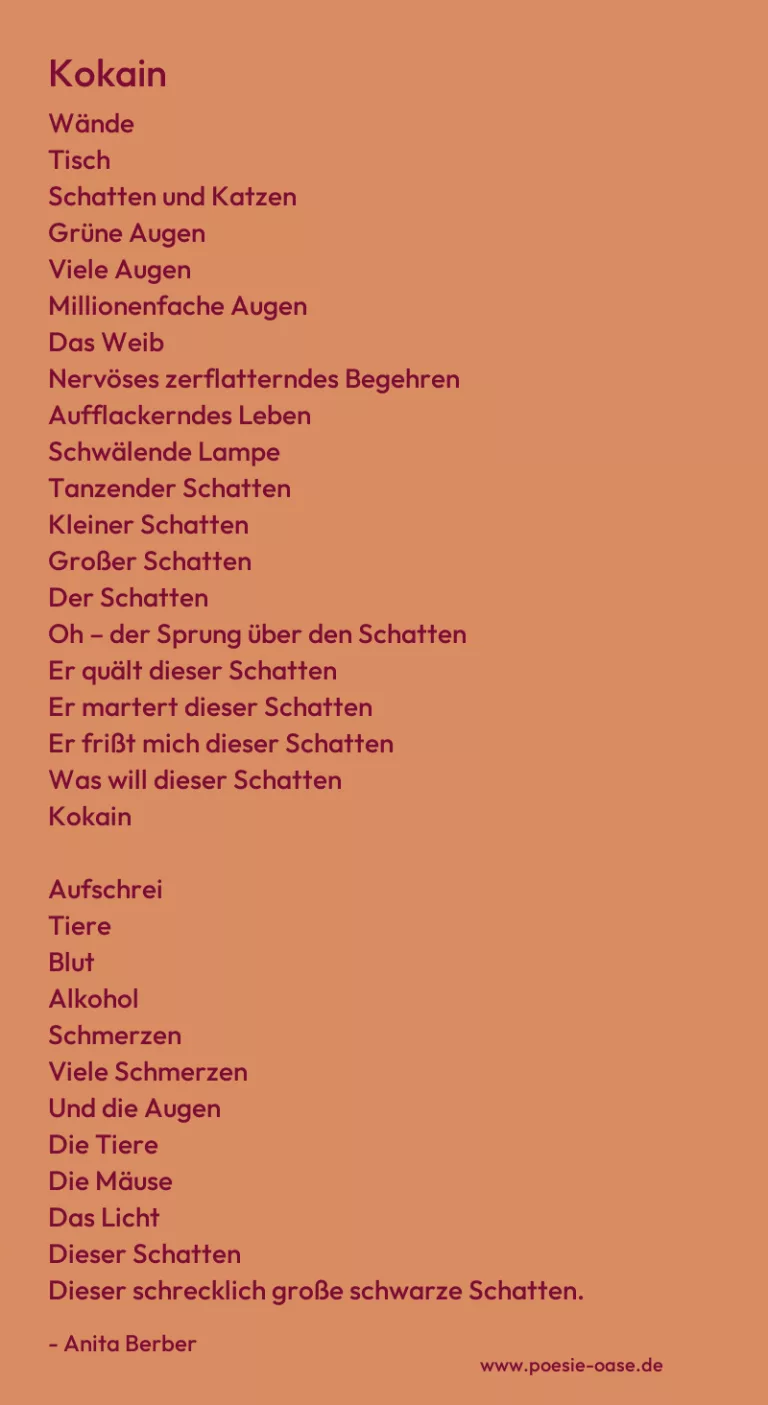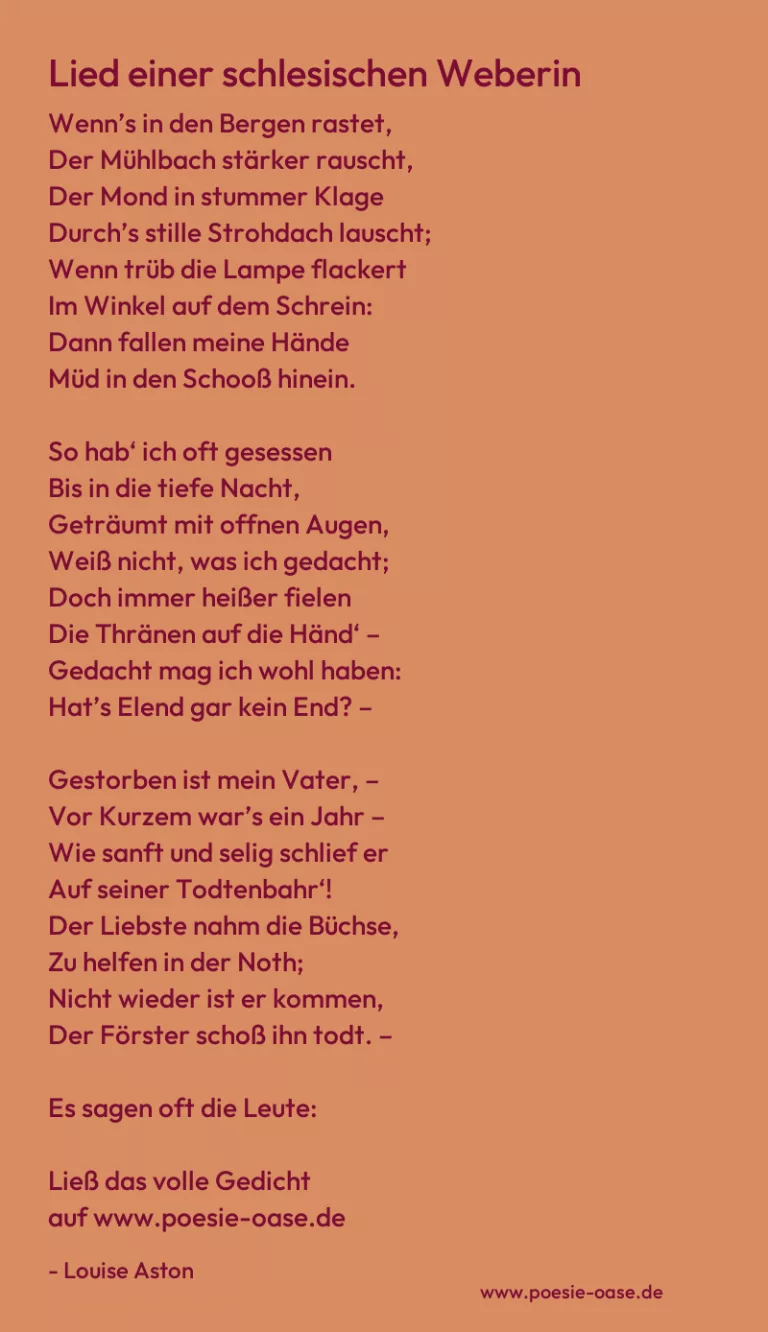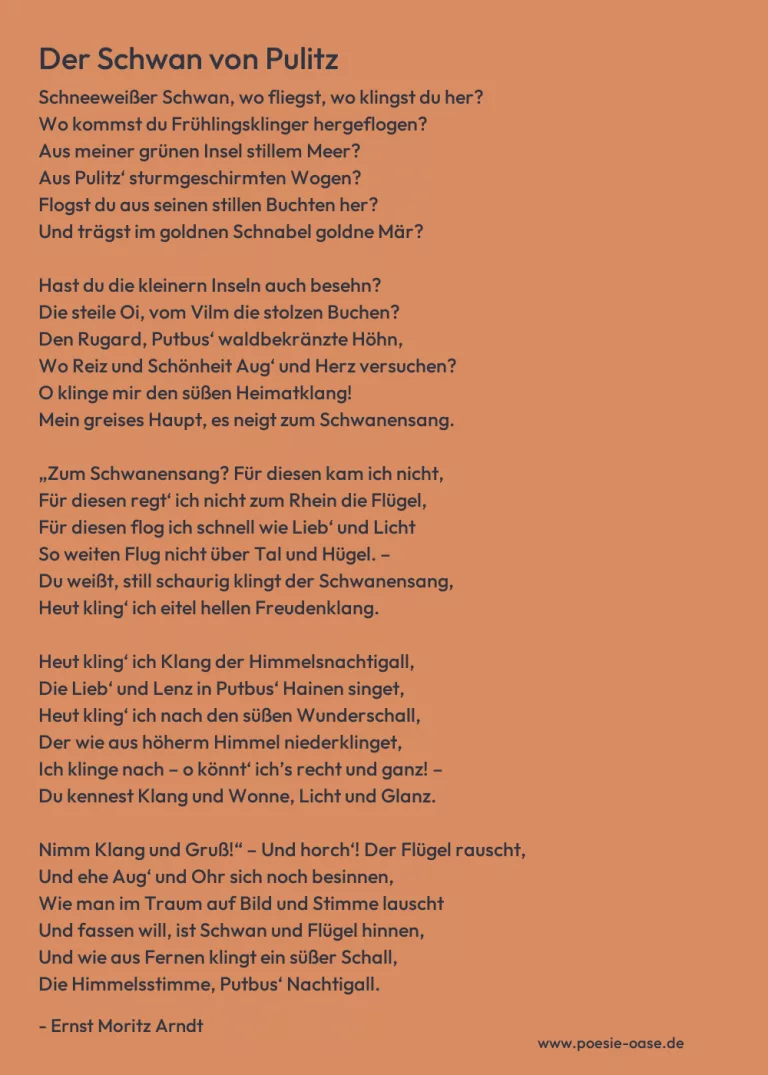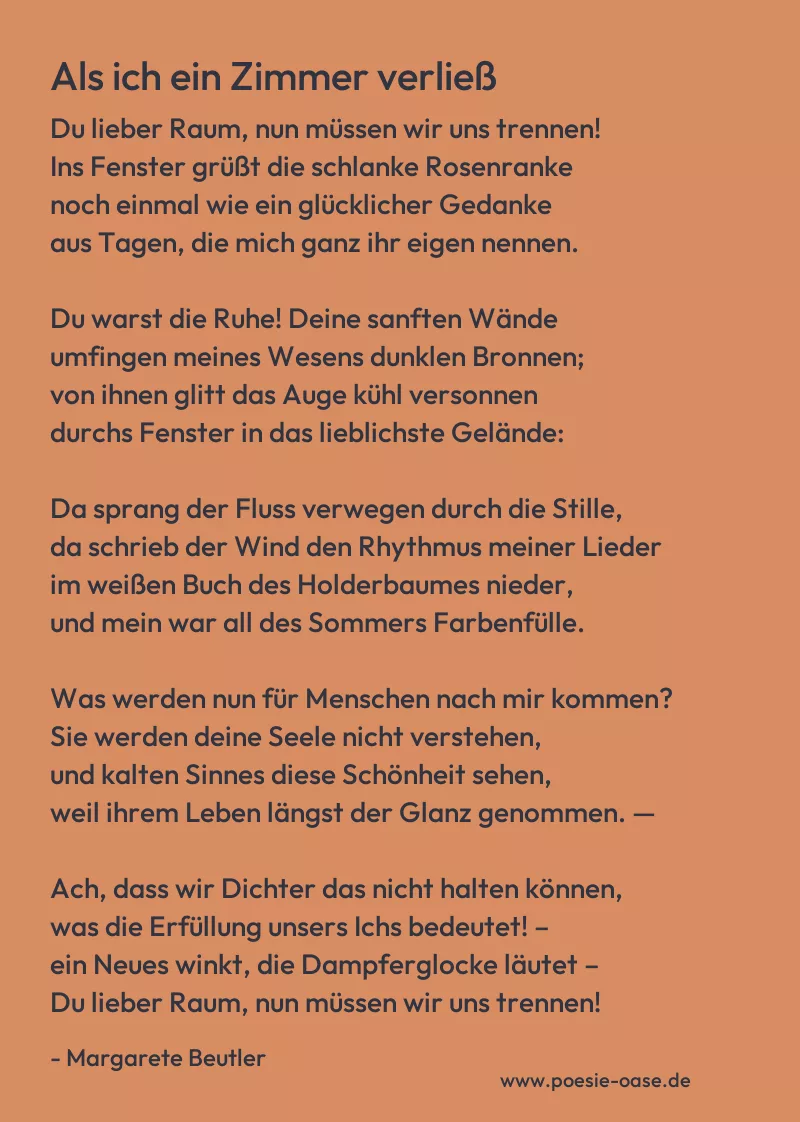Alltag, Feiern, Feiertage, Frieden, Gedanken, Gemeinfrei, Glaube & Spiritualität, Glücksmomente, Harmonie, Helden & Prinzessinnen, Herbst, Veränderung
Als ich ein Zimmer verließ
Du lieber Raum, nun müssen wir uns trennen!
Ins Fenster grüßt die schlanke Rosenranke
noch einmal wie ein glücklicher Gedanke
aus Tagen, die mich ganz ihr eigen nennen.
Du warst die Ruhe! Deine sanften Wände
umfingen meines Wesens dunklen Bronnen;
von ihnen glitt das Auge kühl versonnen
durchs Fenster in das lieblichste Gelände:
Da sprang der Fluss verwegen durch die Stille,
da schrieb der Wind den Rhythmus meiner Lieder
im weißen Buch des Holderbaumes nieder,
und mein war all des Sommers Farbenfülle.
Was werden nun für Menschen nach mir kommen?
Sie werden deine Seele nicht verstehen,
und kalten Sinnes diese Schönheit sehen,
weil ihrem Leben längst der Glanz genommen. —
Ach, dass wir Dichter das nicht halten können,
was die Erfüllung unsers Ichs bedeutet! –
ein Neues winkt, die Dampferglocke läutet –
Du lieber Raum, nun müssen wir uns trennen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
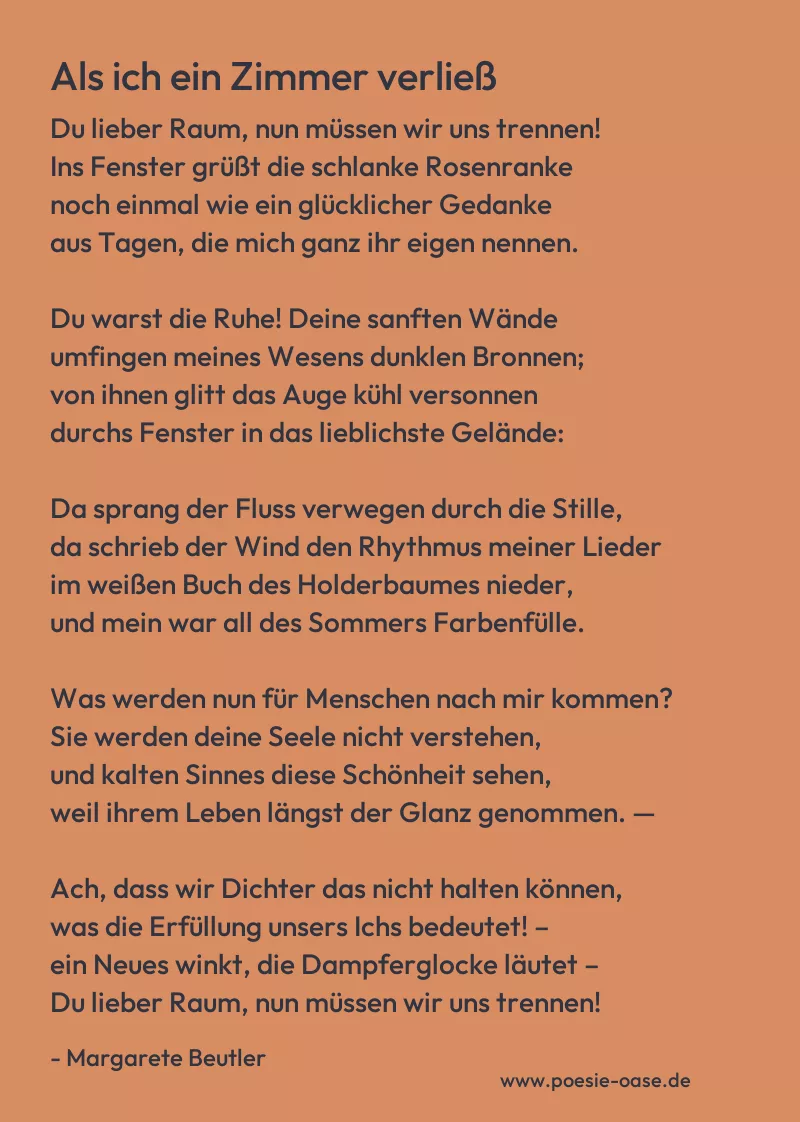
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Als ich ein Zimmer verließ“ von Margarete Beutler handelt von der emotionalen Trennung von einem geliebten Raum, der als Ort der Ruhe, der Inspiration und der persönlichen Erfüllung erlebt wurde. Die Eröffnung des Gedichts, in der der Sprecher sich von „Du lieber Raum“ verabschiedet, stellt sofort die enge Bindung zwischen dem lyrischen Ich und dem Raum dar. Der „Fenster“ und die „schlanke Rosenranke“, die als Symbol für etwas Schönes und Beständiges beschrieben wird, sind wie ein letzter Gruß aus der Vergangenheit, der an „glückliche Gedanken“ und „Tage“ erinnert, die der Sprecher als vollständig in seinem Besitz empfindet.
In der zweiten Strophe beschreibt der Sprecher den Raum als Quelle der inneren Ruhe, die seine „dunklen Bronnen“ – wahrscheinlich eine Anspielung auf tief verborgene, möglicherweise unbewusste Gefühle oder Gedanken – umhüllt und sanft umschließt. Die „sanften Wände“ des Raumes vermitteln Geborgenheit, während das „kühle, versonnene“ Auge des Sprechers durch das Fenster die äußere Welt betrachtet. Der Raum war nicht nur ein physischer Raum, sondern auch ein Ort der Reflexion und des kreativen Ausdrucks, was sich in der Betrachtung des „lieblichen Geländes“ draußen zeigt, das dem Sprecher als Inspirationsquelle dient.
In der dritten Strophe wird das Bild der natürlichen Welt weiter ausgebaut. Der „Fluss“, der „verwegen“ durch die Stille springt, und der „Wind“, der den „Rhythmus“ der Lieder schreibt, unterstreichen die Lebendigkeit und Harmonie der Natur, die im Einklang mit dem lyrischen Ich steht. Das „weiße Buch des Holderbaumes“ wird als Metapher für die Aufzeichnung dieser Erlebnisse und Gefühle verwendet, wobei die „Farbenfülle“ des Sommers das lebendige, emotionale Potenzial des Augenblicks widerspiegelt, der nun in der Erinnerung lebt.
In der vierten Strophe wendet sich der Sprecher von der persönlichen Erinnerung zu einem Gefühl der Melancholie und Sorge. Die „Menschen“, die nach ihm kommen, werden den Raum und die darin gespeicherte „Seele“ nicht verstehen. Ihre „kalte“ Wahrnehmung wird die Schönheit nicht in ihrer vollen Tiefe erfassen, da der „Glanz“ des Lebens für sie längst verloren zu sein scheint. Dieser Verlust der ursprünglichen Bedeutung des Raumes und seiner Bedeutung für das lyrische Ich bringt eine gewisse Traurigkeit und Resignation mit sich.
Im letzten Teil des Gedichts bringt der Sprecher eine Reflexion über das Dasein des Dichters, der oft nicht in der Lage ist, das Erfüllte zu bewahren, was er in seinem Innersten erlebt hat. Die „Erfüllung des Ichs“ bleibt dem Dichter oft entzogen, was einen gewissen Schmerz und eine Unvollständigkeit mit sich bringt. Schließlich endet das Gedicht mit der Lautwerdung des „Dampferglöckchens“, ein Symbol für den Übergang und die Notwendigkeit, den Raum und die damit verbundene innere Welt zu verlassen, um in eine neue Phase des Lebens aufzubrechen.
Insgesamt behandelt das Gedicht die Themen Erinnerung, Verlust und die flüchtige Natur von Erfüllung und Heimat. Der Raum wird als ein Ort der tiefen persönlichen Bedeutung und der schöpferischen Ruhe dargestellt, dessen Verlust jedoch unweigerlich eine gewisse Trauer und das Gefühl des Unvollständigen mit sich bringt. Die Trennung vom Raum spiegelt den Übergang und die Unausweichlichkeit des Wandels wider, dem auch die Dichter nicht entkommen können.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.