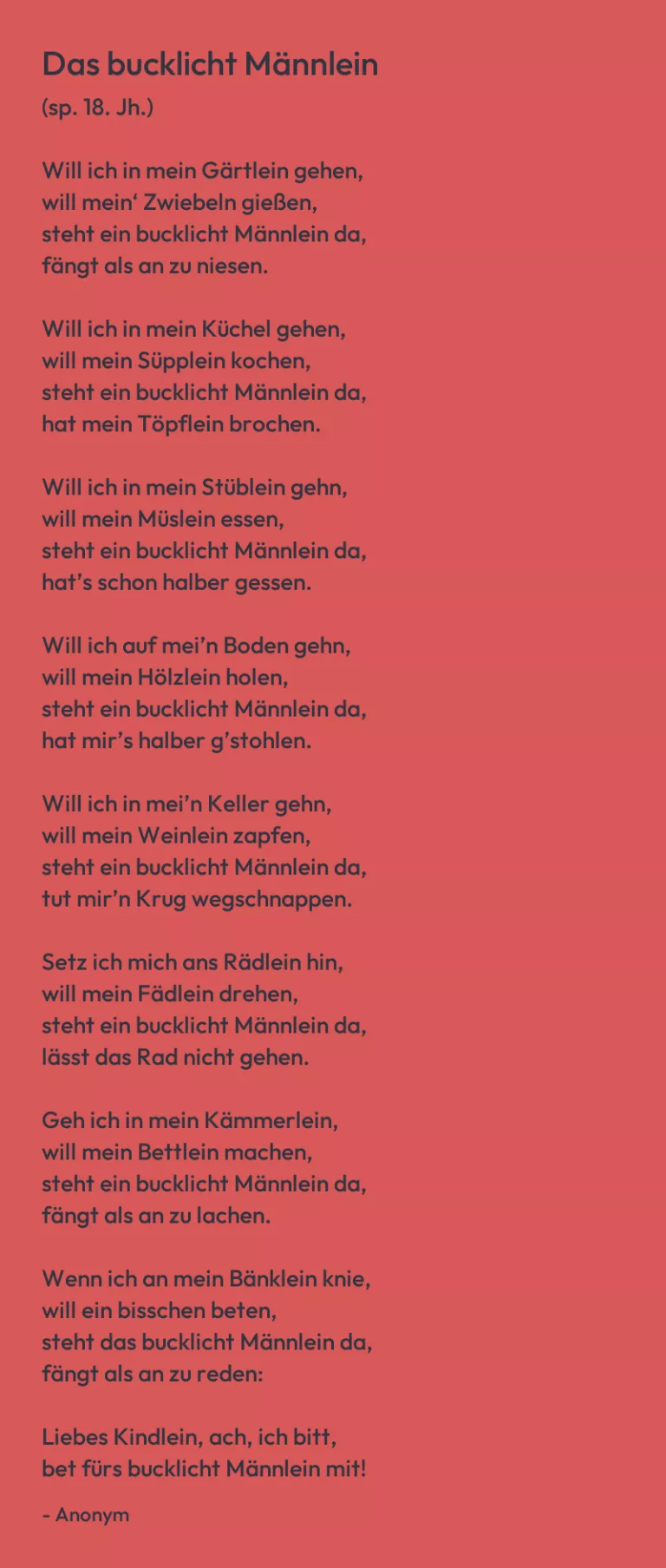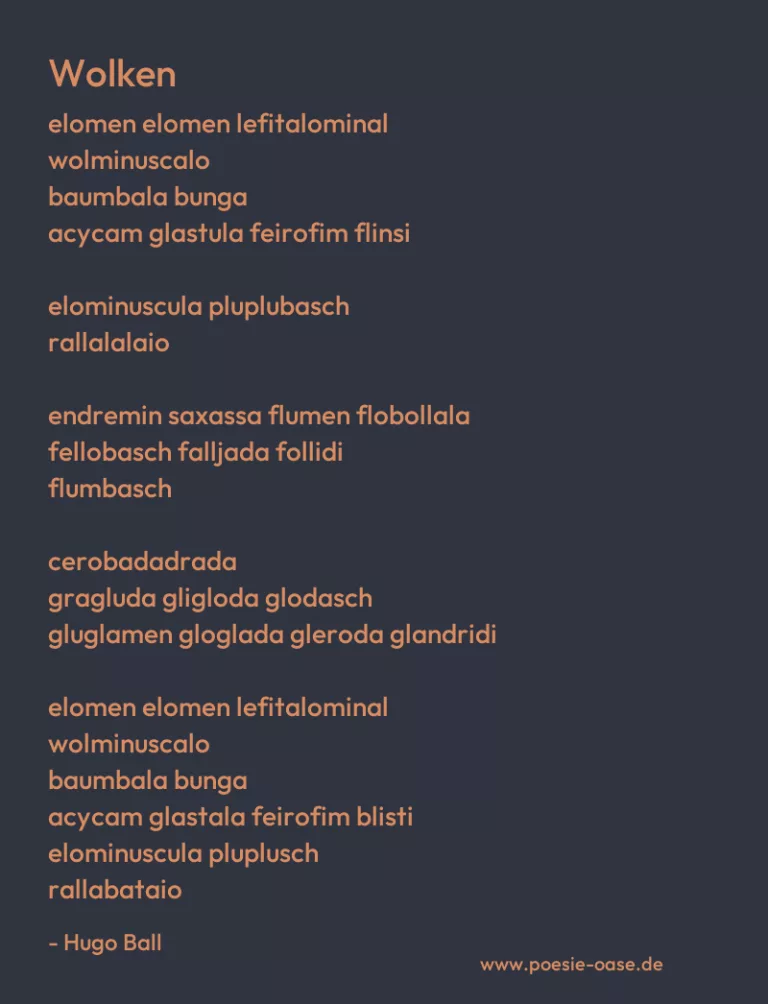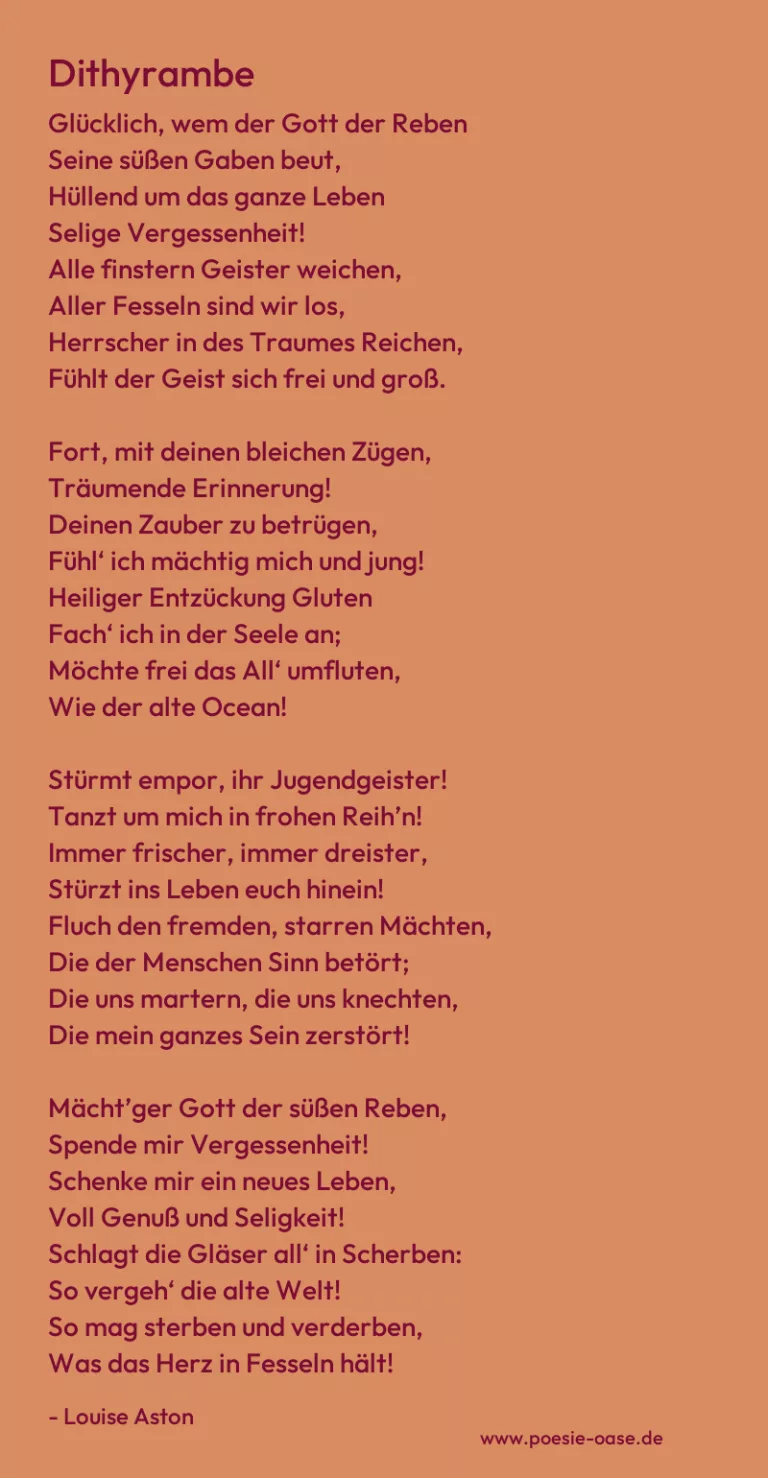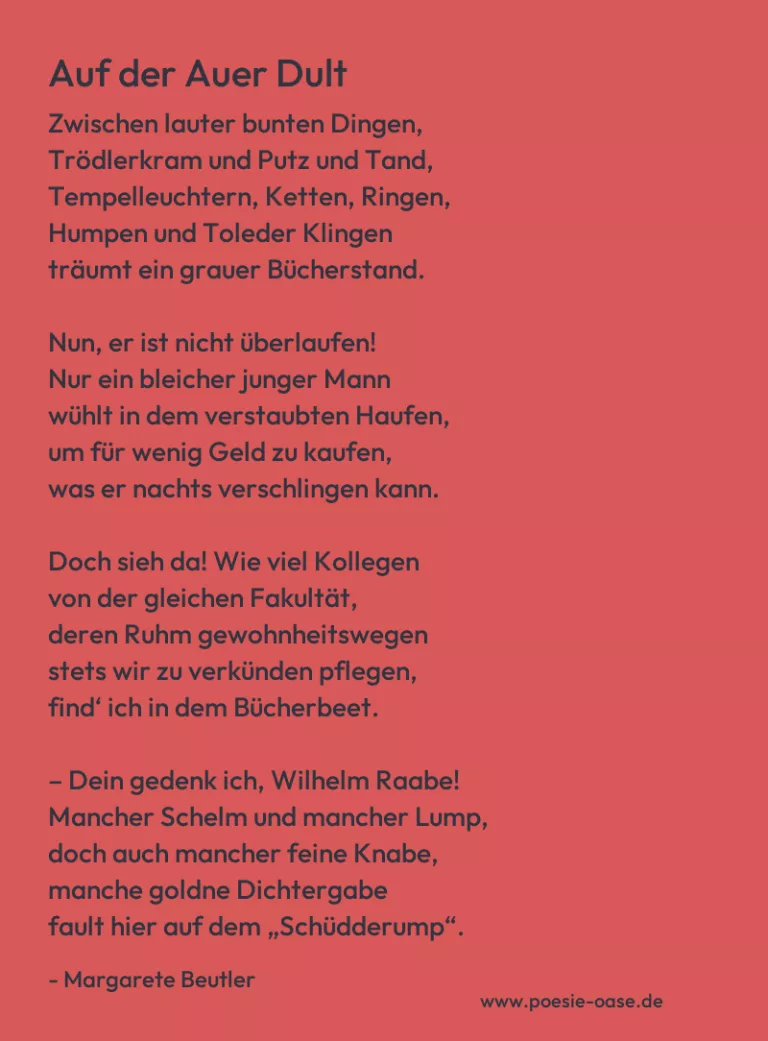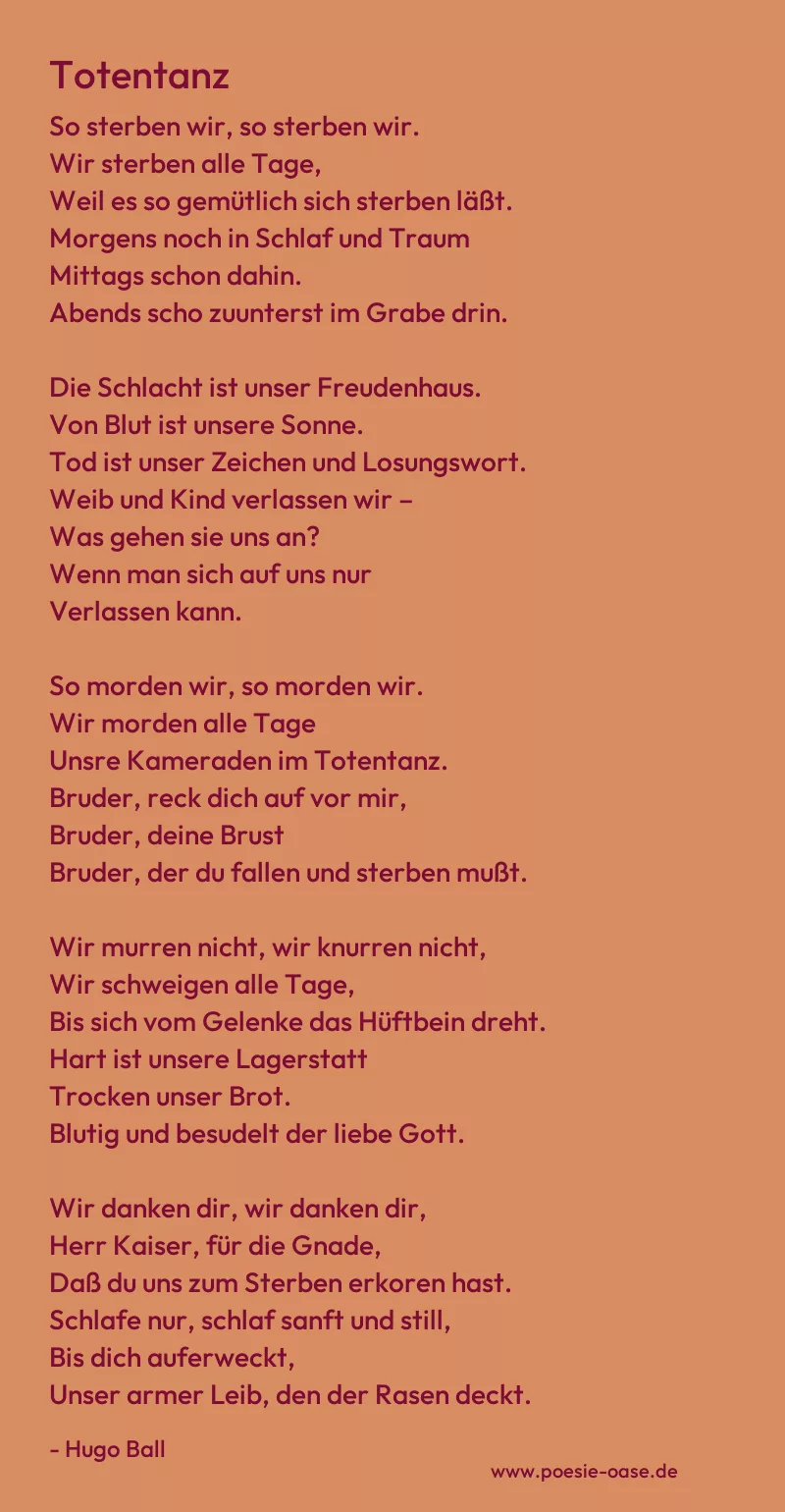Totentanz
So sterben wir, so sterben wir.
Wir sterben alle Tage,
Weil es so gemütlich sich sterben läßt.
Morgens noch in Schlaf und Traum
Mittags schon dahin.
Abends scho zuunterst im Grabe drin.
Die Schlacht ist unser Freudenhaus.
Von Blut ist unsere Sonne.
Tod ist unser Zeichen und Losungswort.
Weib und Kind verlassen wir –
Was gehen sie uns an?
Wenn man sich auf uns nur
Verlassen kann.
So morden wir, so morden wir.
Wir morden alle Tage
Unsre Kameraden im Totentanz.
Bruder, reck dich auf vor mir,
Bruder, deine Brust
Bruder, der du fallen und sterben mußt.
Wir murren nicht, wir knurren nicht,
Wir schweigen alle Tage,
Bis sich vom Gelenke das Hüftbein dreht.
Hart ist unsere Lagerstatt
Trocken unser Brot.
Blutig und besudelt der liebe Gott.
Wir danken dir, wir danken dir,
Herr Kaiser, für die Gnade,
Daß du uns zum Sterben erkoren hast.
Schlafe nur, schlaf sanft und still,
Bis dich auferweckt,
Unser armer Leib, den der Rasen deckt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
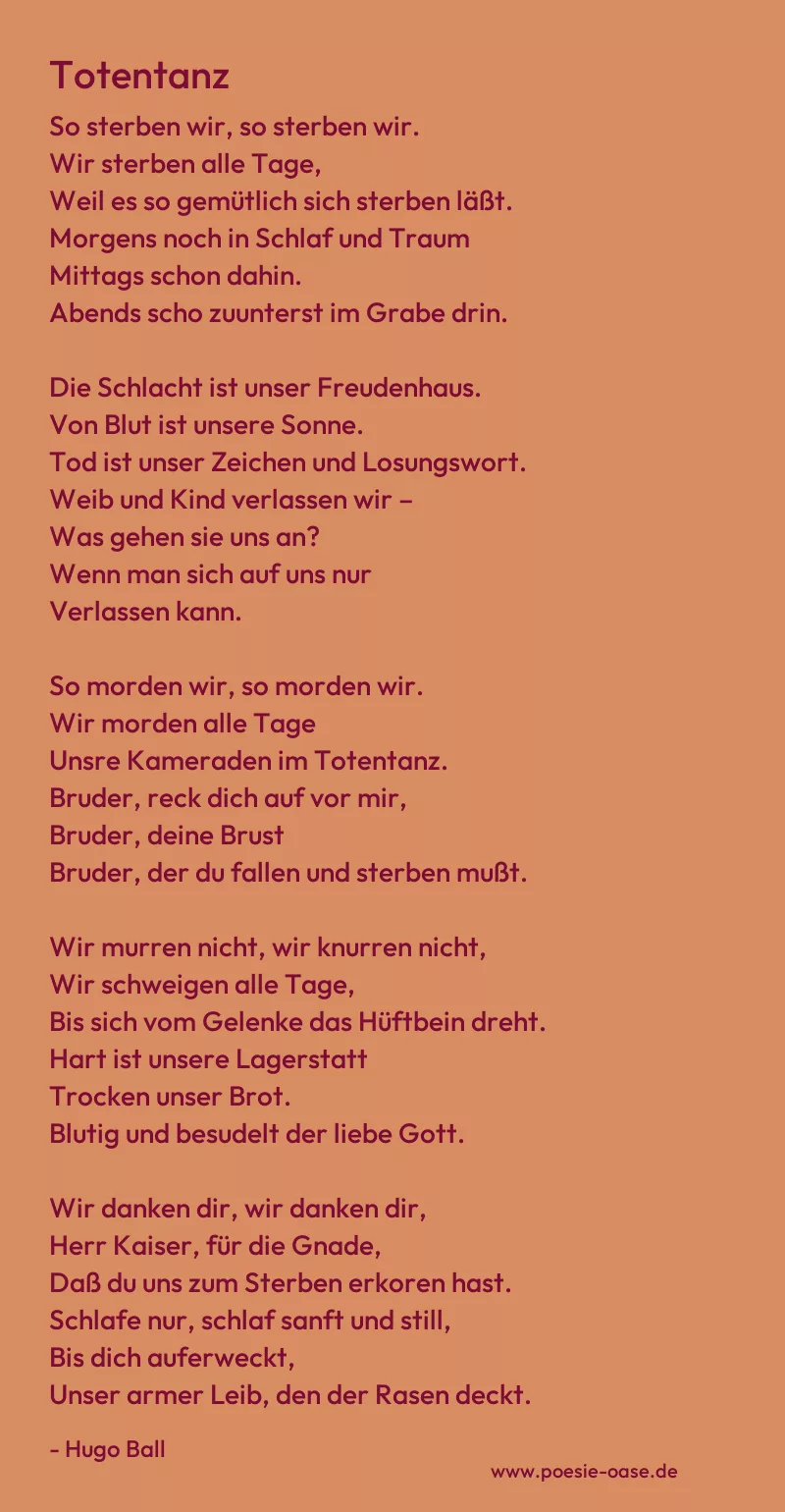
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Totentanz“ von Hugo Ball ist ein scharfes, sarkastisches Antikriegspoem, das in eindringlichen, bitteren Bildern das Sterben und Morden im Krieg als alltäglichen, beinahe mechanischen Vorgang entlarvt. In einfacher Sprache, repetitiven Strukturen und schneidender Ironie kritisiert es die Sinnlosigkeit und Brutalität des Krieges – insbesondere im Kontext des Ersten Weltkriegs, gegen dessen Grauen sich viele expressionistische Autoren wie Ball mit literarischen Mitteln wandten.
Bereits die erste Strophe führt das zentrale Motiv ein: „So sterben wir, so sterben wir.“ Der Tod wird nicht als außergewöhnliches Ereignis dargestellt, sondern als täglicher Normalzustand. Die steigernde Abfolge vom „Morgens“ bis zum „Abends“ – dem Grab – unterstreicht die Allgegenwart des Todes. Auffällig ist der zynische Ton: Es „läßt sich gemütlich sterben“, eine Formulierung, die die Abstumpfung und absurde Normalisierung des Grauens offenlegt.
In der zweiten Strophe wird die Sprache drastischer. Der Krieg wird zum „Freudenhaus“, Blut ersetzt die Sonne, und der Tod wird zum „Zeichen und Losungswort“. Hier verschmelzen die religiöse und militärische Sprache in eine blasphemische, entlarvende Anklage. Der Verlust von Weib und Kind wird lakonisch hingenommen – alles wird dem Gehorsam untergeordnet, der zur einzigen Tugend geworden ist.
Die dritte Strophe beschreibt das Morden als alltäglichen Akt, den die Soldaten an ihren eigenen „Kameraden“ vollziehen. Der „Totentanz“ ist dabei nicht nur ein Bild für den Tod, sondern auch eine Anspielung auf die groteske Choreografie des Krieges, in der die Brüder im Sinne der Vaterlandsideologie einander töten – sinnlos und entmenschlicht.
Besonders eindrücklich ist die vierte Strophe, in der die Abstumpfung in Schweigen und Leid sichtbar wird. Die Beschreibung des verwundeten Körpers („vom Gelenke das Hüftbein dreht“) und des „blutigen und besudelten“ Gottes steigert die Kritik ins Sakrilegische: Nicht nur der Mensch, auch das Göttliche ist im Krieg entweiht, beschmutzt, zerschlagen.
Die letzte Strophe richtet sich mit bitterem Sarkasmus direkt an den „Herrn Kaiser“. Der Dank für die „Gnade“ des Sterbens entlarvt die groteske Verkehrung von Opfer und Herrschaft. Die Ironie, mit der Ball hier die offizielle Kriegsrhetorik karikiert, spitzt sich zu in der Vorstellung, der tote Soldat müsse den schlafenden Herrscher einst „auferwecken“.
„Totentanz“ ist ein düsteres, zorniges Gedicht, das mit schlichten Mitteln eine tiefgreifende Kritik an Militarismus, Gehorsam und nationalistischer Kriegsverherrlichung formuliert. Hugo Ball gelingt es, durch Repetition, Ironie und radikale Bildsprache das Grauen des Krieges eindrucksvoll erfahrbar zu machen – als makabres Ritual des Verfalls, dem sich der Mensch blind unterwirft.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.