Kann die deutsche Sprache schnauben,
schnarren, poltern, donnern, krachen;
kann sie doch auch spielen, scherzen,
liebeln, kosen, tendeln, lachen
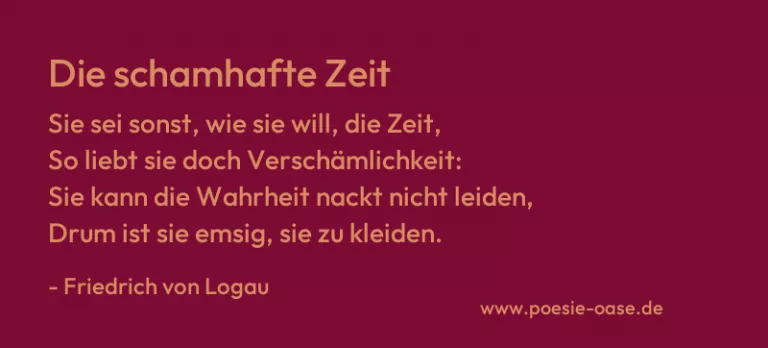
Die schamhafte Zeit
- Alltag
- Gemeinfrei
- Metaphysik & Traumwelten
Kann die deutsche Sprache schnauben,
schnarren, poltern, donnern, krachen;
kann sie doch auch spielen, scherzen,
liebeln, kosen, tendeln, lachen
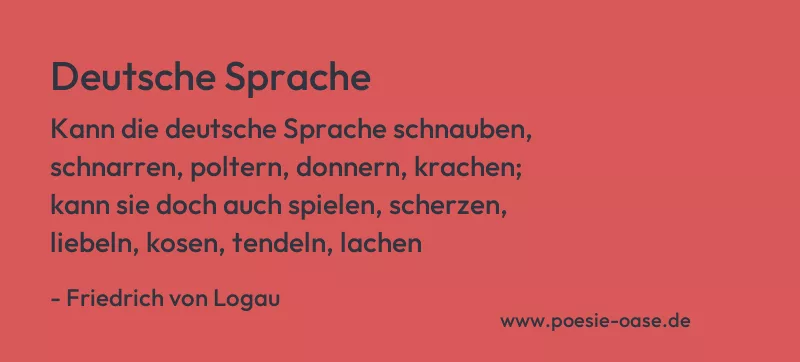
Das Gedicht „Deutsche Sprache“ von Friedrich von Logau stellt die Vielseitigkeit und Ausdruckskraft der deutschen Sprache in den Mittelpunkt. In einer kurzen, prägnanten Form wird die Bandbreite der Emotionen und Wirkungen beschrieben, die die deutsche Sprache hervorrufen kann. Die Aufzählung von Verben wie „schnauben“, „schnarren“, „poltern“, „donnern“ und „krachen“ verweist auf die rauen, kraftvollen und oft kraftvoll-akustischen Aspekte der Sprache. Diese Verben vermitteln ein Bild von Energie, Konflikt oder starker Präsenz, die die Sprache in einer intensiven, fast aggressiven Weise entfalten kann.
Doch in der zweiten Hälfte des Gedichts zeigt Logau auch die weichen, zarten und verspielten Seiten der Sprache. Verben wie „spielen“, „scherzen“, „liebeln“, „kosen“, „tendeln“ und „lachen“ bringen die sanften, freundlichen und humorvollen Aspekte der deutschen Sprache zum Ausdruck. Diese Verben symbolisieren eine Sprachwelt, die von Zuneigung, Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Der Gegensatz zwischen den beiden Bildwelten – einer kraftvollen und einer sanften – macht deutlich, wie facettenreich und ausdrucksstark die deutsche Sprache in ihrer Verwendung sein kann.
Durch diese Gegenüberstellung zeigt Logau die Flexibilität und den Reichtum der deutschen Sprache, die sowohl für raue als auch für zarte, humorvolle oder leidenschaftliche Ausdrucksweisen geeignet ist. Das Gedicht feiert damit die Vielfalt der sprachlichen Möglichkeiten und die Fähigkeit der Sprache, die unterschiedlichsten menschlichen Emotionen und Stimmungen widerzuspiegeln.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.