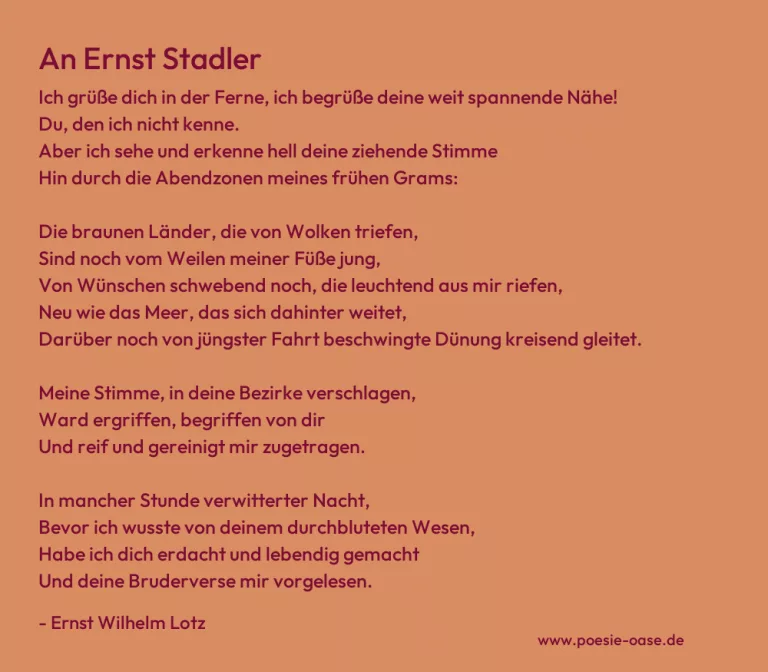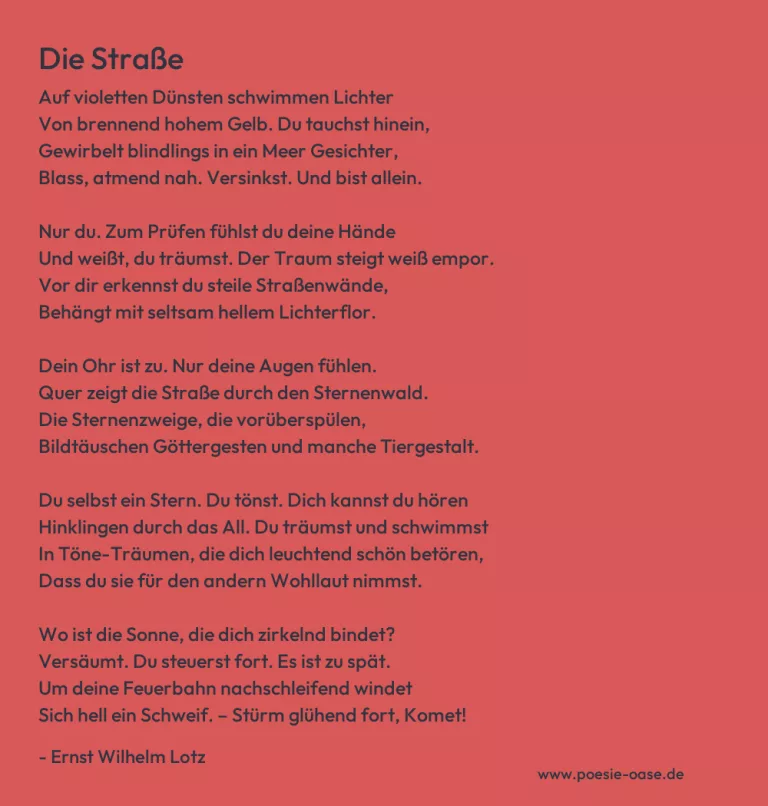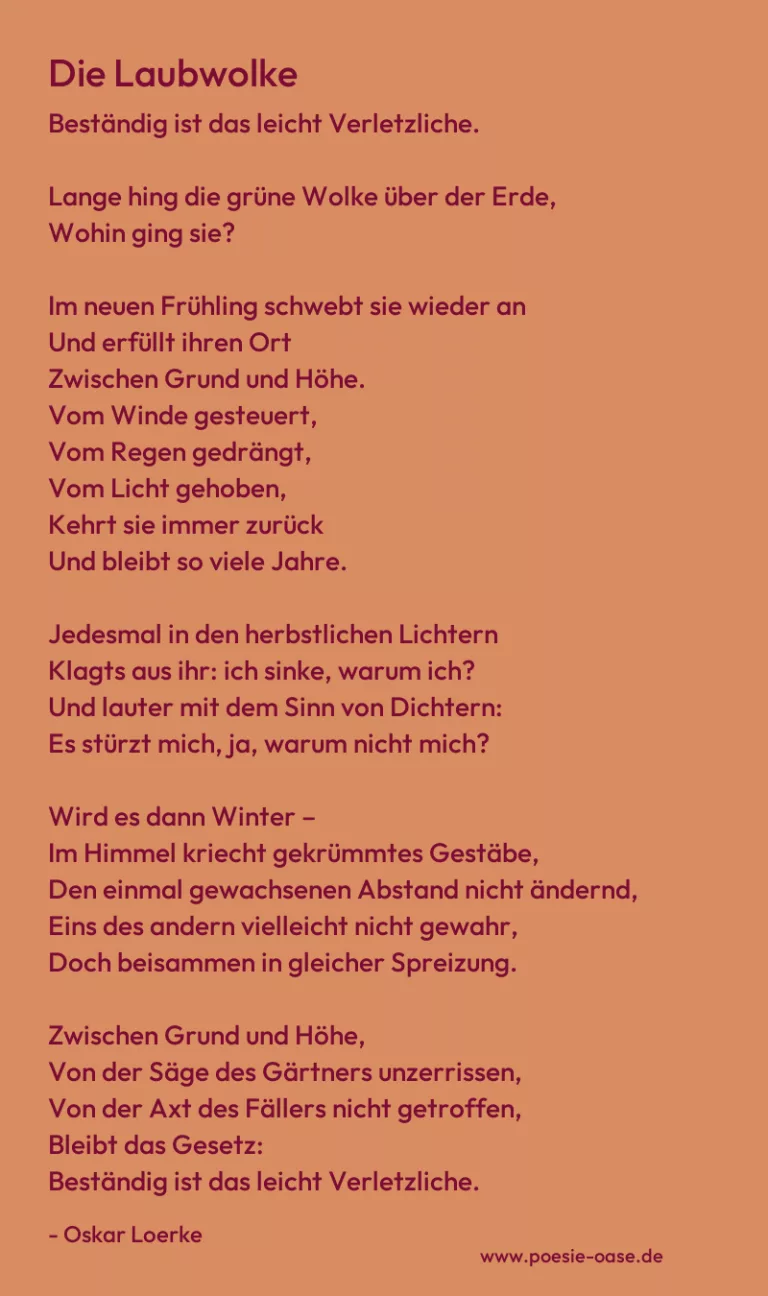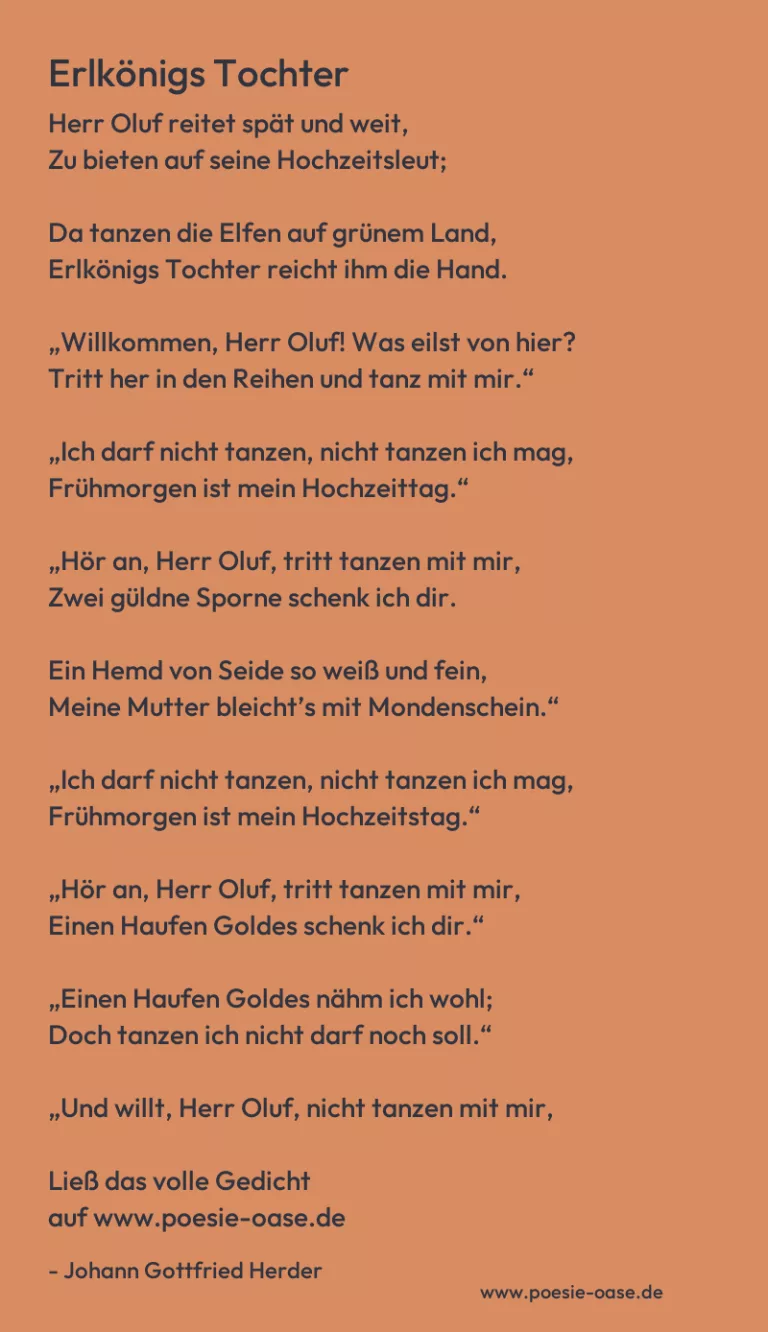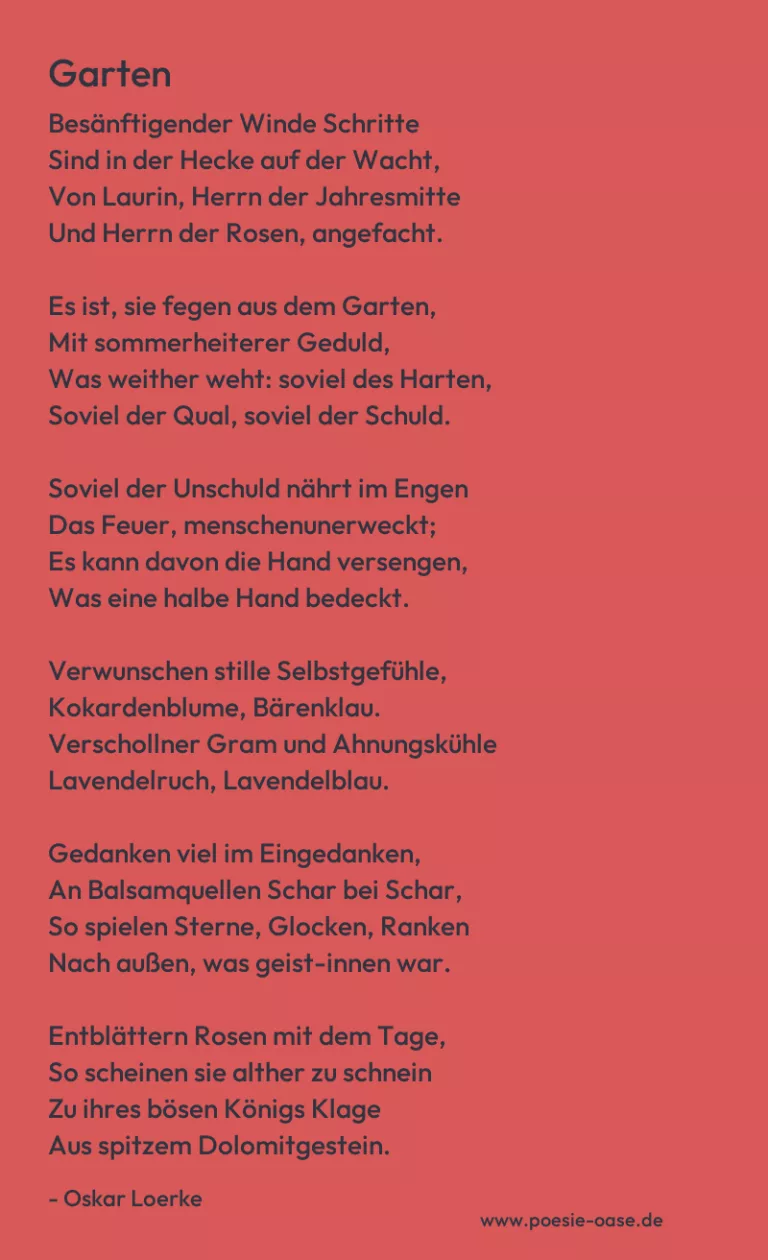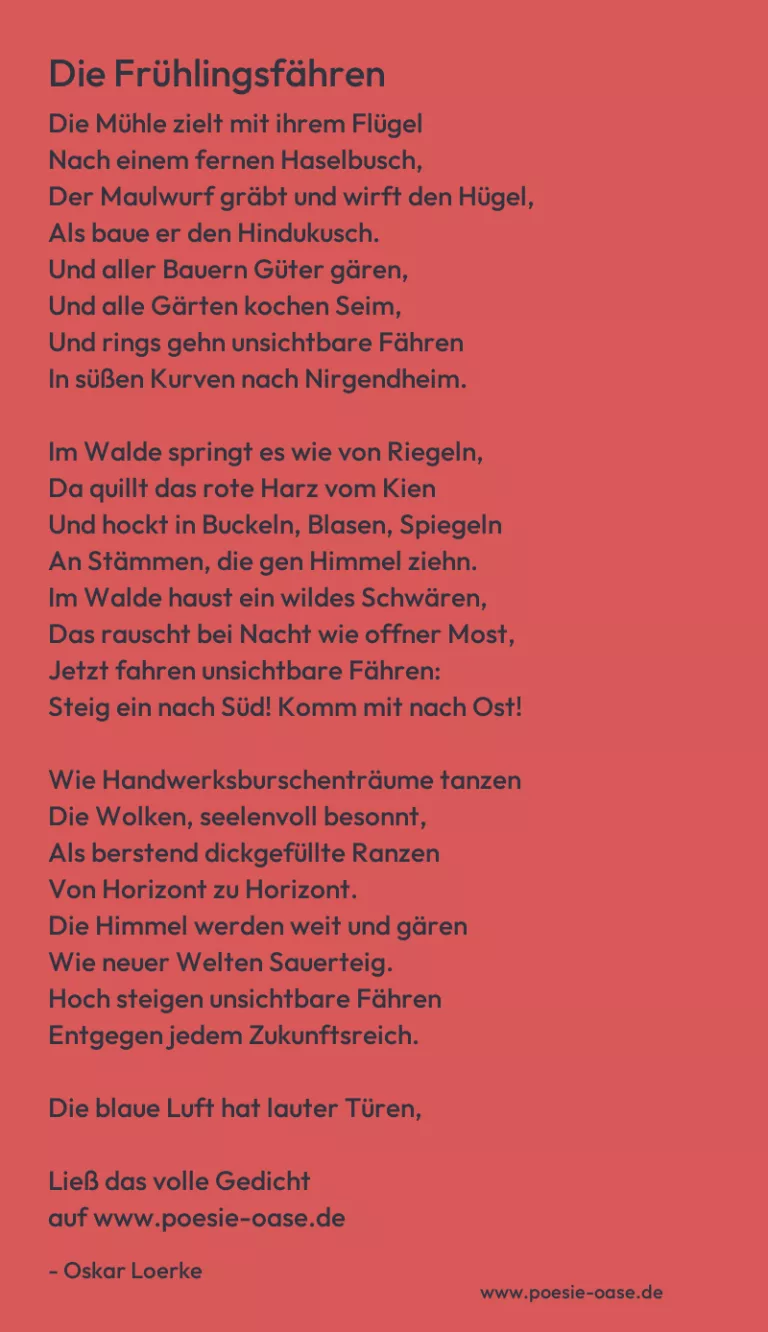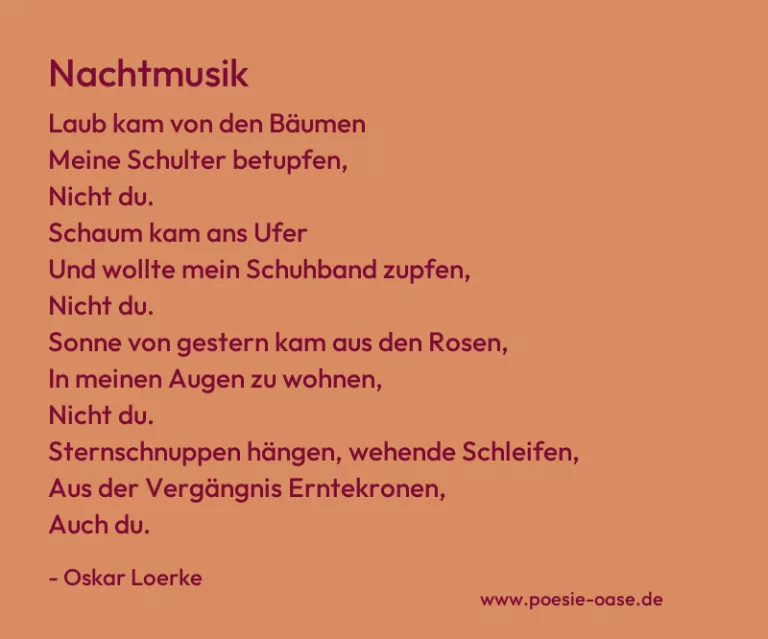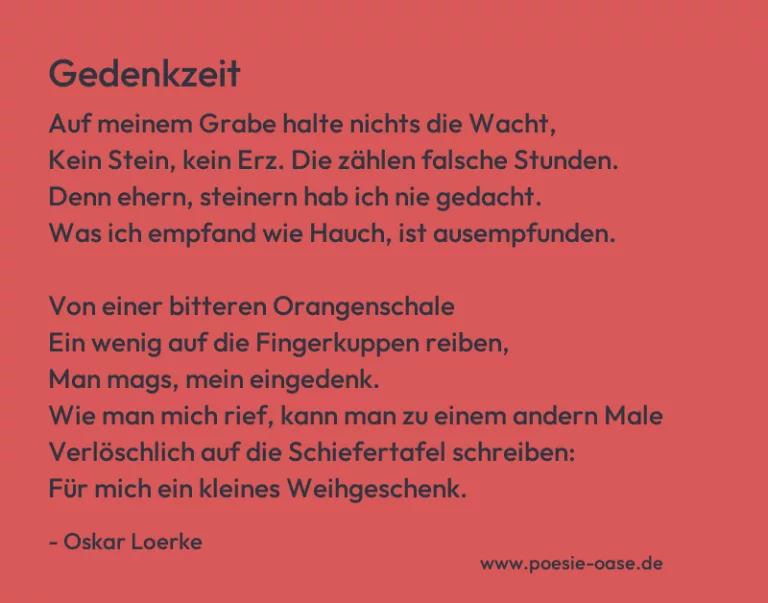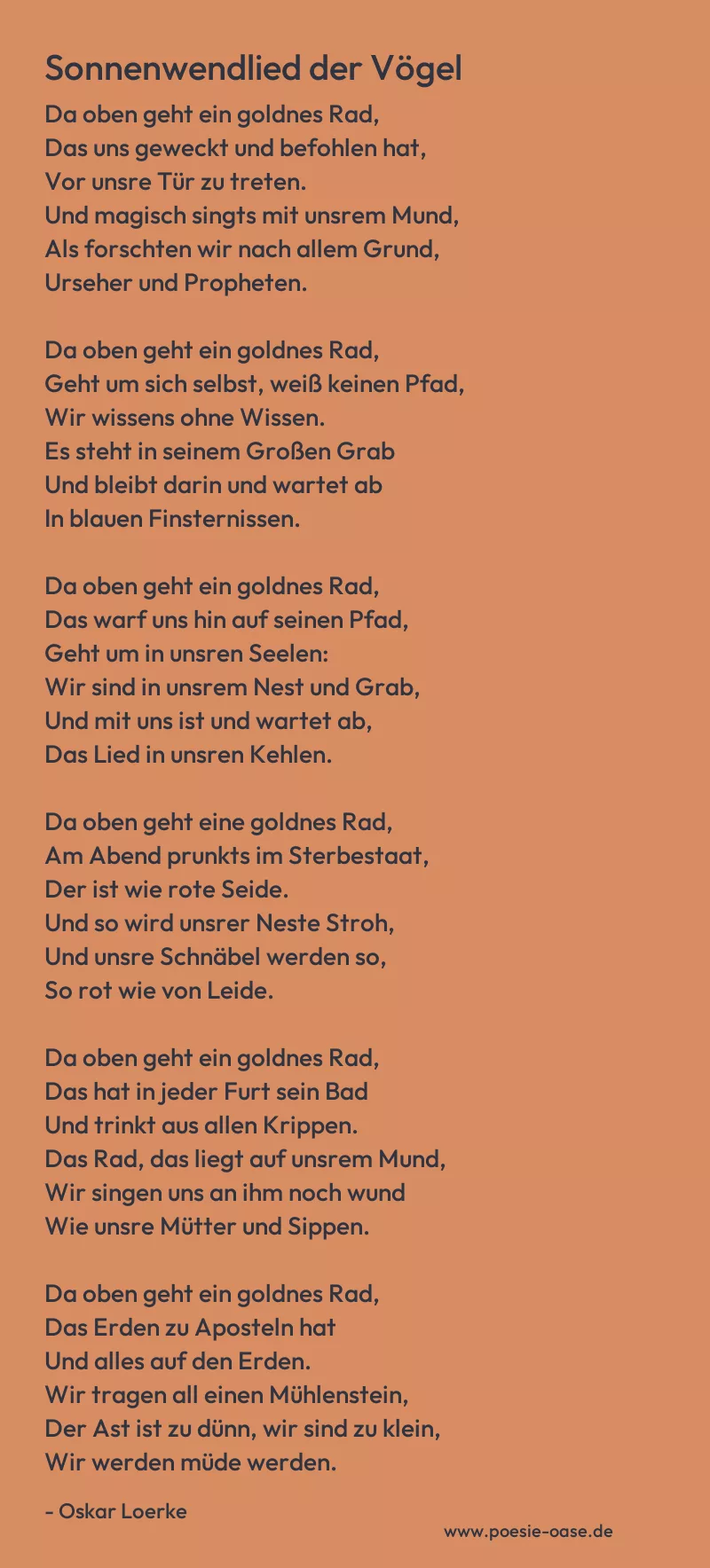Sonnenwendlied der Vögel
Da oben geht ein goldnes Rad,
Das uns geweckt und befohlen hat,
Vor unsre Tür zu treten.
Und magisch singts mit unsrem Mund,
Als forschten wir nach allem Grund,
Urseher und Propheten.
Da oben geht ein goldnes Rad,
Geht um sich selbst, weiß keinen Pfad,
Wir wissens ohne Wissen.
Es steht in seinem Großen Grab
Und bleibt darin und wartet ab
In blauen Finsternissen.
Da oben geht ein goldnes Rad,
Das warf uns hin auf seinen Pfad,
Geht um in unsren Seelen:
Wir sind in unsrem Nest und Grab,
Und mit uns ist und wartet ab,
Das Lied in unsren Kehlen.
Da oben geht eine goldnes Rad,
Am Abend prunkts im Sterbestaat,
Der ist wie rote Seide.
Und so wird unsrer Neste Stroh,
Und unsre Schnäbel werden so,
So rot wie von Leide.
Da oben geht ein goldnes Rad,
Das hat in jeder Furt sein Bad
Und trinkt aus allen Krippen.
Das Rad, das liegt auf unsrem Mund,
Wir singen uns an ihm noch wund
Wie unsre Mütter und Sippen.
Da oben geht ein goldnes Rad,
Das Erden zu Aposteln hat
Und alles auf den Erden.
Wir tragen all einen Mühlenstein,
Der Ast ist zu dünn, wir sind zu klein,
Wir werden müde werden.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
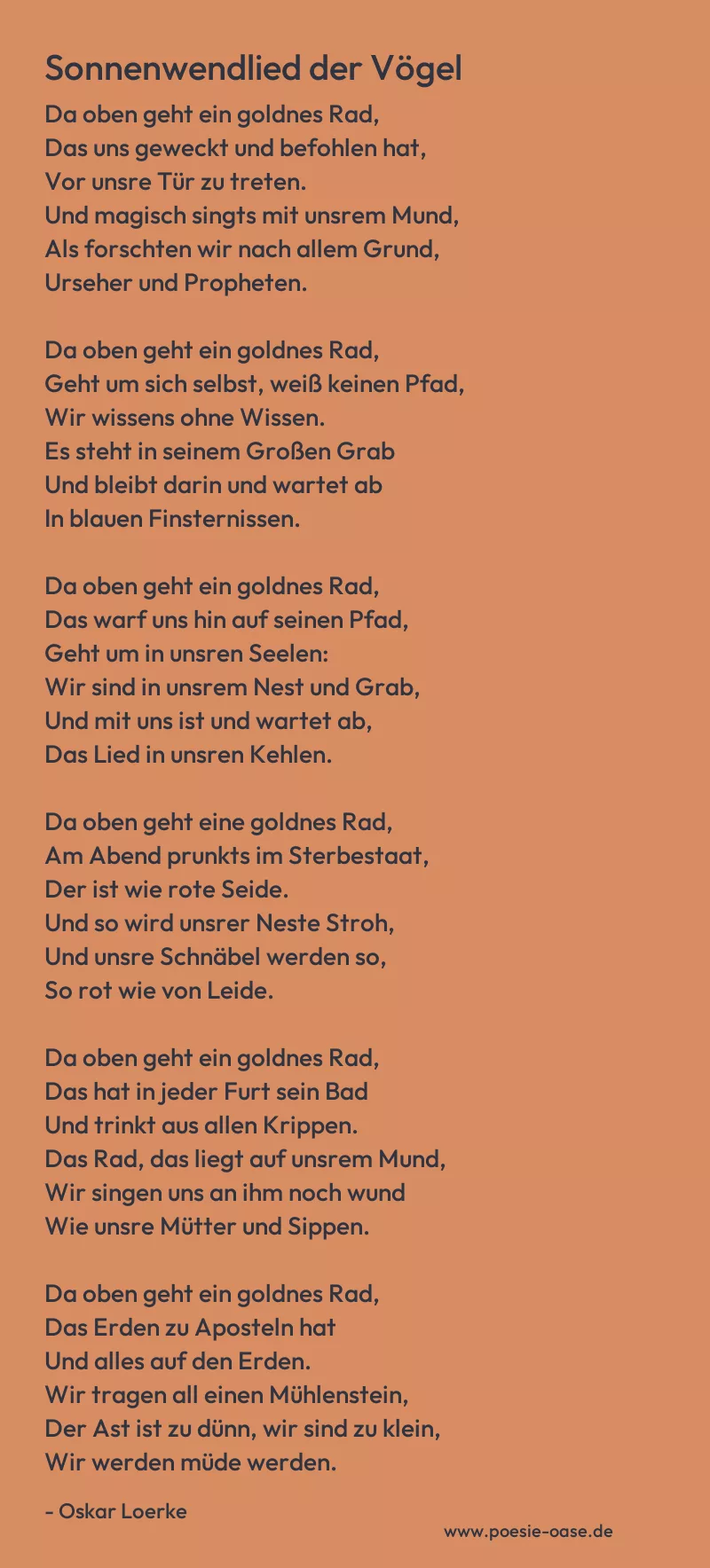
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Sonnenwendlied der Vögel“ von Oskar Loerke ist ein symbolisch aufgeladenes und musikalisch rhythmisierendes Natur- und Weltgedicht, das die Sonne – in der metaphorischen Gestalt eines „goldnen Rads“ – mit der Daseinserfahrung der Vögel verknüpft. Dabei entsteht ein tiefsinniger Dialog zwischen kosmischer Ordnung und irdischem Leben, zwischen Schöpfung, Gesang und existenzieller Müdigkeit.
Die wiederkehrende Zeile „Da oben geht ein goldnes Rad“ fungiert als Refrain und stellt das zentrale Symbol des Gedichts dar. Es steht für die Sonne, die als zyklisch wiederkehrende Macht über Leben, Zeit und Bewusstsein thront. Die Vögel – poetisch vermenschlicht – begreifen sich als geweckt, ja geradezu beauftragt vom Sonnenlicht zu singen, und verleihen in ihren Liedern eine prophetische Stimme dem Kosmos. In dieser Perspektive werden sie zu „Ursehern und Propheten“, ihre Lieder klingen wie Suche nach dem „Grund“ allen Seins.
Gleichzeitig bleibt das goldene Rad ein Mysterium: Es „weiß keinen Pfad“, bewegt sich in „blauen Finsternissen“, bleibt in einem „Großen Grab“ – eine paradoxale Verbindung von Licht und Tod. Diese scheinbare Gegensätzlichkeit durchzieht das gesamte Gedicht. Die Sonne ist Leben und Grab zugleich, Aufbruch und Verhängnis. Auch in den Vögeln lebt dieser Widerspruch: Ihr Gesang ist inspiriert und schön, aber auch mühsam, schmerzhaft, von Melancholie durchzogen. Das Bild ihrer „roten Schnäbel“ wie „von Leide“ lässt die Schönheit der Dämmerung mit Schmerz und Vergänglichkeit verschmelzen.
In der vorletzten Strophe nimmt das Gedicht eine mythischere Wendung: Die Sonne wird zur allgegenwärtigen Gottheit, die in allen Wassern badet und aus jeder Quelle trinkt – sie durchdringt alles Leben. Der Gesang der Vögel, der einst Ausdruck von Lebenskraft war, wird nun als ermüdend beschrieben. Die Vorstellung, dass das Rad auf ihrem „Mund liegt“, unterstreicht die Last, unter der sie singen: Es ist nicht nur Freude, sondern auch Pflicht, etwas Ererbtes, beinahe Schicksalhaftes.
Die letzte Strophe mündet in eine resignative Erkenntnis: Die Vögel tragen eine Bürde, symbolisiert durch den „Mühlenstein“. Die Welt ist zu schwer für ihre kleinen Körper, ihre Stimmen ermüden. Damit endet das Gedicht in einer leisen Klage über die Begrenztheit des irdischen Seins, trotz aller Erhabenheit des kosmischen Geschehens. „Sonnenwendlied der Vögel“ ist so nicht nur ein Naturgedicht, sondern eine existenzielle Meditation über das Verhältnis von Natur, Zeit und Gesang als Ausdruck des Lebenswillens – aber auch seiner Endlichkeit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.