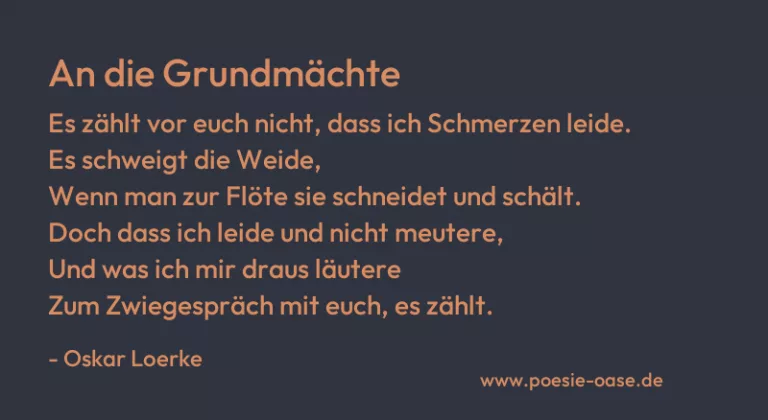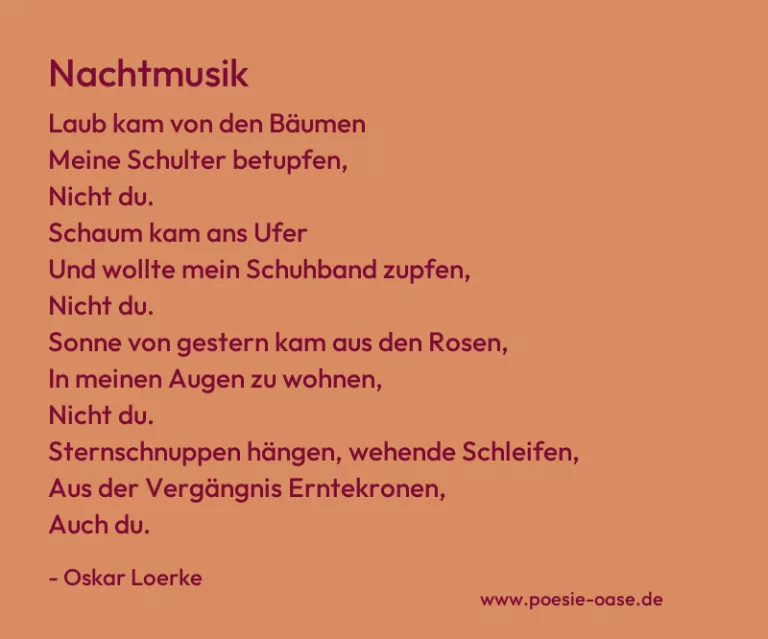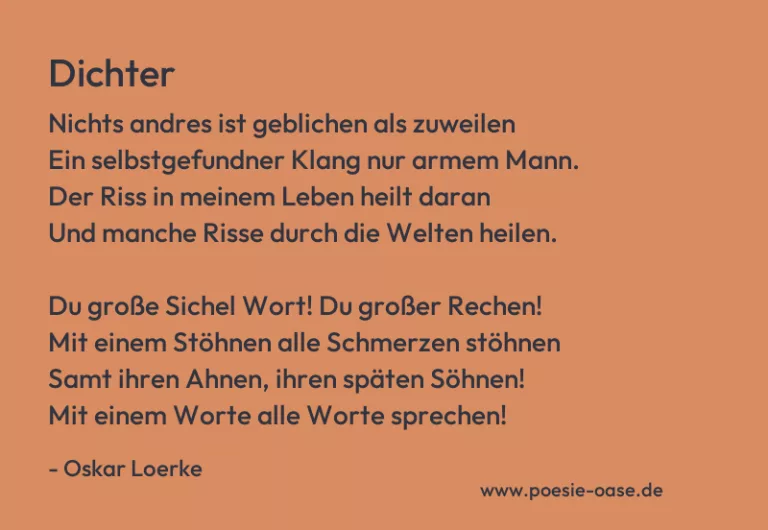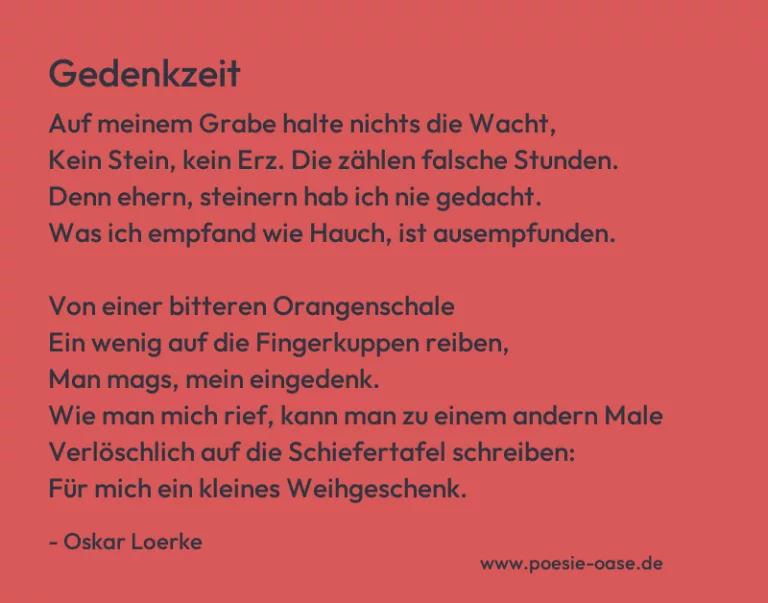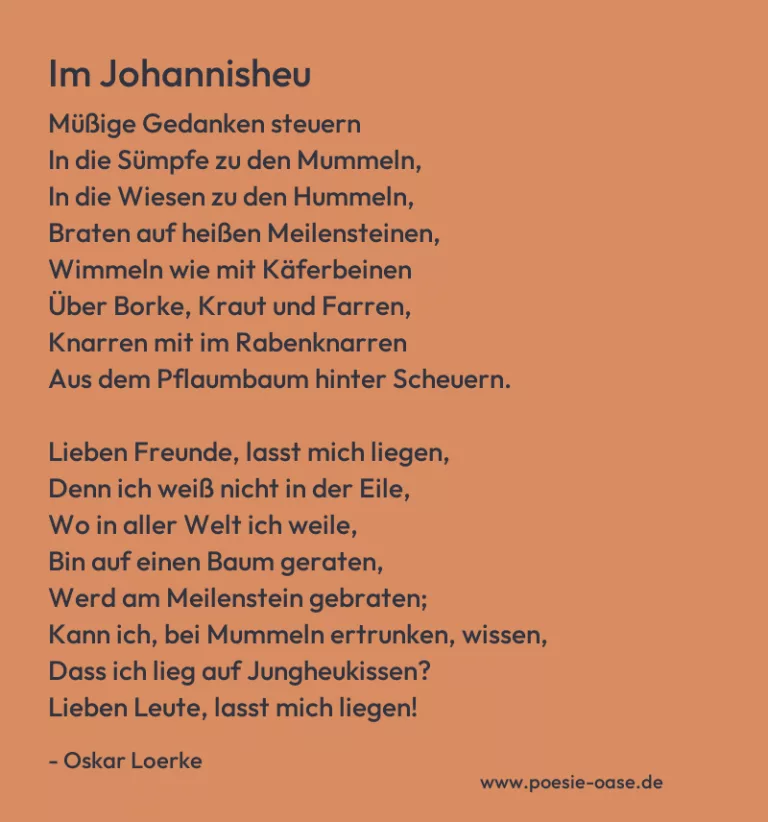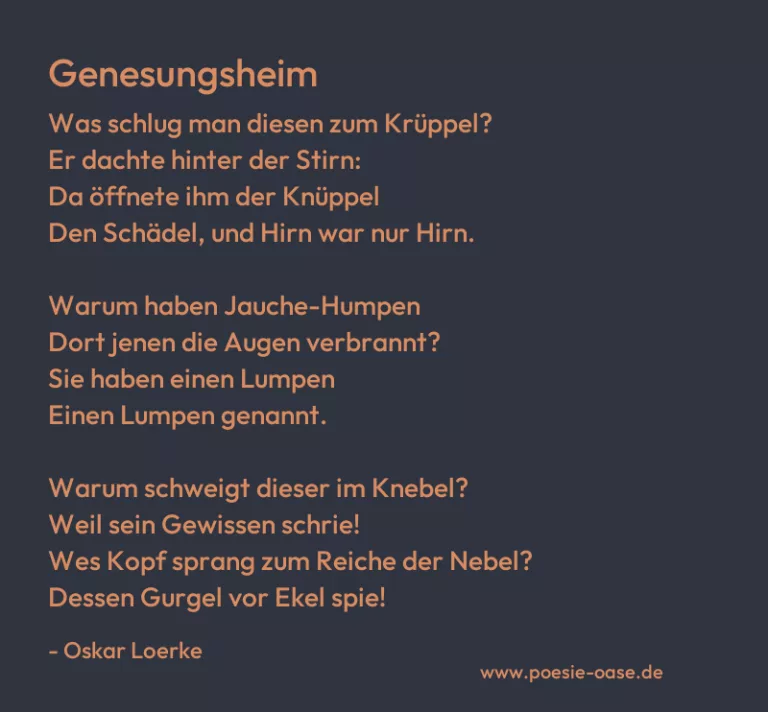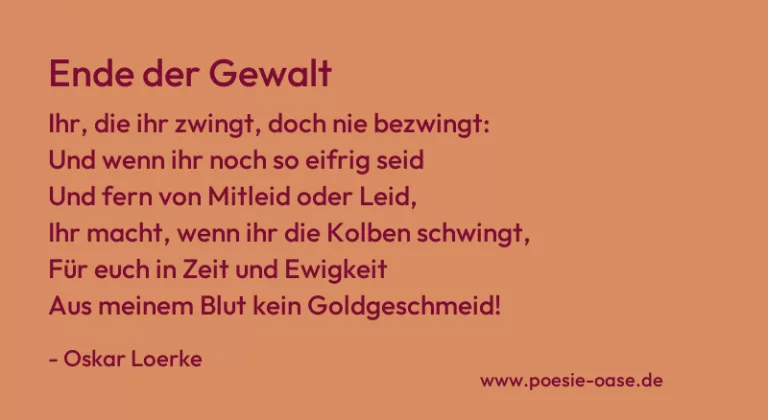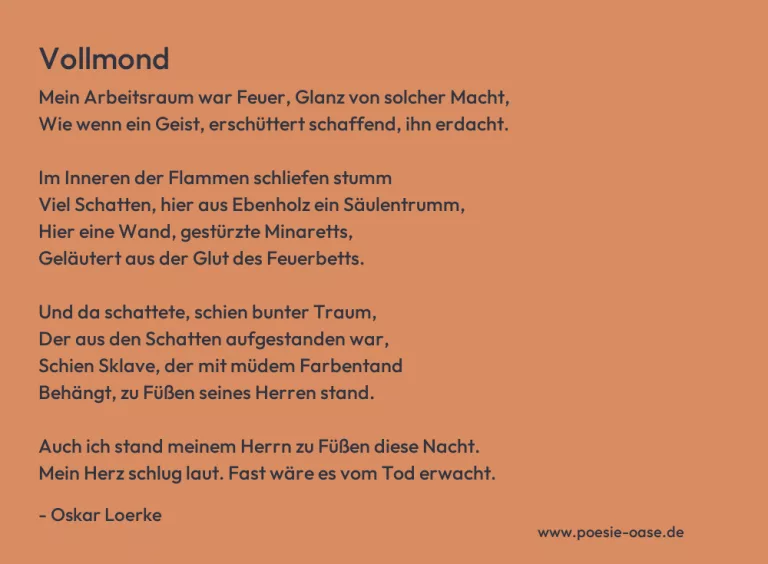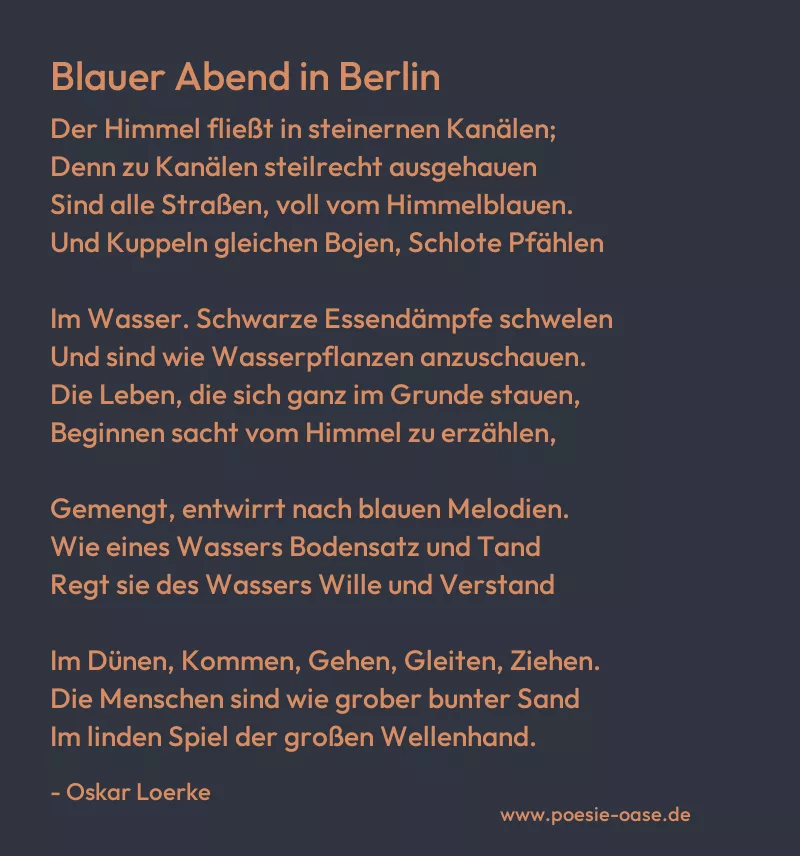Blauer Abend in Berlin
Der Himmel fließt in steinernen Kanälen;
Denn zu Kanälen steilrecht ausgehauen
Sind alle Straßen, voll vom Himmelblauen.
Und Kuppeln gleichen Bojen, Schlote Pfählen
Im Wasser. Schwarze Essendämpfe schwelen
Und sind wie Wasserpflanzen anzuschauen.
Die Leben, die sich ganz im Grunde stauen,
Beginnen sacht vom Himmel zu erzählen,
Gemengt, entwirrt nach blauen Melodien.
Wie eines Wassers Bodensatz und Tand
Regt sie des Wassers Wille und Verstand
Im Dünen, Kommen, Gehen, Gleiten, Ziehen.
Die Menschen sind wie grober bunter Sand
Im linden Spiel der großen Wellenhand.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
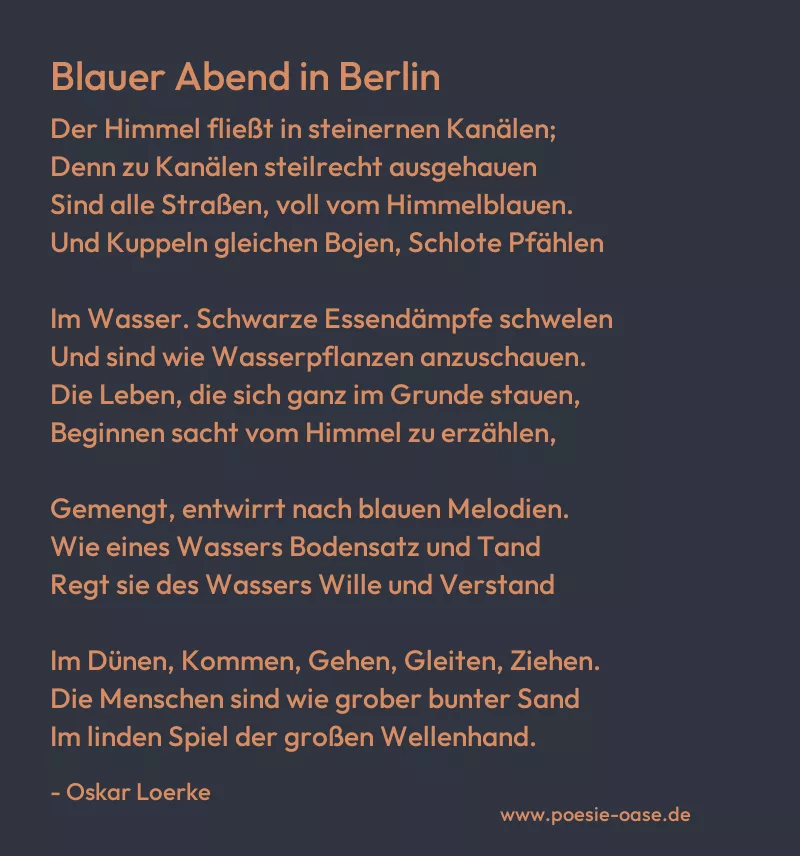
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Blauer Abend in Berlin“ von Oskar Loerke zeichnet ein eindrucksvolles Bild der Stadt Berlin und ihrer Verwandlung in ein surreales, fast poetisches Element der Natur. Zu Beginn wird der Himmel als fließend dargestellt, der sich in „steinernen Kanälen“ bewegt – eine Metapher für die Straßen der Stadt, die schmal und steil wie Kanäle verlaufen und das Blau des Himmels widerspiegeln. Diese Bildsprache verbindet die Natur mit der urbanen Umgebung und lässt die Stadt fast wie ein lebendiges, fließendes Gewässer erscheinen. Die Kuppeln, die wie Bojen und die Schornsteine, die wie Pfähle im Wasser wirken, verstärken diese Assoziation, indem sie die Architektur Berlins in eine symbolische Landschaft verwandeln.
Das Bild der „schwarzen Essendämpfe“, die „wie Wasserpflanzen anzuschauen“ sind, bringt eine düstere, fast mystische Atmosphäre in das Gedicht. Diese Dämpfe, die sich mit den fließenden Bildern des Himmels und des Wassers vermengen, stehen in starkem Kontrast zur belebten, konkreten Welt der Stadt und wecken Assoziationen von Vergänglichkeit und Auflösung. Das Gedicht suggeriert, dass das städtische Leben, das sich in den Straßen und Gebäuden abspielt, in einer Art fließender, unaufhaltsamer Bewegung ist, ähnlich dem Wasser, das ständig in Bewegung und Veränderung begriffen ist.
In der zweiten Strophe wird das Bild des „Bodensatzes“ und „Tand“ verwendet, um die Menschen und ihre Aktivitäten als Teil eines größeren Ganzen darzustellen. Sie sind wie der „Bodensatz“ des Wassers, der durch den „Wille und Verstand“ des Wassers – oder des Lebens und der Stadt – bewegt wird. Diese Metapher zeigt, wie der Einzelne in die große, kollektive Bewegung der Stadt eingebunden ist, in der das persönliche Leben mit den Geschichten und Ereignissen der Stadt verwoben ist. Der Gedichtaufbau suggeriert, dass die Stadt und ihre Menschen von einer größeren, unsichtbaren Kraft gelenkt werden, die sie in ihren eigenen Rhythmus und Fluss zieht.
Im letzten Vers wird das Bild des „groben bunten Sands“ und der „Wellenhand“ des Wassers genutzt, um das lebendige, aber chaotische Zusammenspiel von Menschen und Stadt darzustellen. Die Menschen werden hier mit „bunter Sand“ verglichen, was ihre Vielseitigkeit und gleichzeitig ihre Zerbrechlichkeit betont. Sie sind Teil eines „lindern Spiels“ – einer Bewegung, die sowohl sanft als auch unaufhaltsam ist. Diese Wellenhand, die die Menschen durch das städtische Leben zieht, symbolisiert die Kraft der Zeit und des Schicksals, die auch die Individualität und die Geschichte einer Stadt formen.
Loerke verwandelt in diesem Gedicht die urbane Landschaft Berlins in ein poetisches, fast traumhaftes Bild, in dem der Mensch, die Architektur und die Natur miteinander verschmelzen. Durch die Verwendung von Wasser- und Naturmetaphern zeigt er die ständige Veränderung und die fließende, oft unvorhersehbare Bewegung des Lebens in der Stadt, die von der unaufhaltsamen Zeit bestimmt wird. Das Gedicht hebt die Schönheit und die Flüchtigkeit dieser Bewegung hervor, während es gleichzeitig die Anonymität und das Chaos des modernen städtischen Lebens in den Vordergrund stellt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.