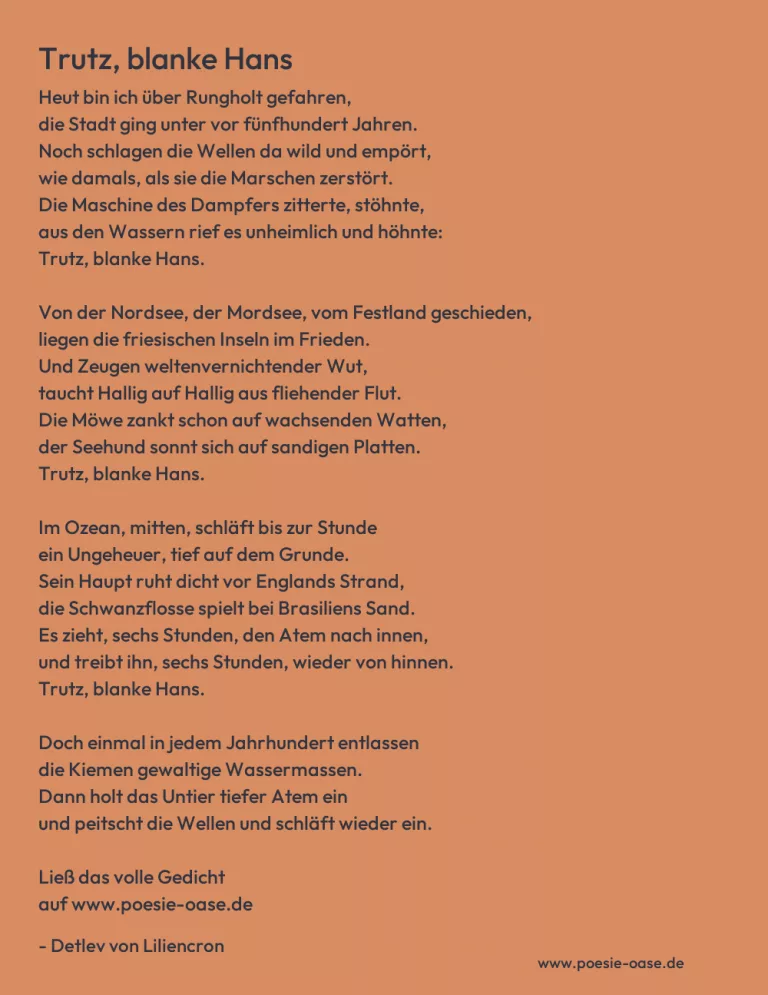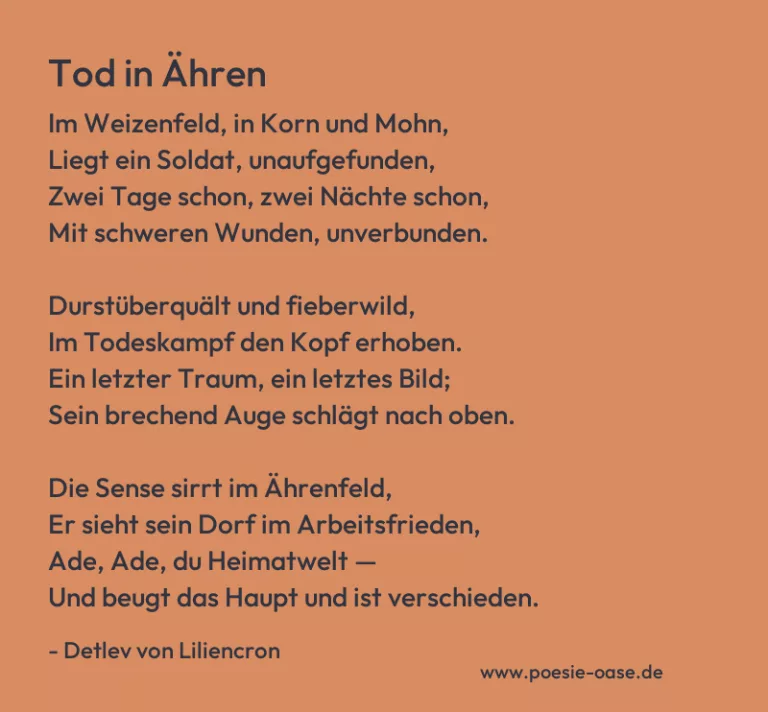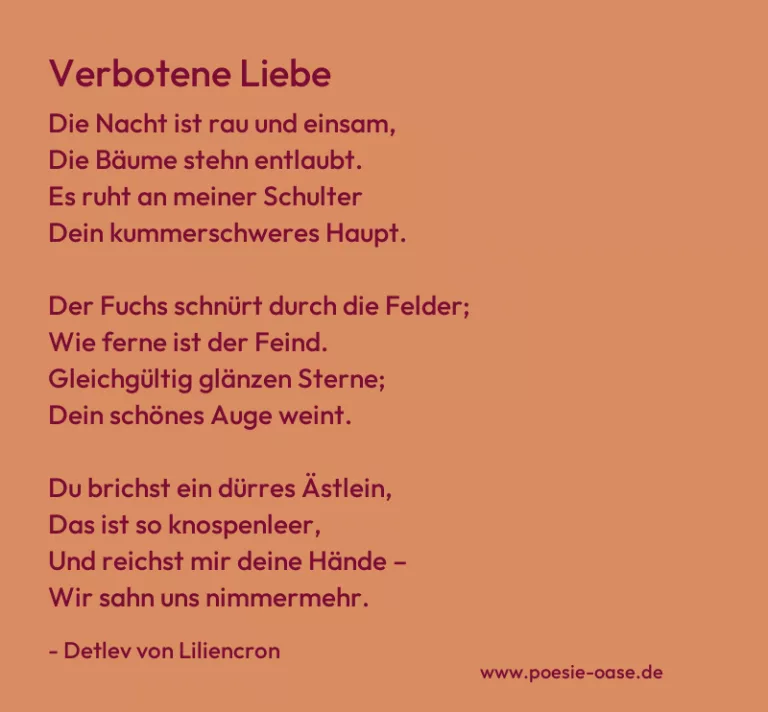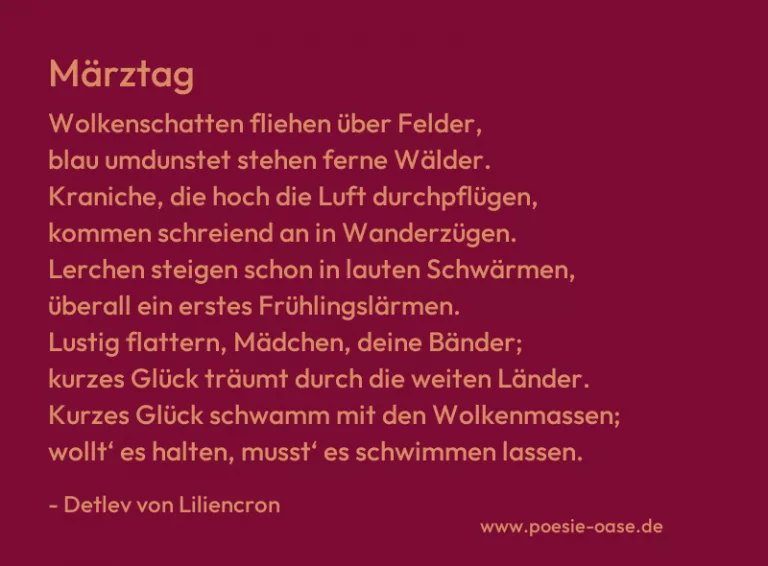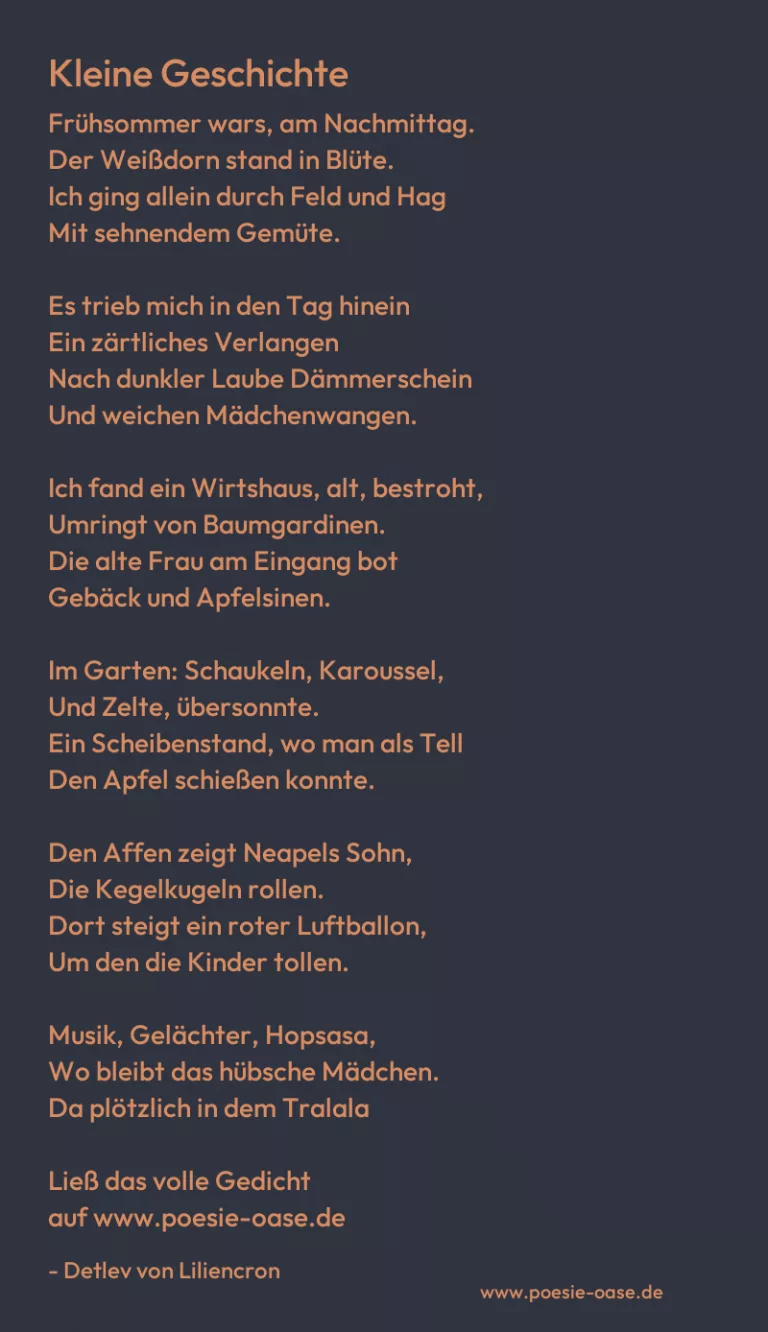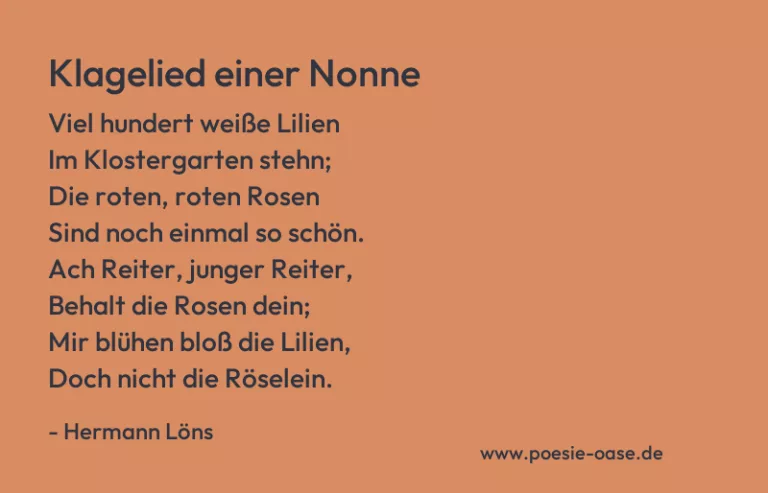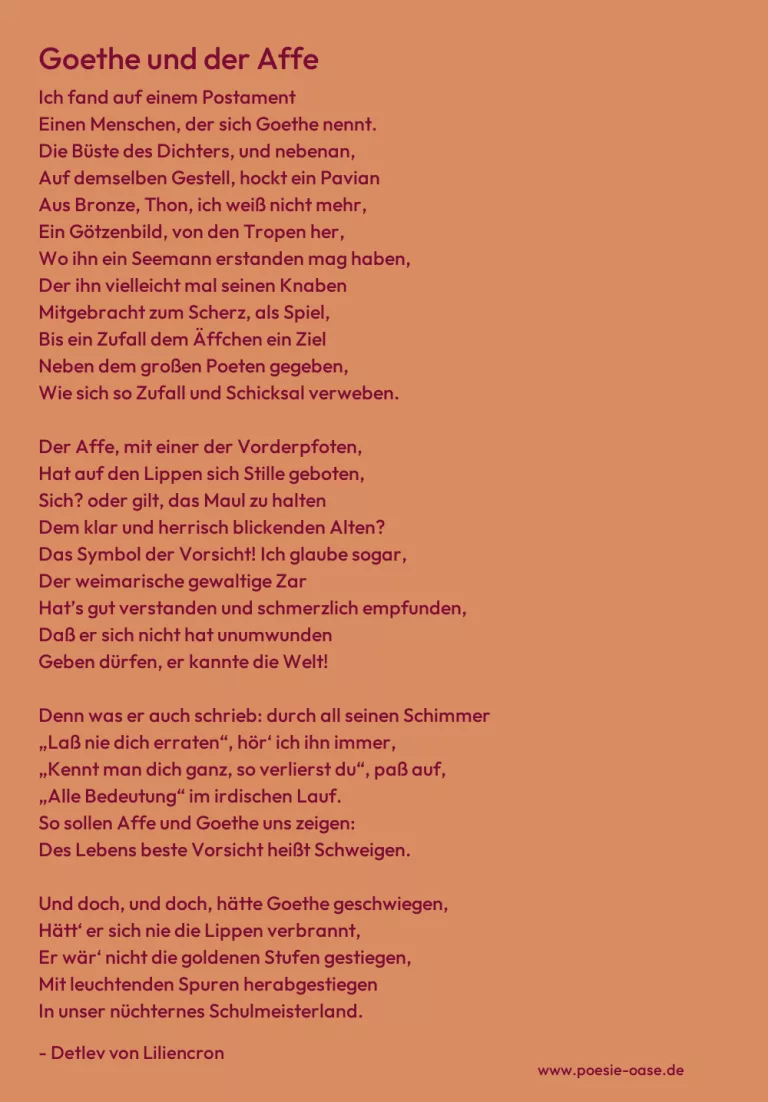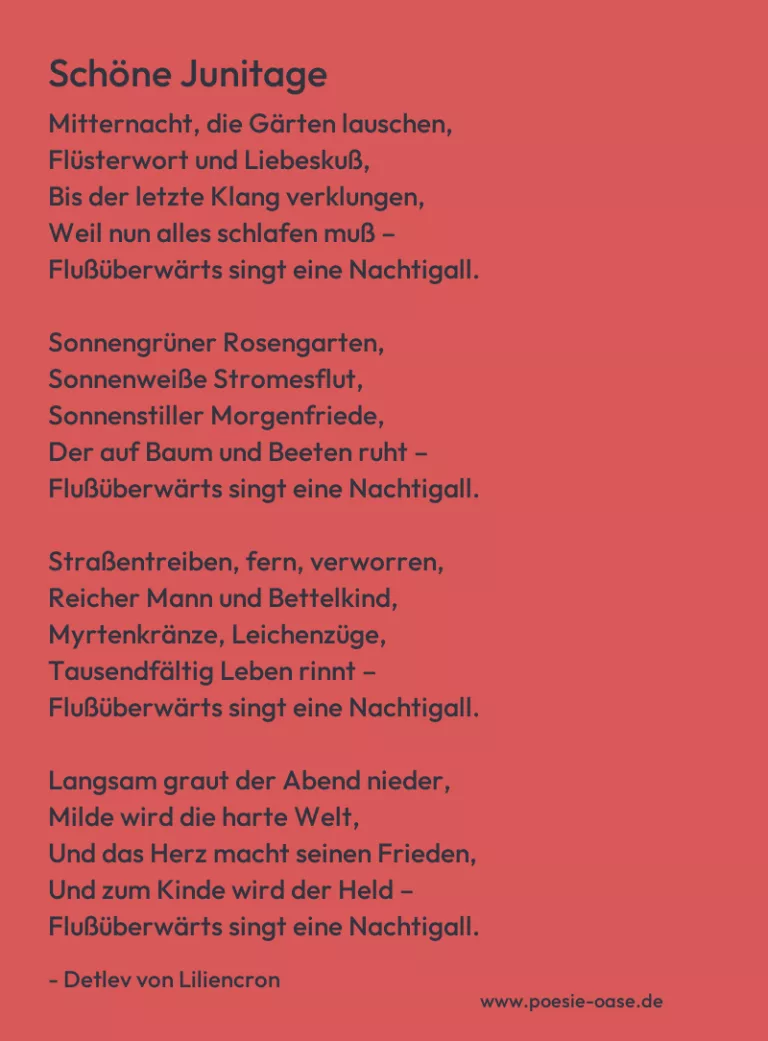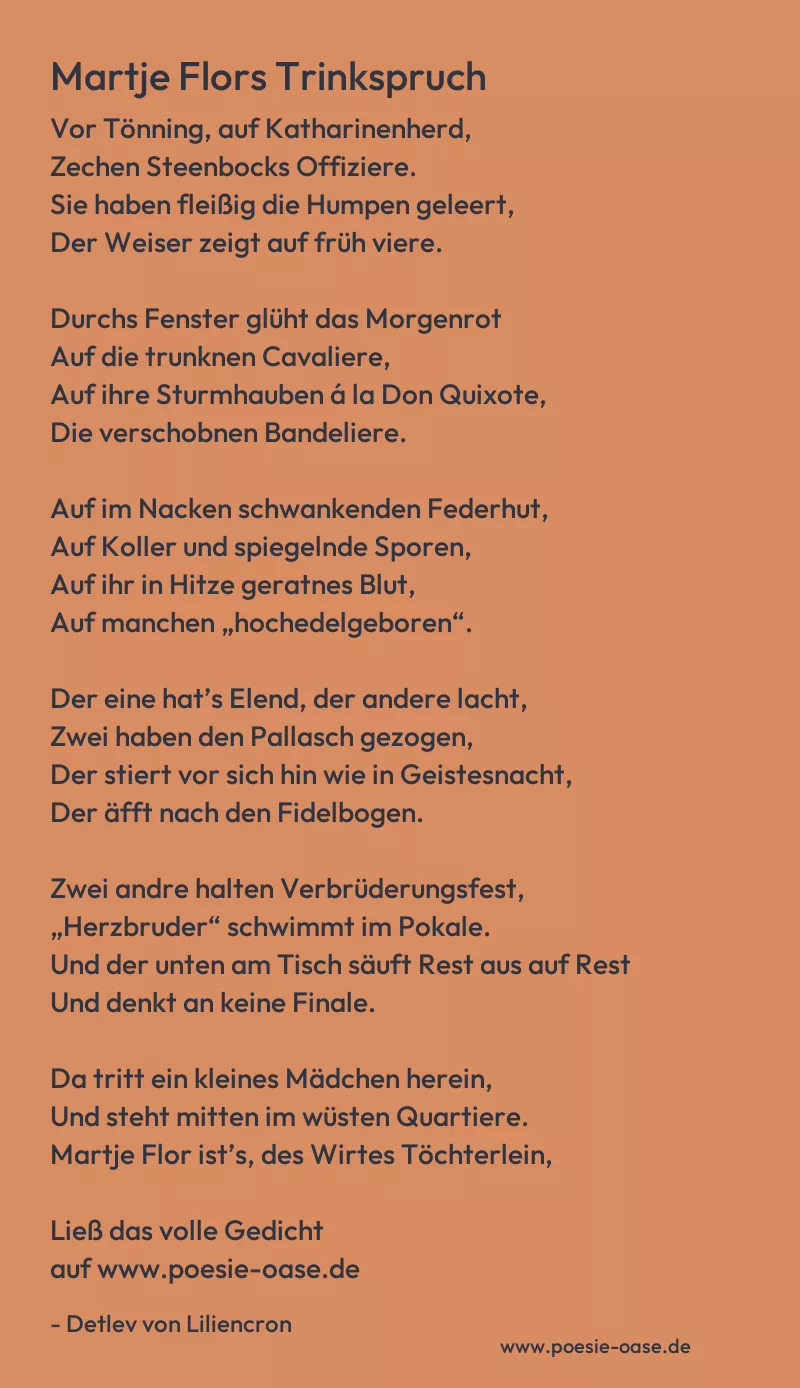Vor Tönning, auf Katharinenherd,
Zechen Steenbocks Offiziere.
Sie haben fleißig die Humpen geleert,
Der Weiser zeigt auf früh viere.
Durchs Fenster glüht das Morgenrot
Auf die trunknen Cavaliere,
Auf ihre Sturmhauben á la Don Quixote,
Die verschobnen Bandeliere.
Auf im Nacken schwankenden Federhut,
Auf Koller und spiegelnde Sporen,
Auf ihr in Hitze geratnes Blut,
Auf manchen „hochedelgeboren“.
Der eine hat’s Elend, der andere lacht,
Zwei haben den Pallasch gezogen,
Der stiert vor sich hin wie in Geistesnacht,
Der äfft nach den Fidelbogen.
Zwei andre halten Verbrüderungsfest,
„Herzbruder“ schwimmt im Pokale.
Und der unten am Tisch säuft Rest aus auf Rest
Und denkt an keine Finale.
Da tritt ein kleines Mädchen herein,
Und steht mitten im wüsten Quartiere.
Martje Flor ist’s, des Wirtes Töchterlein,
Zehn Jahr‘ nach dem Taufpapiere.
Sie nimmt das erste beste Glas
Und hebt sich auf die Zehe:
„Auf daß es im Alter, ich trink euch das,
Im Alter uns wohlergehe“.
Mit weit offnem Munde, mit bleichem Gesicht
Steht die ganze besoffne Bande
Und starrt entsetzt und rührt sich nicht,
Und steht wie am Abgrundsrande. –
In Schleswig denken sie heut noch erbost
An die schwedschen Klauen und Klingen
Und denken dankbar an Martjes Toast,
Wenn sie die Becher schwingen.