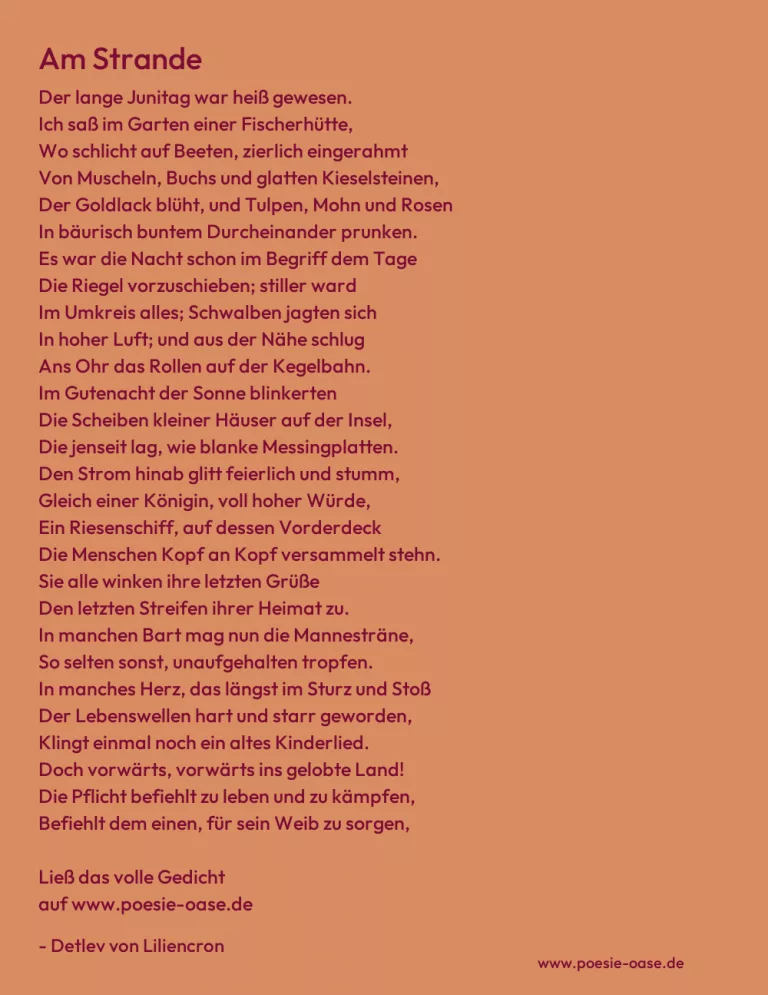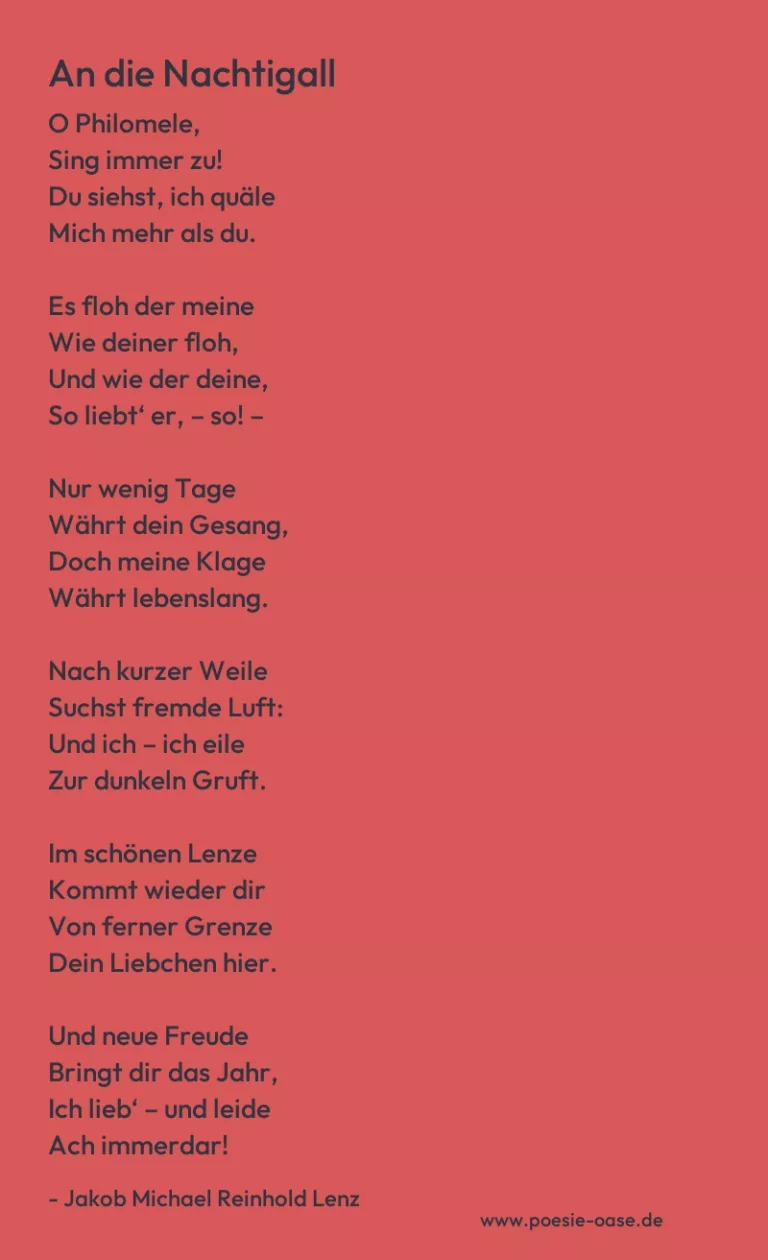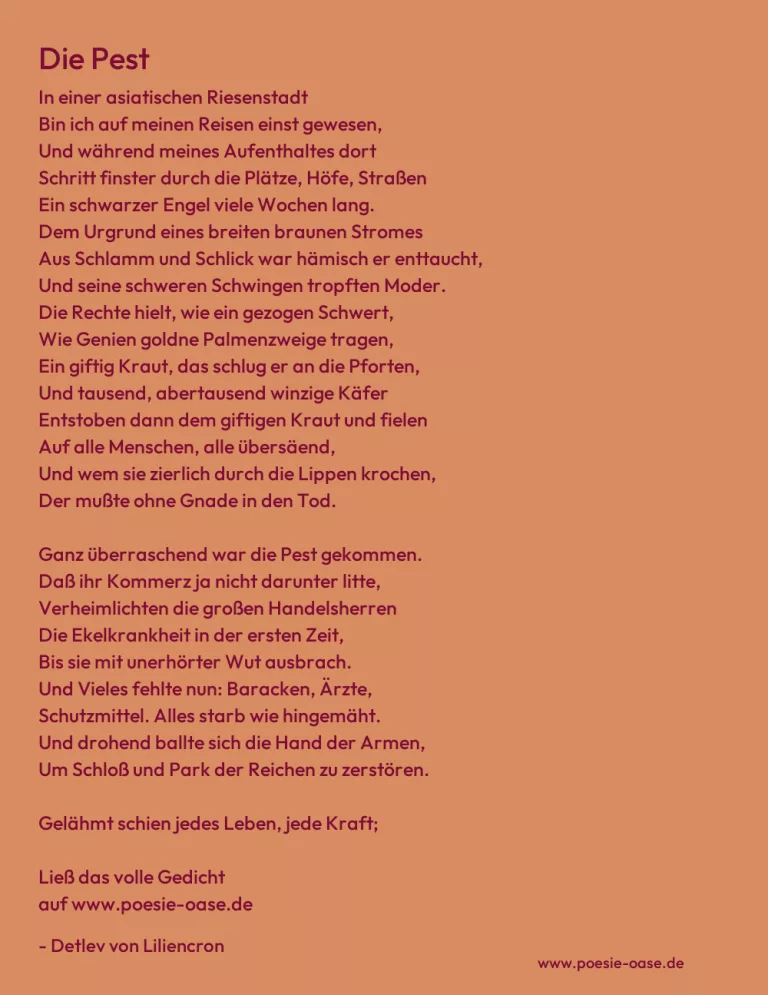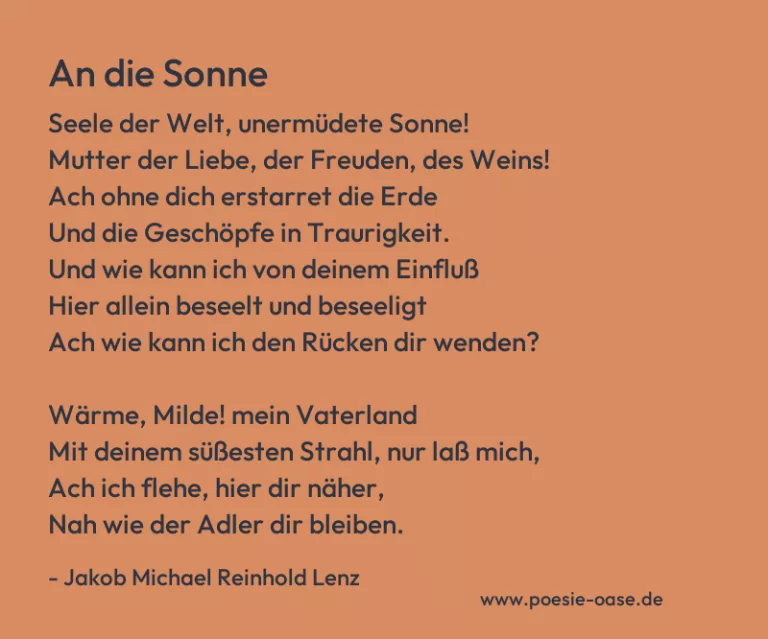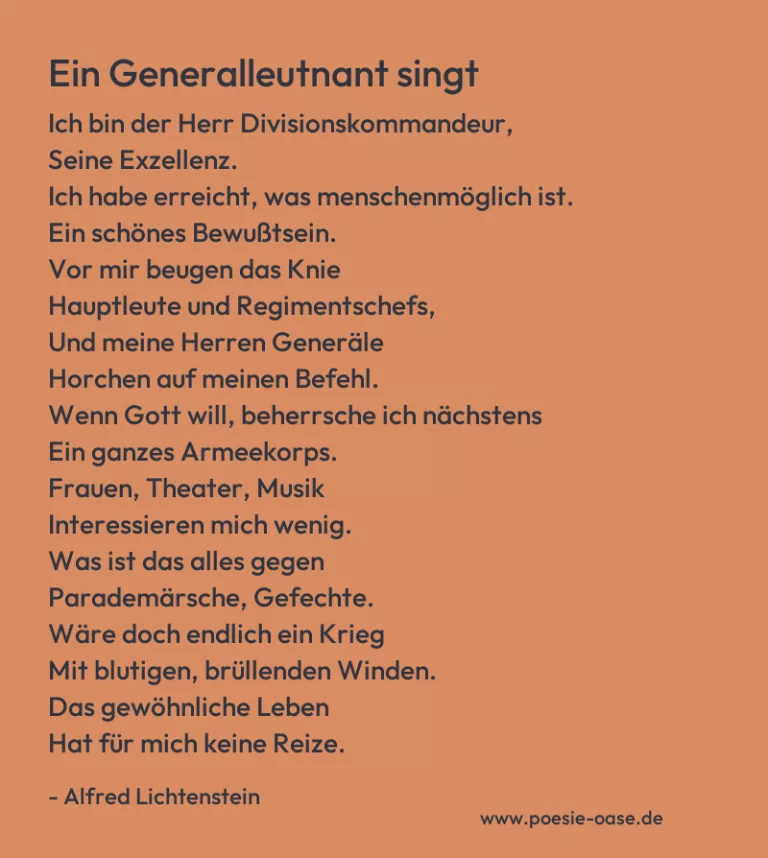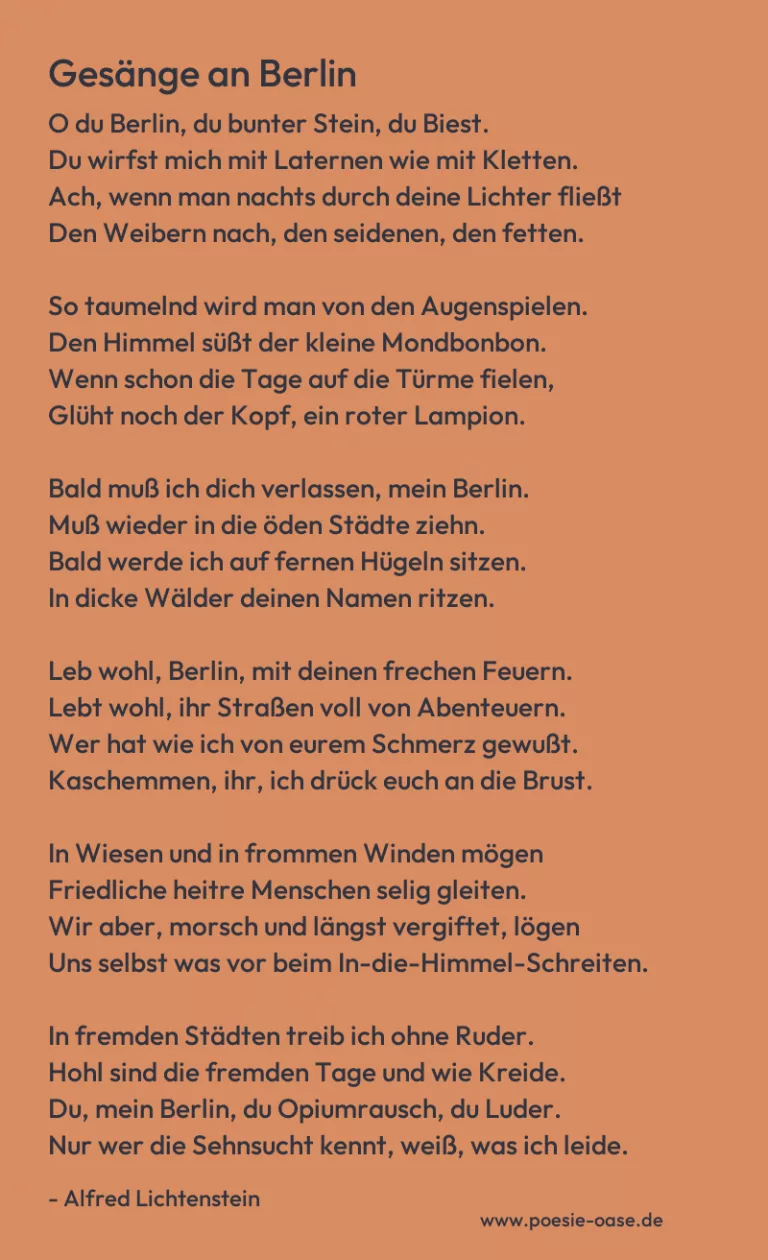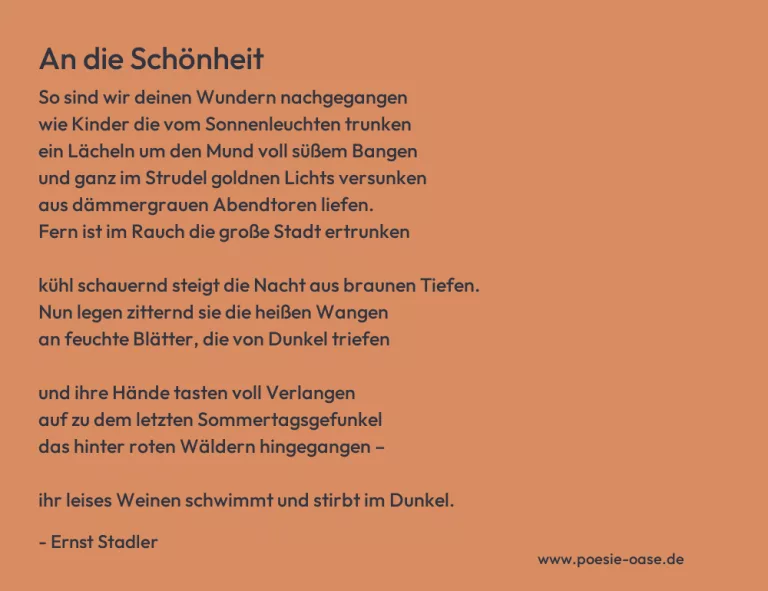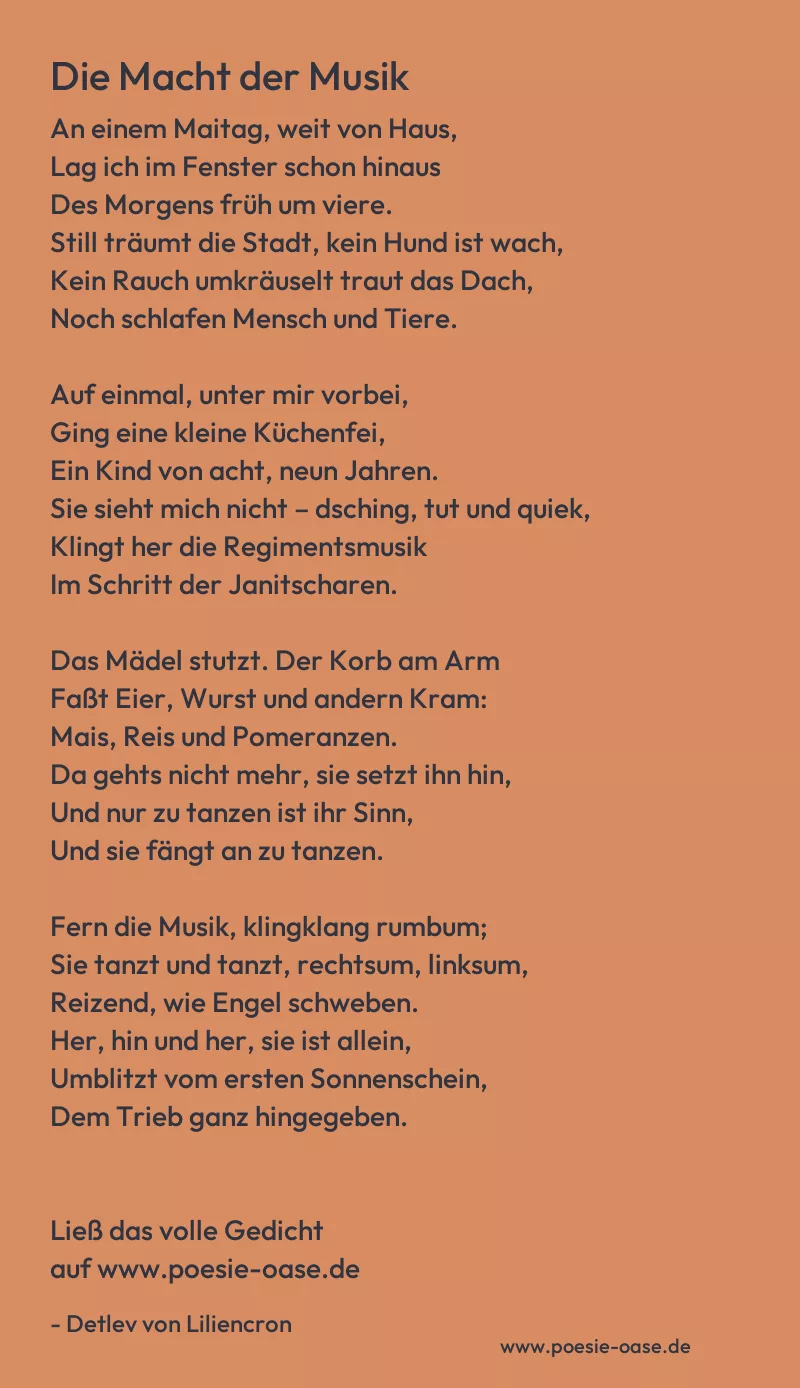An einem Maitag, weit von Haus,
Lag ich im Fenster schon hinaus
Des Morgens früh um viere.
Still träumt die Stadt, kein Hund ist wach,
Kein Rauch umkräuselt traut das Dach,
Noch schlafen Mensch und Tiere.
Auf einmal, unter mir vorbei,
Ging eine kleine Küchenfei,
Ein Kind von acht, neun Jahren.
Sie sieht mich nicht – dsching, tut und quiek,
Klingt her die Regimentsmusik
Im Schritt der Janitscharen.
Das Mädel stutzt. Der Korb am Arm
Faßt Eier, Wurst und andern Kram:
Mais, Reis und Pomeranzen.
Da gehts nicht mehr, sie setzt ihn hin,
Und nur zu tanzen ist ihr Sinn,
Und sie fängt an zu tanzen.
Fern die Musik, klingklang rumbum;
Sie tanzt und tanzt, rechtsum, linksum,
Reizend, wie Engel schweben.
Her, hin und her, sie ist allein,
Umblitzt vom ersten Sonnenschein,
Dem Trieb ganz hingegeben.
Mal kratzt sie sich den krausen Kopf,
Der Spatz machts so mit seinem Schopf,
Das tut sie nicht anfechten.
Doch plötzlich hört der Taumel auf,
Sie nimmt den Korb, setzt sich in Lauf,
Es fliegen ihre Flechten.
Hin zur Musik! Sie läuft, sie rennt,
Nur zu, nur fort, als wenn sie brennt,
Was sinds für Firlefanzen!
Die Wurst im Korb macht hoppsasa,
Die Eier hüpfen hopplala,
Und auch die Pomeranzen.
Wer weiß, wo jener Tanzplatz war:
In Kiel, in Rom, in Sansibar,
In Siebenbürgen, China?
Der Reim auf China liegt nicht fern:
Im Leben denk ich immer gern
Der kleinen Ballerina.