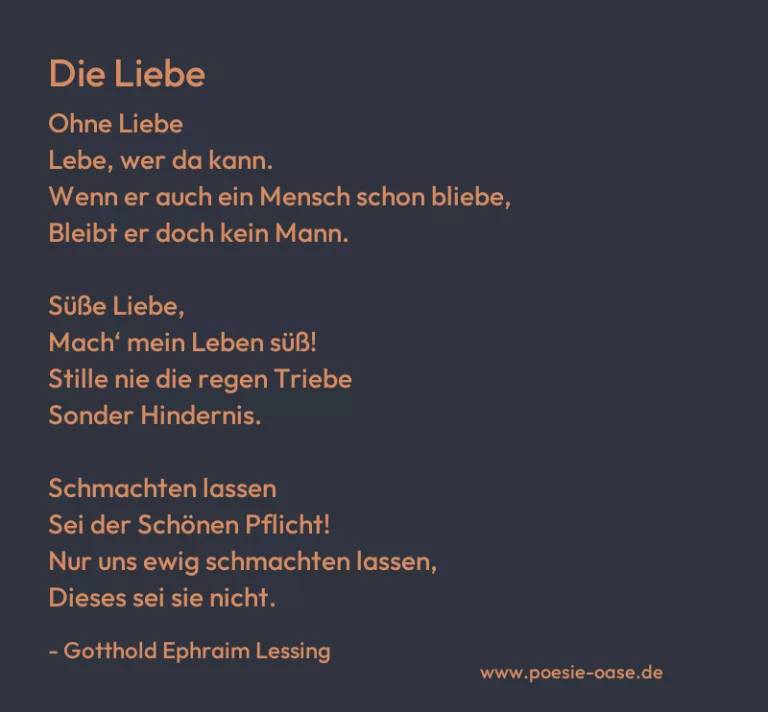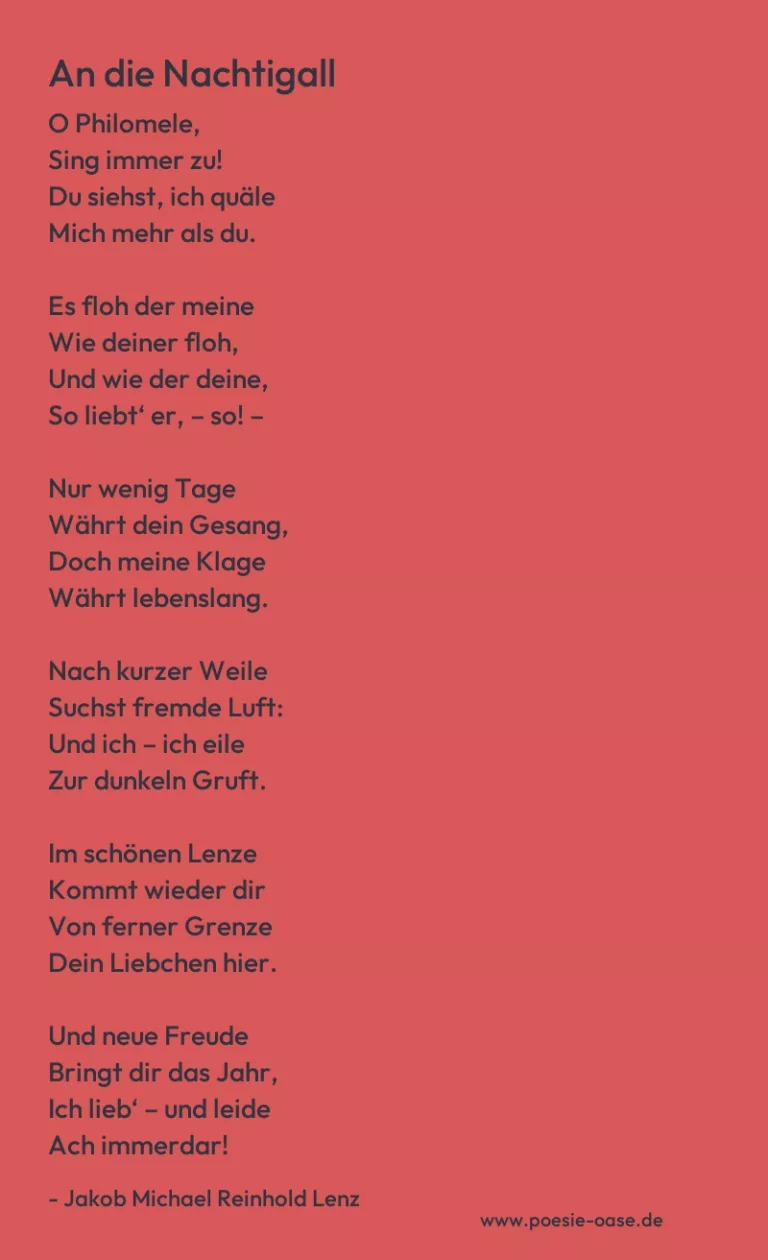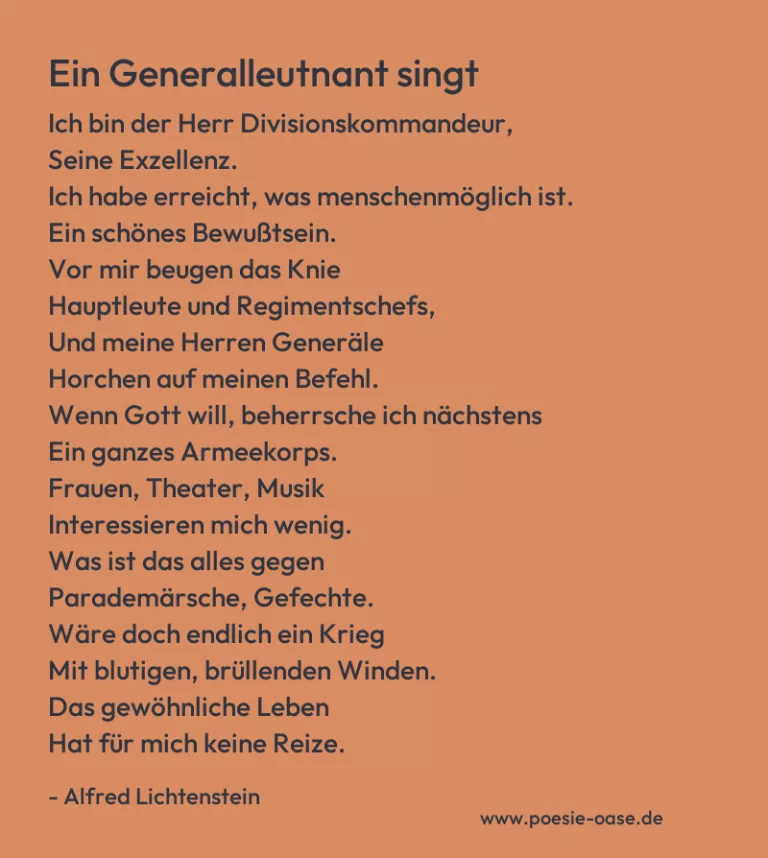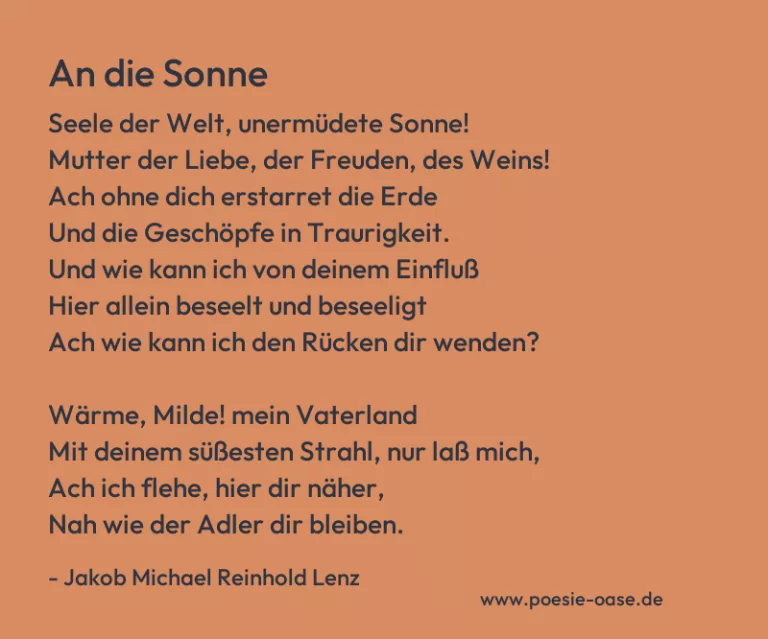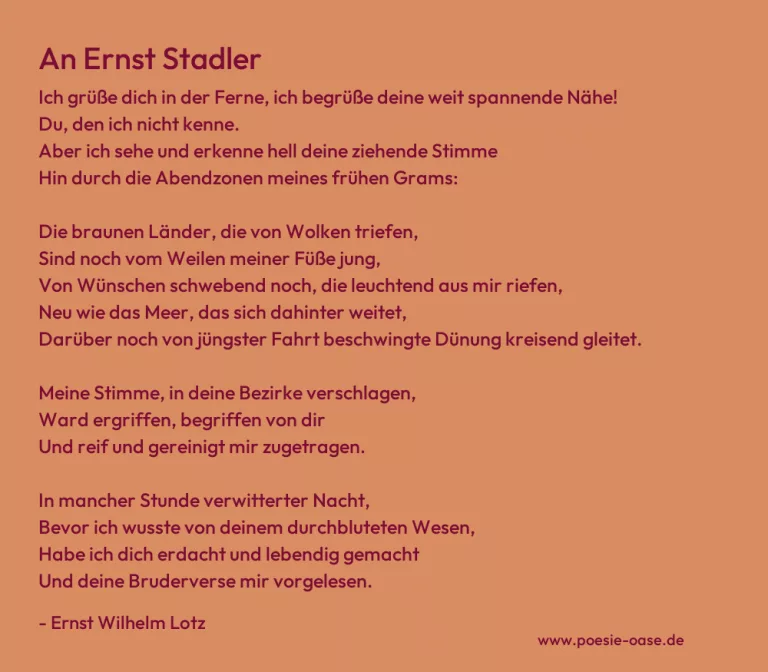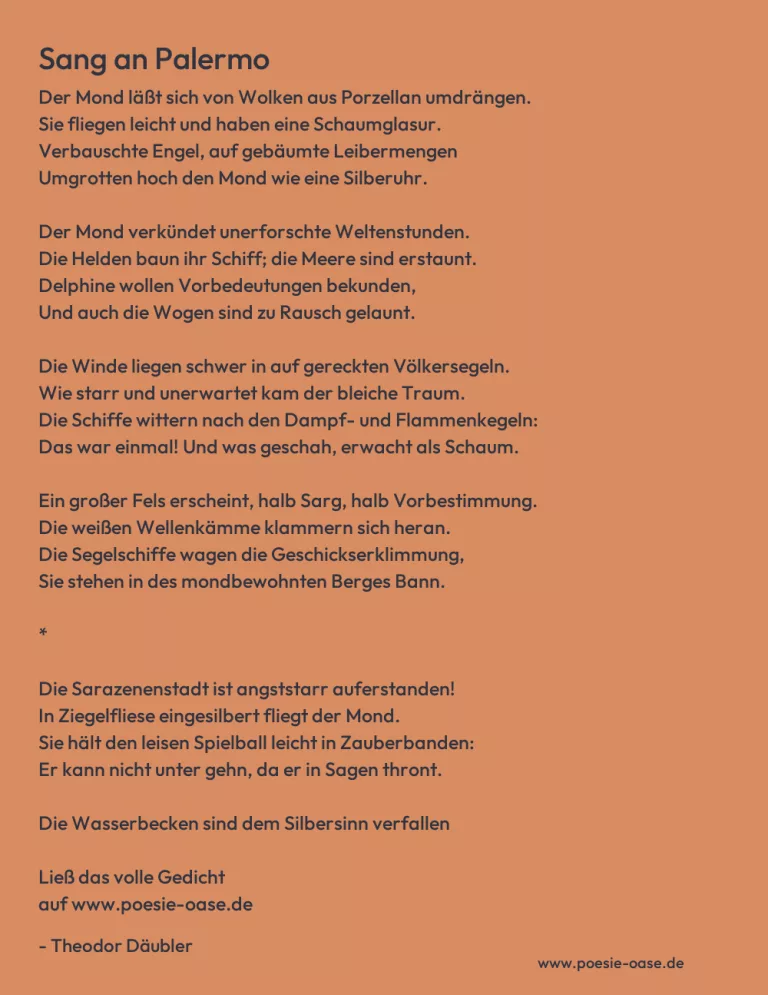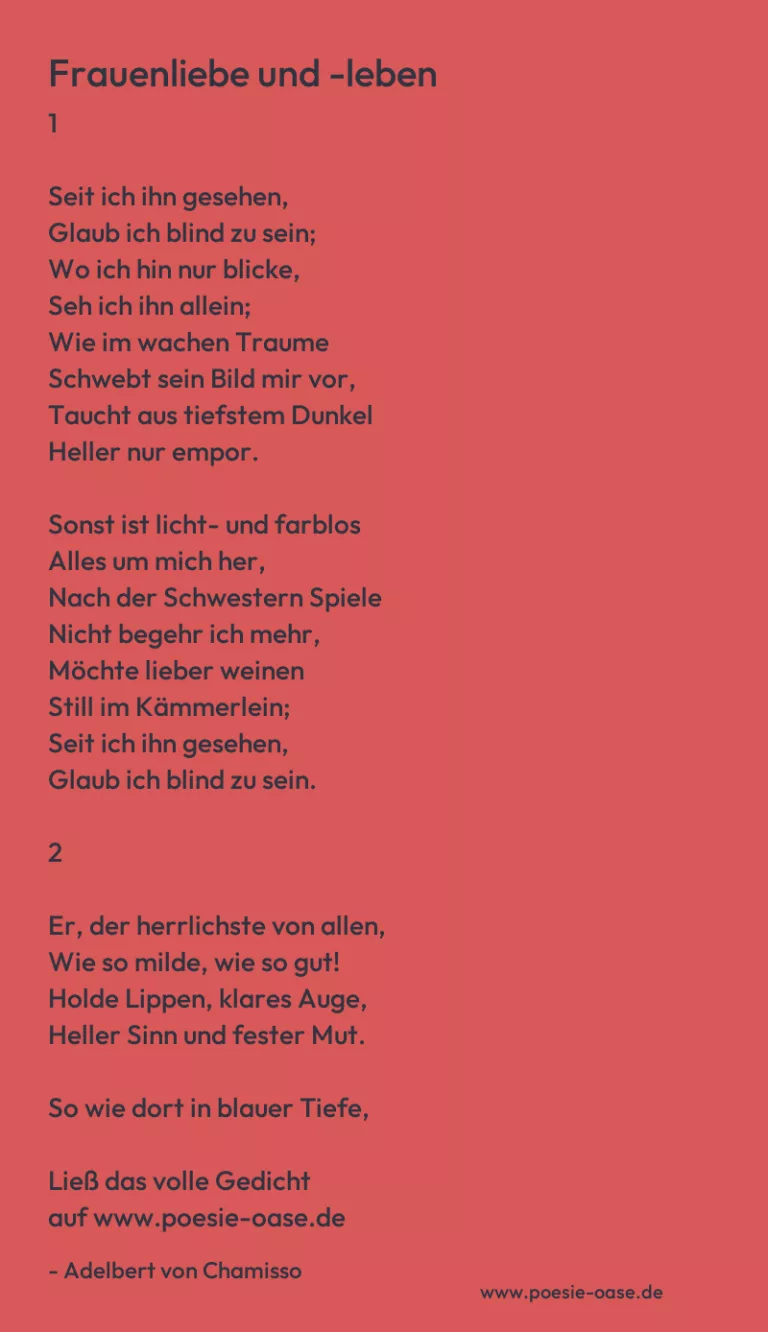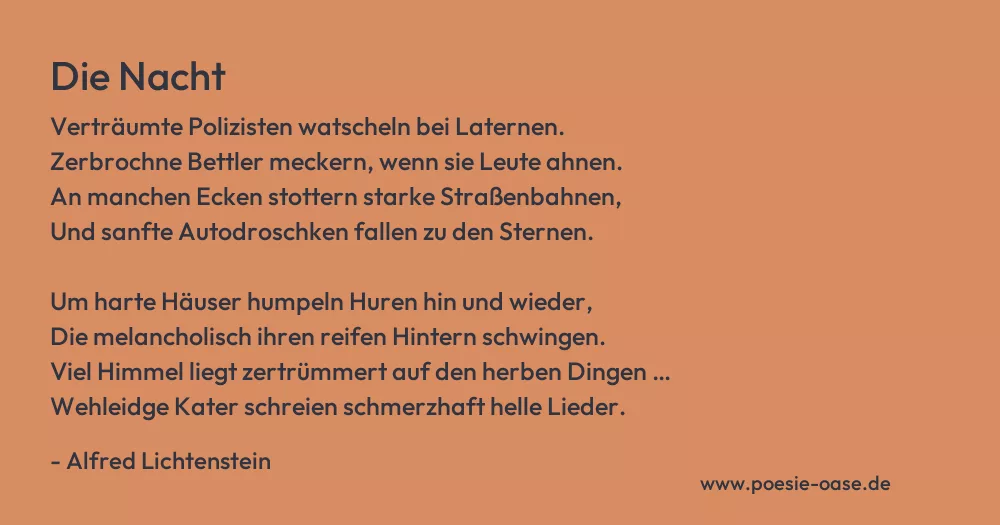Die Nacht
Verträumte Polizisten watscheln bei Laternen.
Zerbrochne Bettler meckern, wenn sie Leute ahnen.
An manchen Ecken stottern starke Straßenbahnen,
Und sanfte Autodroschken fallen zu den Sternen.
Um harte Häuser humpeln Huren hin und wieder,
Die melancholisch ihren reifen Hintern schwingen.
Viel Himmel liegt zertrümmert auf den herben Dingen …
Wehleidge Kater schreien schmerzhaft helle Lieder.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
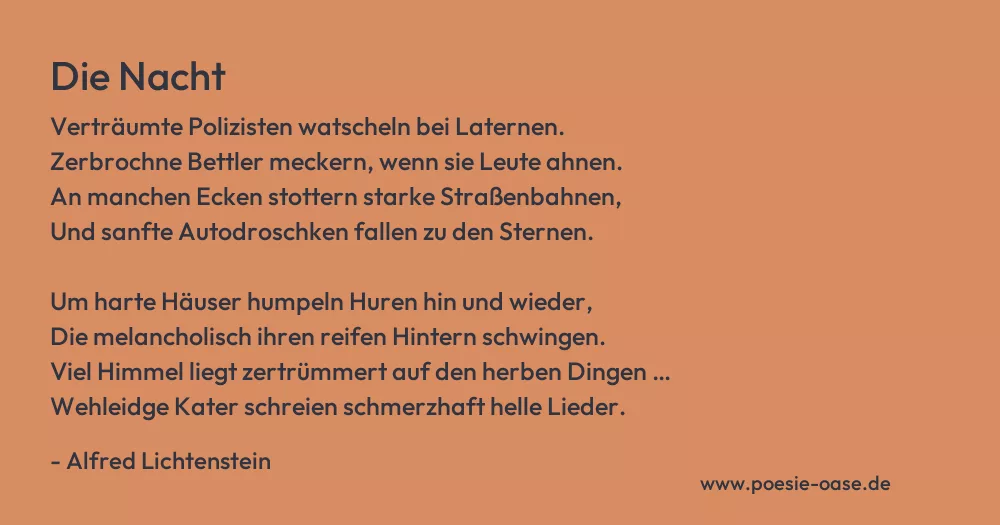
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Nacht“ von Alfred Lichtenstein vermittelt eine düstere, fast surreale Stimmung, die die Entfremdung und das chaotische Leben in der Stadt in der Nacht beschreibt. Zu Beginn wird die Szene von „verträumten Polizisten“ geprägt, die „watscheln bei Laternen“, was eine absurde, fast unwirkliche Vorstellung vermittelt. Die Polizisten, normalerweise für Ordnung zuständig, erscheinen hier wie gelebte Karikaturen ihrer Funktion, was den Eindruck von Verwirrung und Entfremdung in der Nacht verstärkt. Gleichzeitig hört man von „zerbrochnen Bettlern“, deren gequälte Stimmen die düstere Atmosphäre noch weiter verdichten.
Die Straßen der Stadt wirken lebendig und chaotisch, da die „starken Straßenbahnen“ „stottern“ und „sanfte Autodroschken“ zu den Sternen „fallen“. Diese Bilder erzeugen den Eindruck einer Stadt, die in einem Zustand des Aufruhrs und der Desorientierung ist. Die Straßenbahnen und Droschken, normalerweise Symbole für den geordneten städtischen Verkehr, erscheinen hier in ihrer Bewegung seltsam entgleist, was den Zustand der Nacht als einen Ort des Chaos und der Verzerrung darstellt. Die „Sterne“, die als Ziel für die Droschken dienen, sind dabei eine weitere Metapher für den unerreichbaren Traum oder das Ideal, das in der Dunkelheit der Nacht verloren geht.
Der zweite Teil des Gedichts beschreibt die „harten Häuser“, um die „Huren“ „hin und wieder“ humpeln, eine Szene, die die soziale Härte und den Verfall der Stadt noch deutlicher macht. Die „Huren“, die „melancholisch ihren reifen Hintern schwingen“, sind eine tragische Darstellung der Frauen, die sich im Dunkeln der Nacht verkaufen, um zu überleben. Ihre Bewegung wirkt sowohl verführerisch als auch traurig, ein Bild für die zerrissene Welt der Stadt. Die Bildsprache verstärkt das Gefühl von Entfremdung und den Verlust der Unschuld.
Das Gedicht endet mit dem Bild von „wehleidigen Katern“, die „schmerzhaft helle Lieder“ schreien, was den nächtlichen Lärm und die Verzweiflung noch weiter steigert. Die „Kater“ symbolisieren dabei das klagende Leid und die Verzweiflung, die in den dunklen Gassen der Stadt widerhallen. Ihr „schmerzhaftes“ Schreien fügt sich nahtlos in die Atmosphäre des Gedichts ein, das eine Welt voller Lärm, Schmerz und Unruhe darstellt. Lichtenstein nutzt hier kraftvolle Bilder und eine intensive Sprachwahl, um eine düstere, fast surreale Vision der Nacht zu präsentieren, in der das Verlangen und das Leid in einer chaotischen, entmenschlichten Welt unaufhörlich miteinander kollidieren.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.