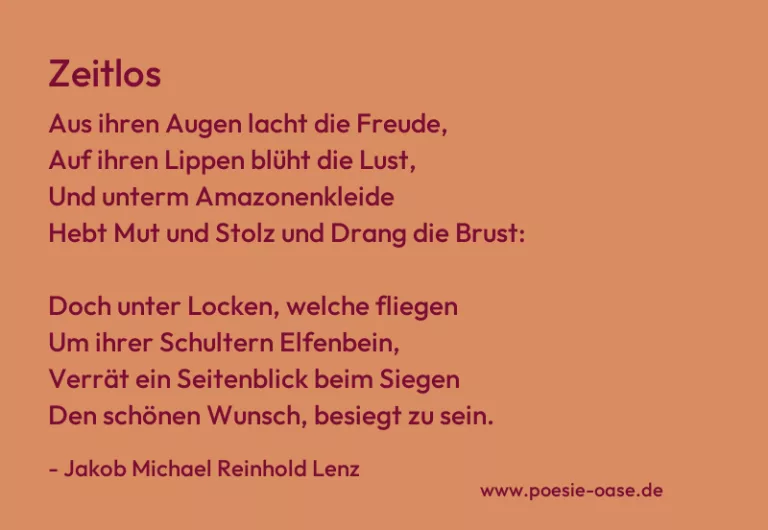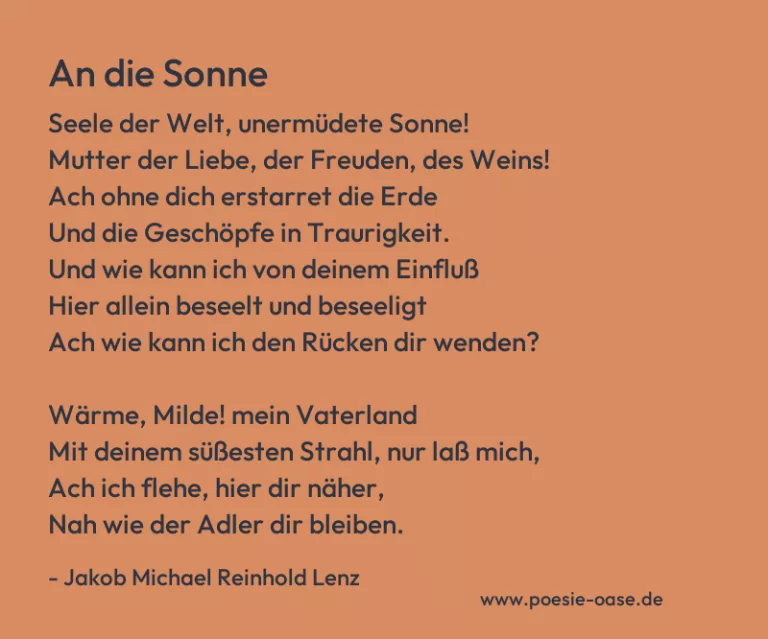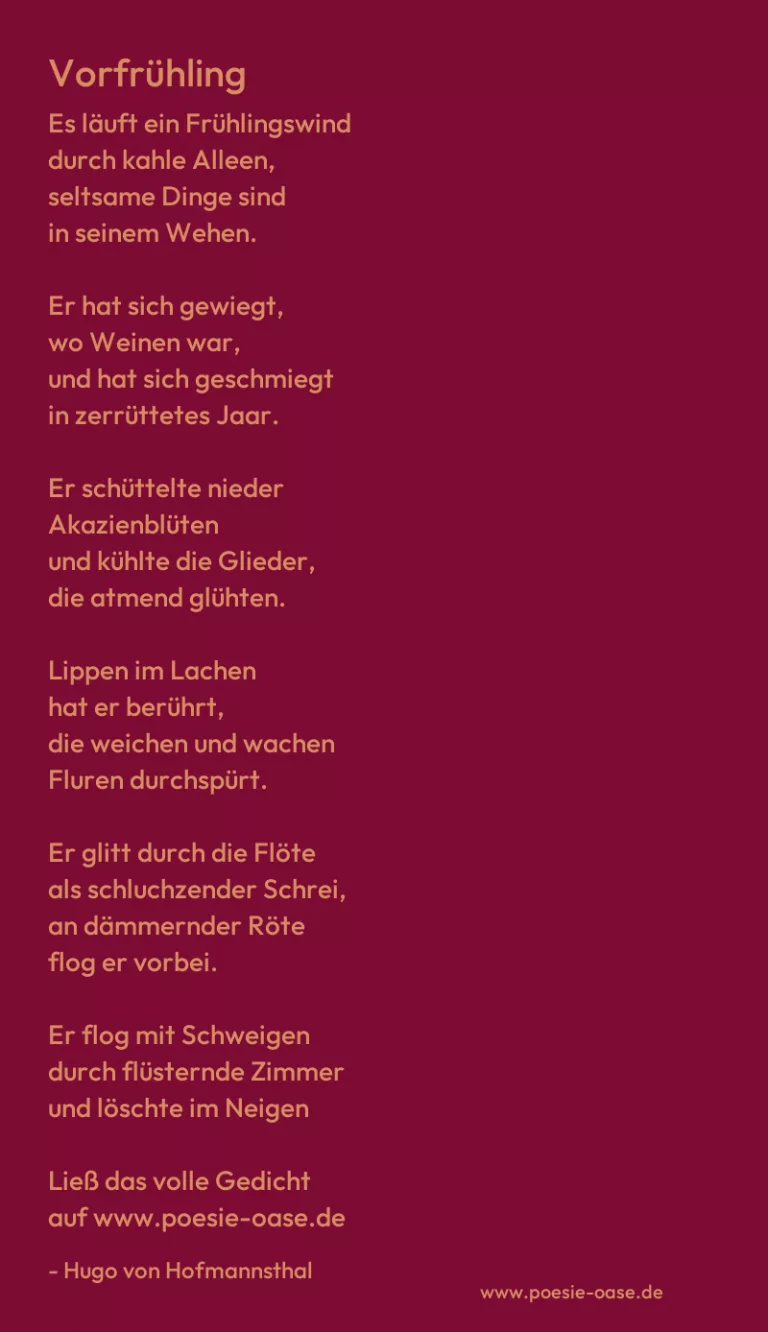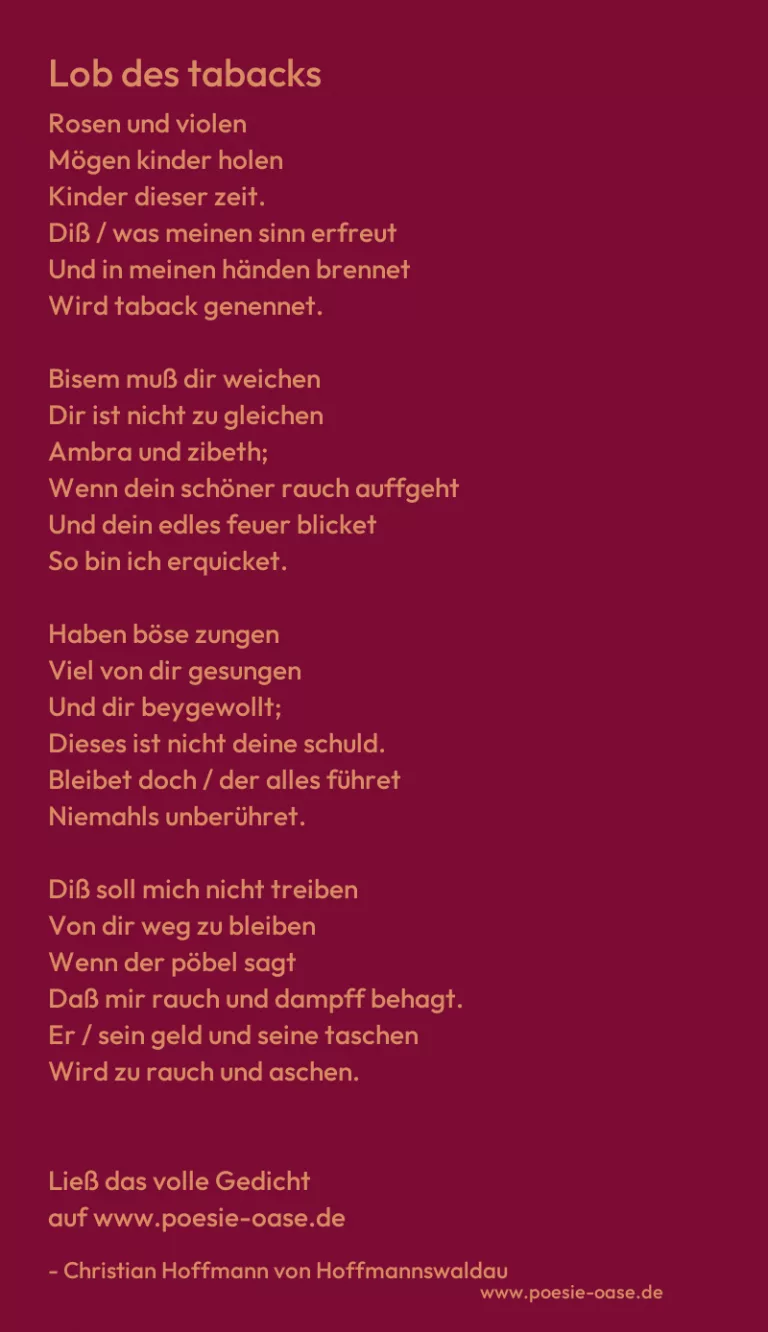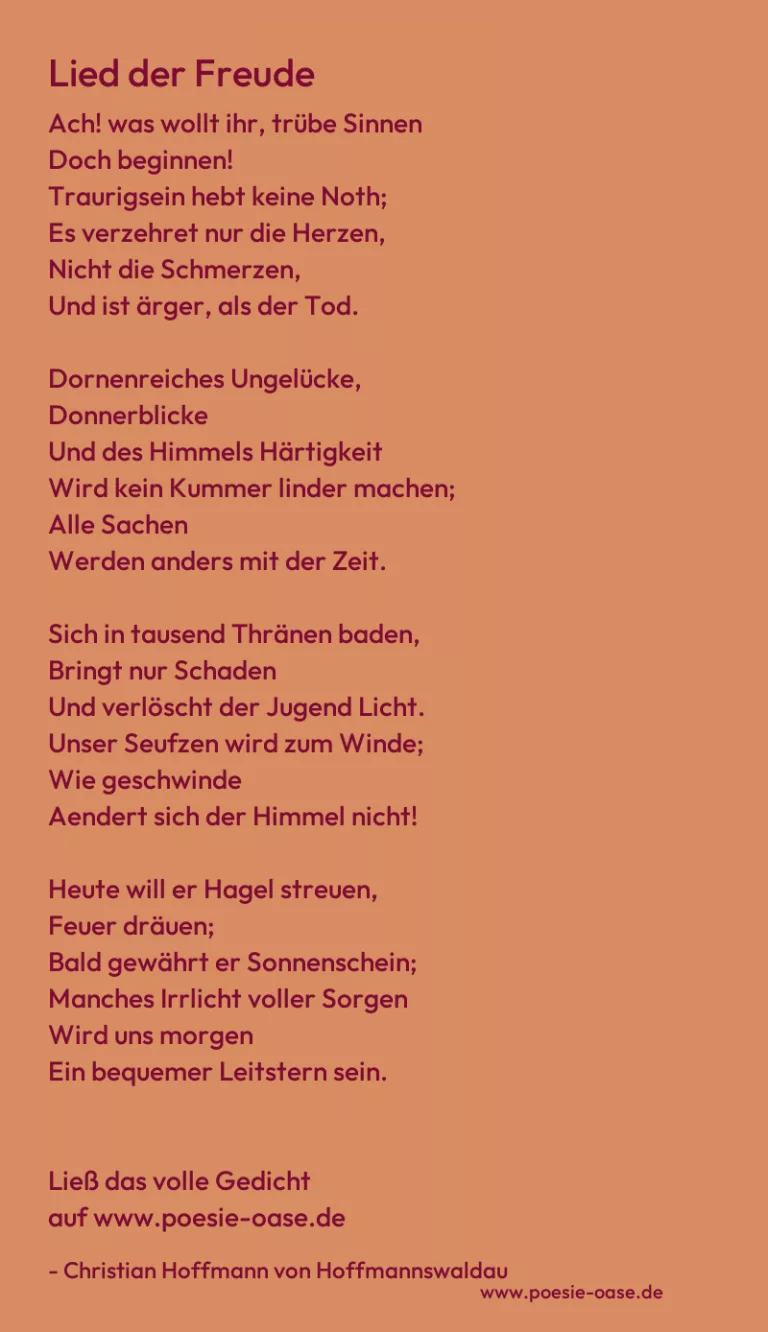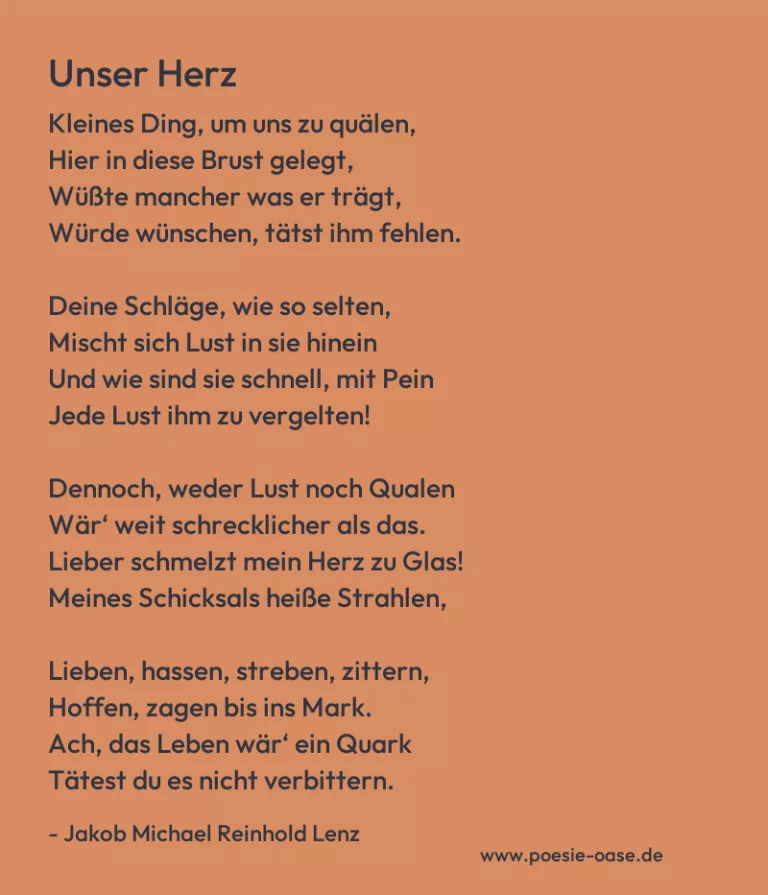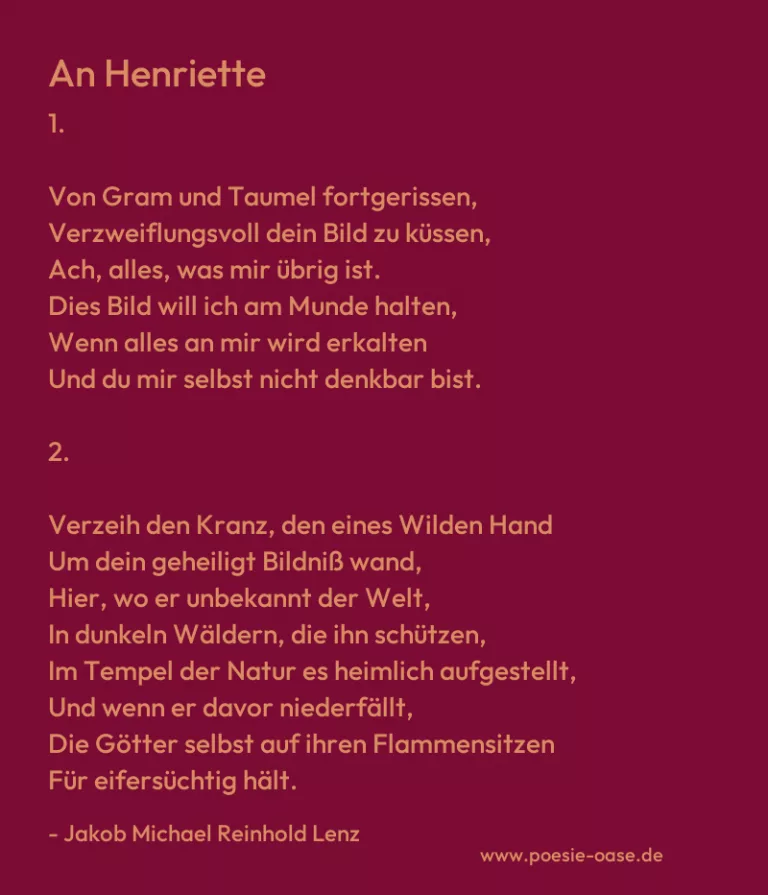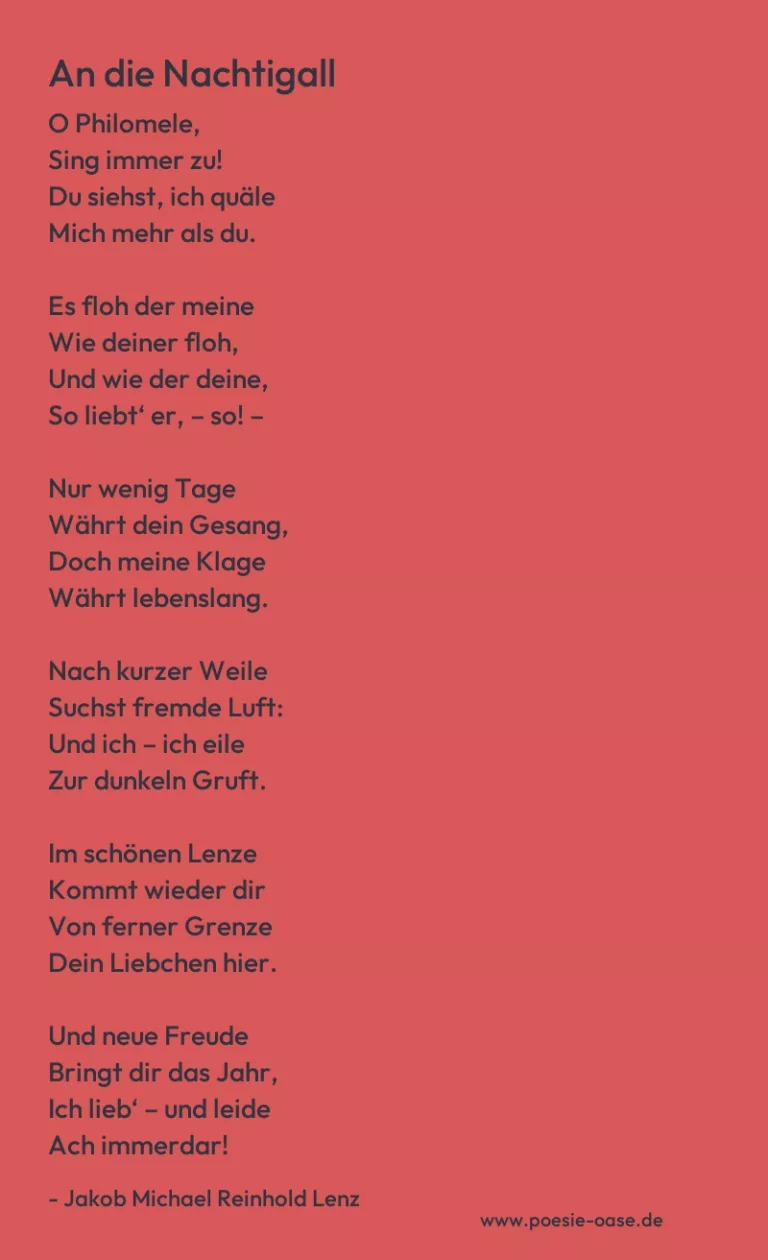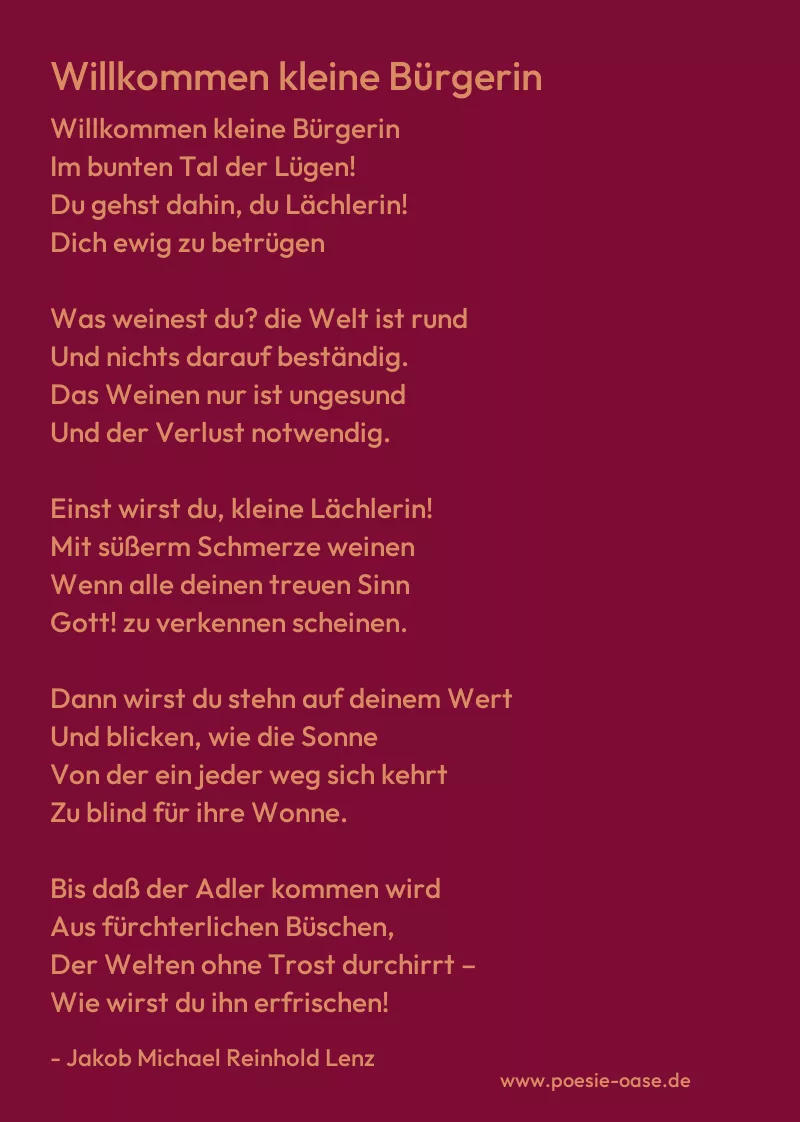Willkommen kleine Bürgerin
Willkommen kleine Bürgerin
Im bunten Tal der Lügen!
Du gehst dahin, du Lächlerin!
Dich ewig zu betrügen
Was weinest du? die Welt ist rund
Und nichts darauf beständig.
Das Weinen nur ist ungesund
Und der Verlust notwendig.
Einst wirst du, kleine Lächlerin!
Mit süßerm Schmerze weinen
Wenn alle deinen treuen Sinn
Gott! zu verkennen scheinen.
Dann wirst du stehn auf deinem Wert
Und blicken, wie die Sonne
Von der ein jeder weg sich kehrt
Zu blind für ihre Wonne.
Bis daß der Adler kommen wird
Aus fürchterlichen Büschen,
Der Welten ohne Trost durchirrt –
Wie wirst du ihn erfrischen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
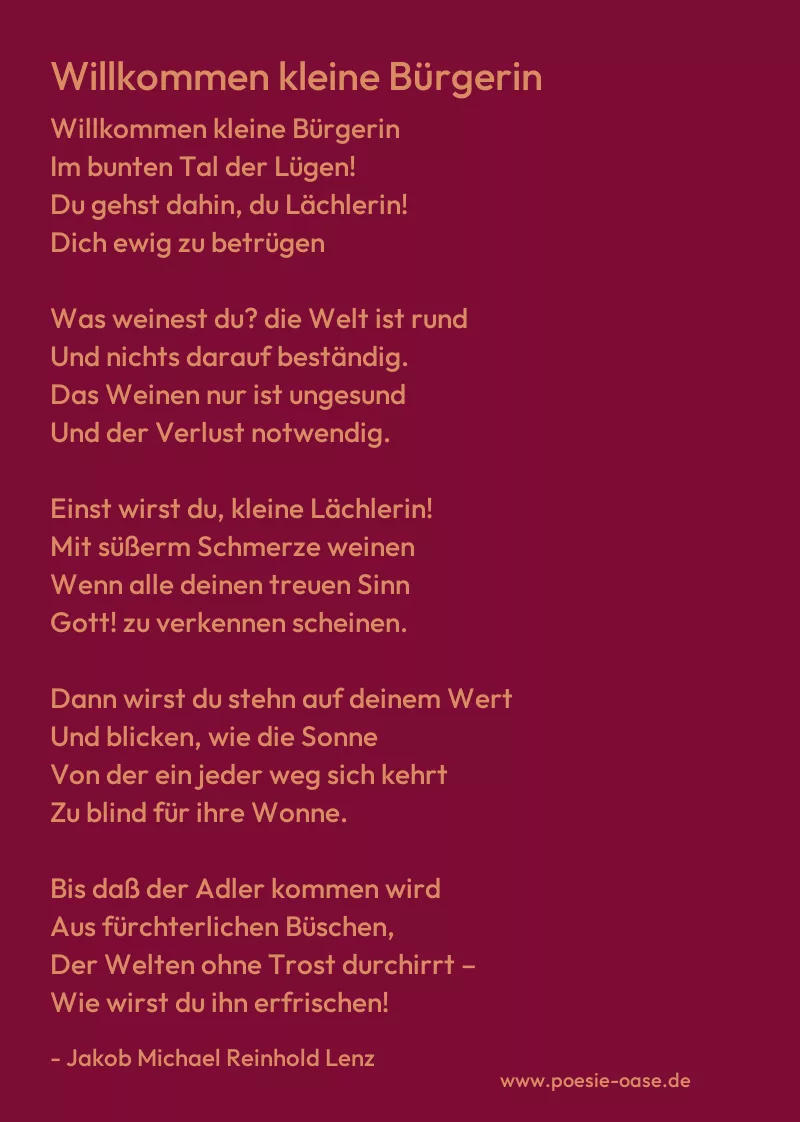
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Willkommen kleine Bürgerin“ von Jakob Michael Reinhold Lenz begrüßt eine junge Frau, die mit der „Lüge“ und der „Täuschung“ konfrontiert wird. Von Anfang an wird sie als „kleine Bürgerin“ im „bunten Tal der Lügen“ eingeführt, was eine Welt beschreibt, in der Illusionen und falsche Wahrheiten vorherrschen. Ihre Aufgabe scheint es zu sein, in dieser Welt weiterzugehen, die sie mit einem Lächeln betrachtet – die „Lächlerin“ – und dabei in die Täuschung einzutauchen, ohne sich ihrer Auswirkungen bewusst zu sein. Das Gedicht ist eine kritische Reflexion über die falschen Erwartungen und die Intransparenz, die die junge Frau umgeben.
Im zweiten Abschnitt reagiert der Sprecher auf das Weinen der „Lächlerin“, das er als unnötig und schädlich erachtet. Er erklärt, dass „die Welt rund“ sei und nichts darauf „beständig“ sei, was auf die Vergänglichkeit des Lebens hinweist. Das Weinen und der Schmerz, so heißt es, sind „ungesund“, während der Verlust ein „notwendiger“ Teil des Lebens ist. Dies könnte als ein Versuch verstanden werden, die junge Frau in die Härte des Lebens einzuführen, wobei er die Vorstellung betont, dass der Schmerz und das Leiden Teil des menschlichen Schicksals sind, denen man sich nicht entziehen kann.
Die Verse, die den zukünftigen Schmerz der jungen Frau beschreiben, zeigen eine tiefere und dramatischere Wendung. Sie wird „mit süßem Schmerz weinen“, wenn sie erkennt, dass ihr „treuer Sinn“ von anderen, besonders von denen, die sie schätzt, nicht erkannt wird. In dieser Passage wird die schmerzliche Erfahrung der Enttäuschung und des Verrats thematisiert, bei der die junge Frau mit einer Realität konfrontiert wird, die ihre Ideale und Hoffnungen zerstört. Sie wird gezwungen sein, ihren Wert zu erkennen und „auf ihrem Wert zu stehen“, selbst wenn die Welt ihr diesen nicht zuschreibt, was eine bittere Erkenntnis ist.
Die letzte Strophe des Gedichts führt einen „Adler“ ein, der aus „fürchterlichen Büschen“ kommen wird – ein Symbol für einen mächtigen, vielleicht sogar grausamen Erlöser. Der Adler ist der „Welten ohne Trost“ ausgesetzt, und die junge Frau soll ihm mit ihrer „Wonne“ begegnen, um ihn zu „erfrischen“. Hier wird der Adler möglicherweise als eine höhere Macht oder ein Symbol für Stärke und Weisheit verstanden, der durch die Unzulänglichkeiten der Welt irrt. Die „Lächlerin“ könnte als eine Person verstanden werden, die durch ihren eigenen Schmerz und ihre Erfahrungen in der Lage ist, Trost zu spenden oder eine neue Perspektive zu bieten. Das Gedicht endet mit der Hoffnung, dass sie, trotz der Täuschungen und Leiden, die sie erleben wird, zu einer Quelle der Erfrischung und Heilung wird.
Lenz‘ Gedicht behandelt die Themen des Lebens, der Täuschung, des Schmerzes und der Selbstfindung und zeigt auf, dass der Weg zur Weisheit und zum Trost oft durch die Enttäuschungen des Lebens führt. Die junge Frau muss ihren Platz in einer Welt finden, die sie möglicherweise nicht versteht, und dabei ihre eigene Stärke und ihren Wert erkennen. Es ist ein Gedicht über den Übergang von der Unschuld zur Erfahrung und die Bedeutung von Schmerz und Verlust auf diesem Weg.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.