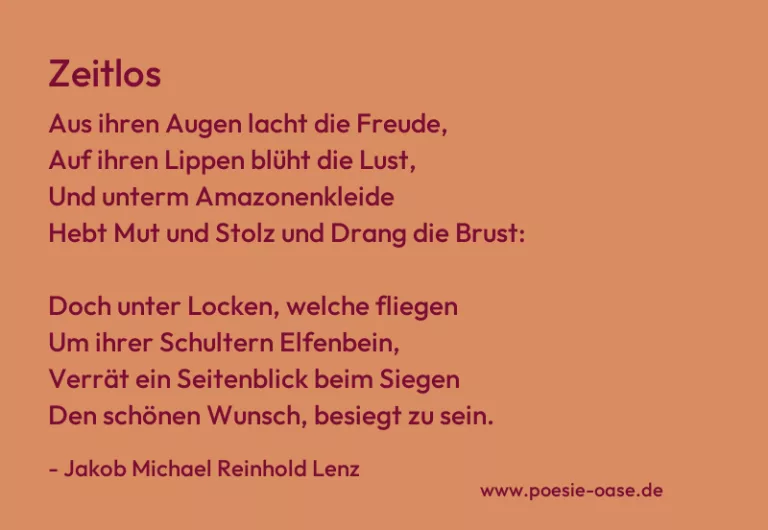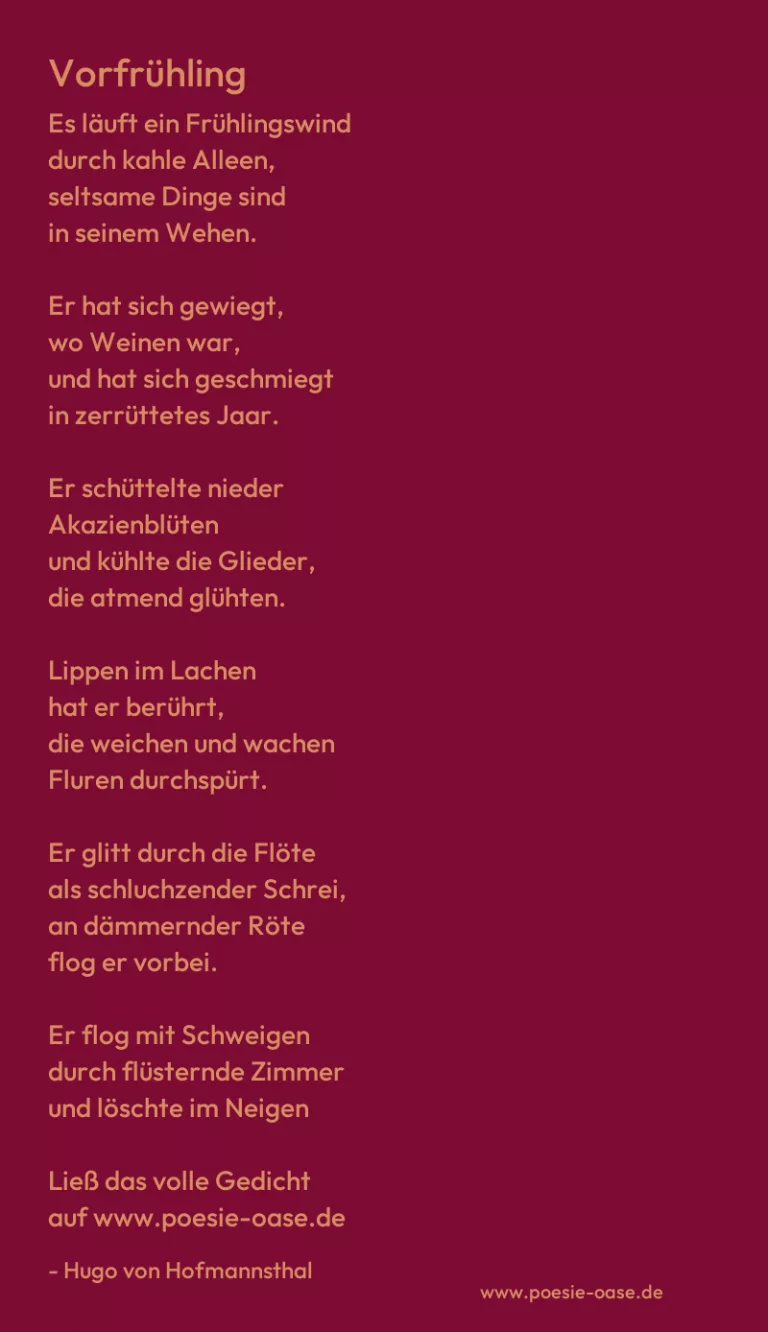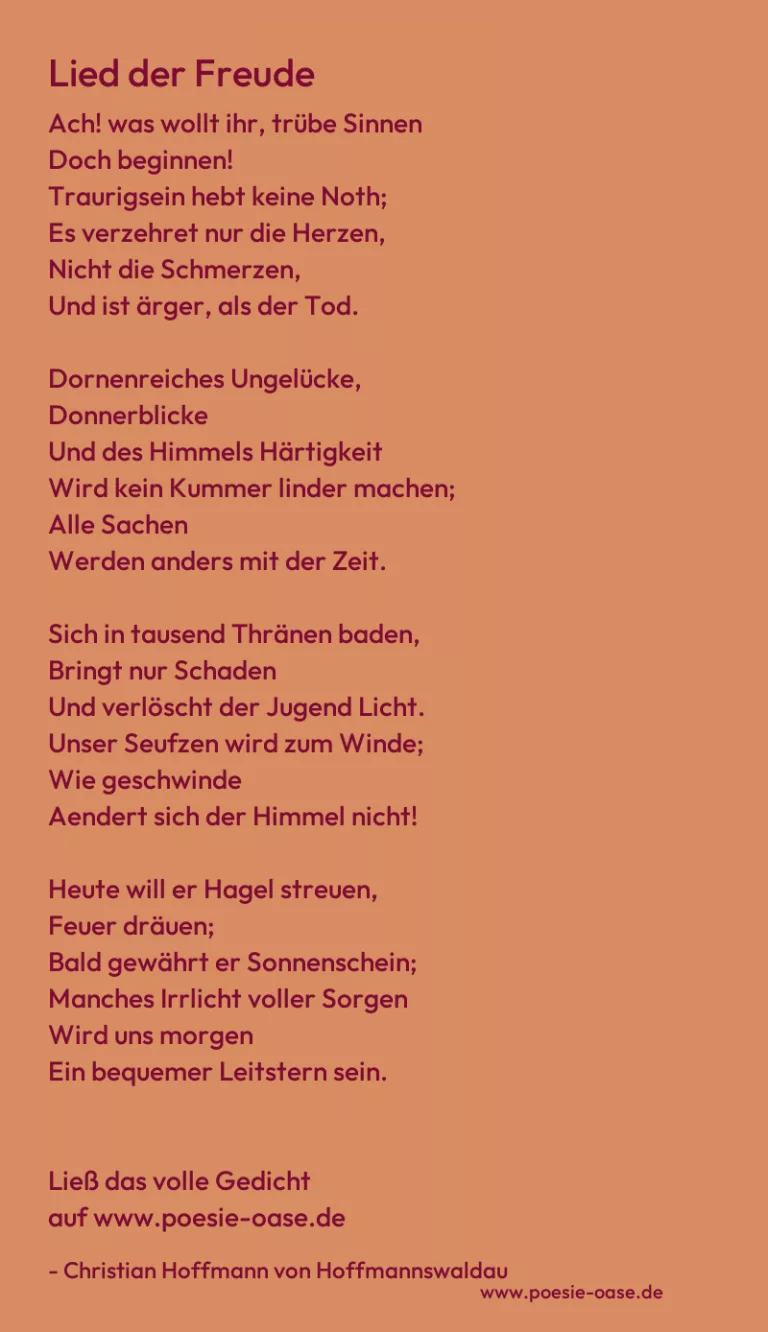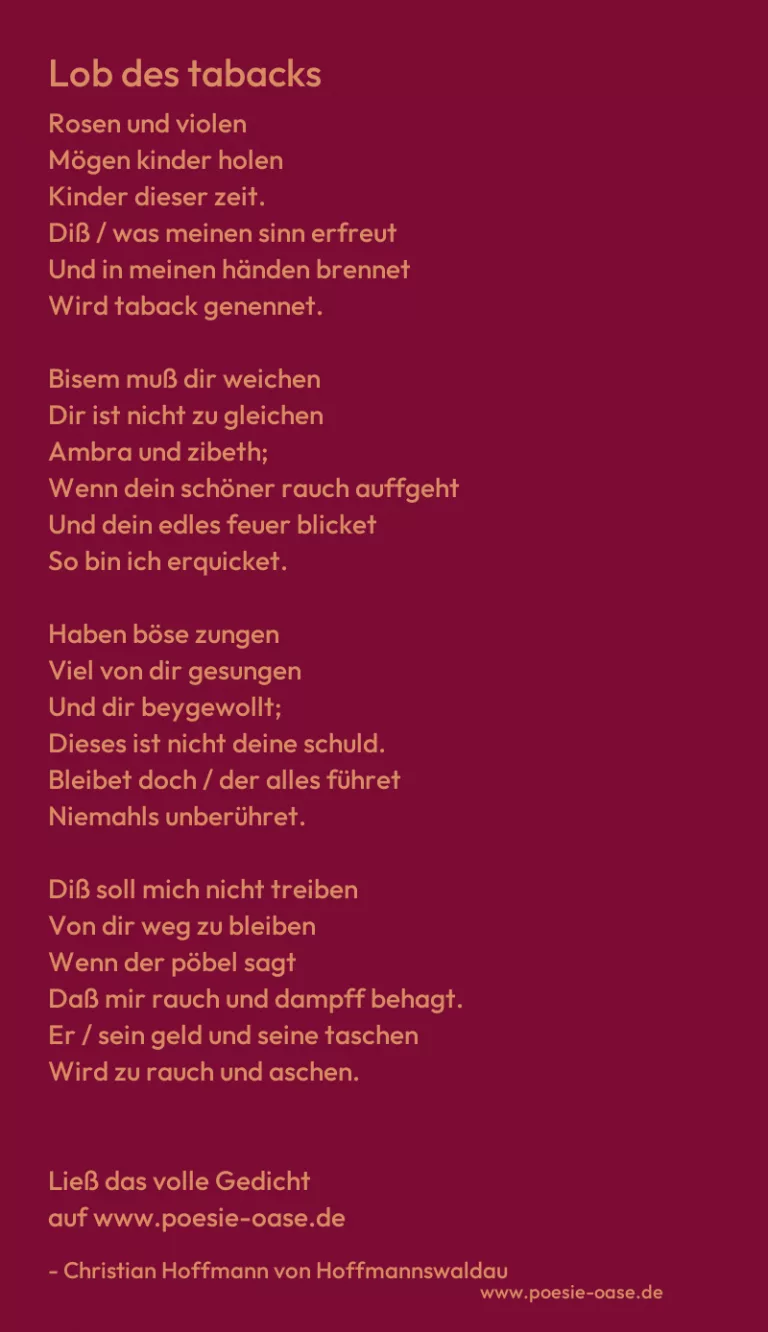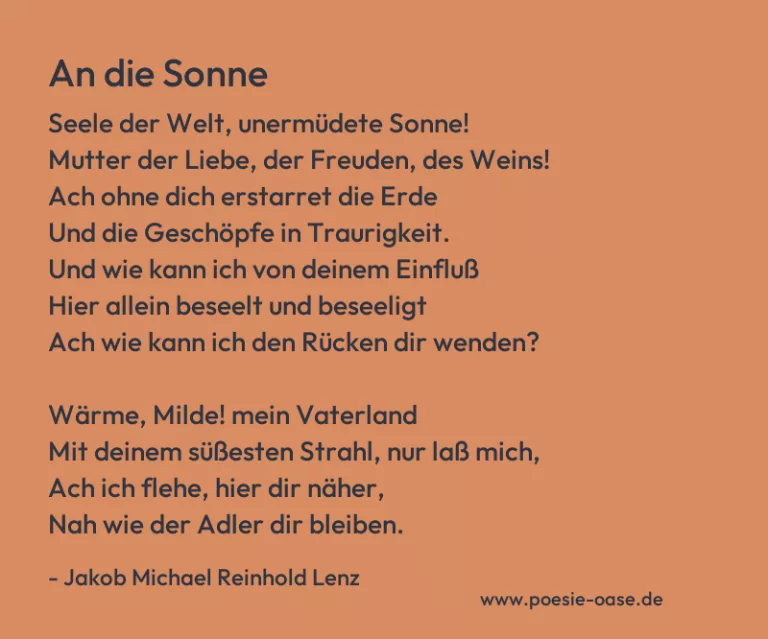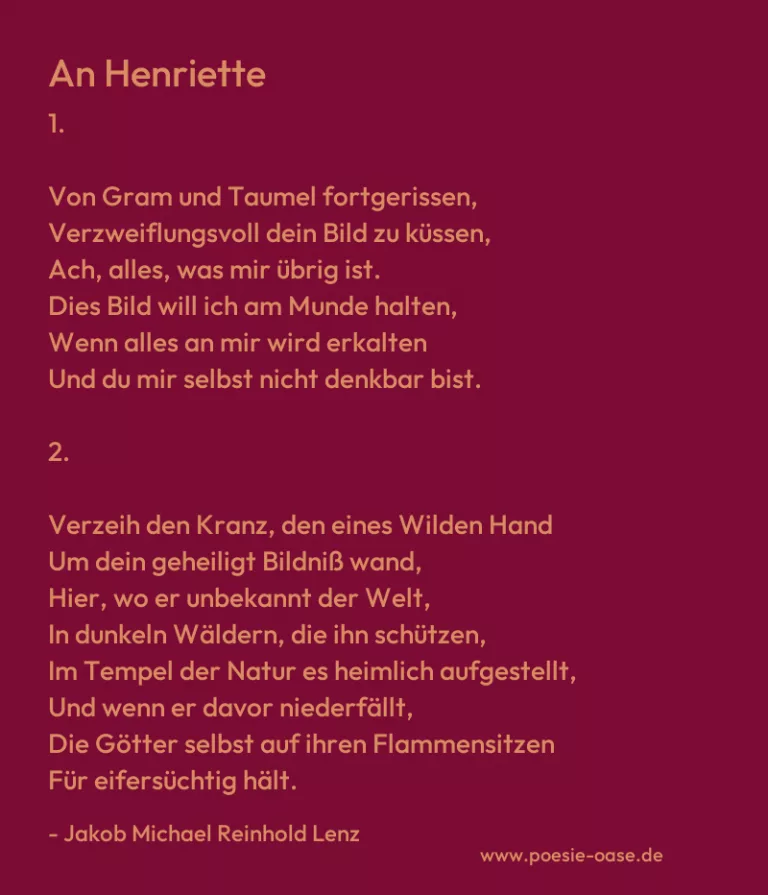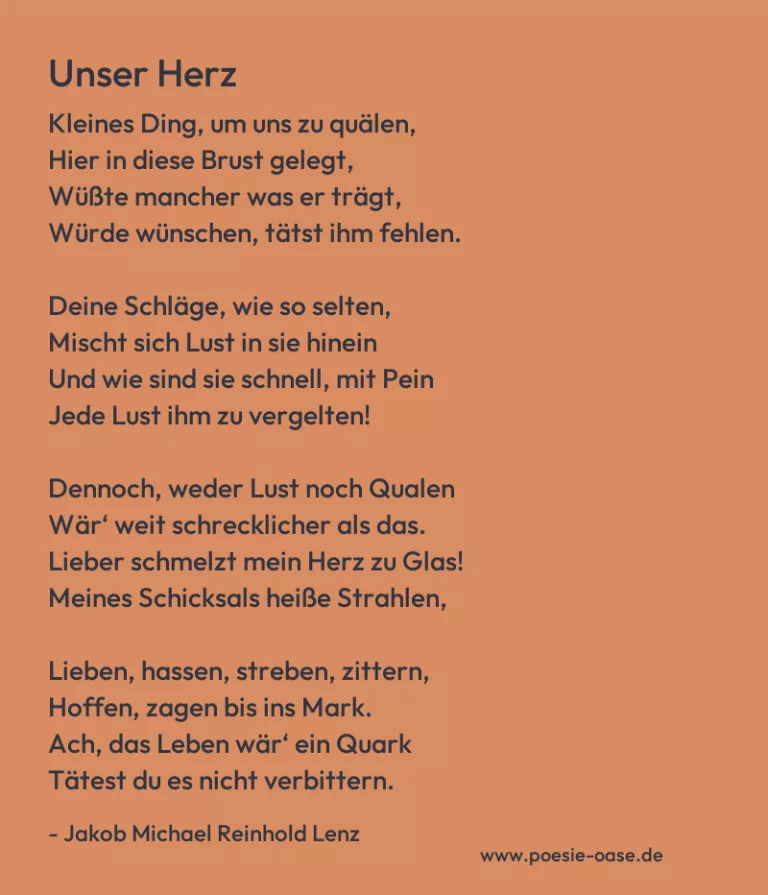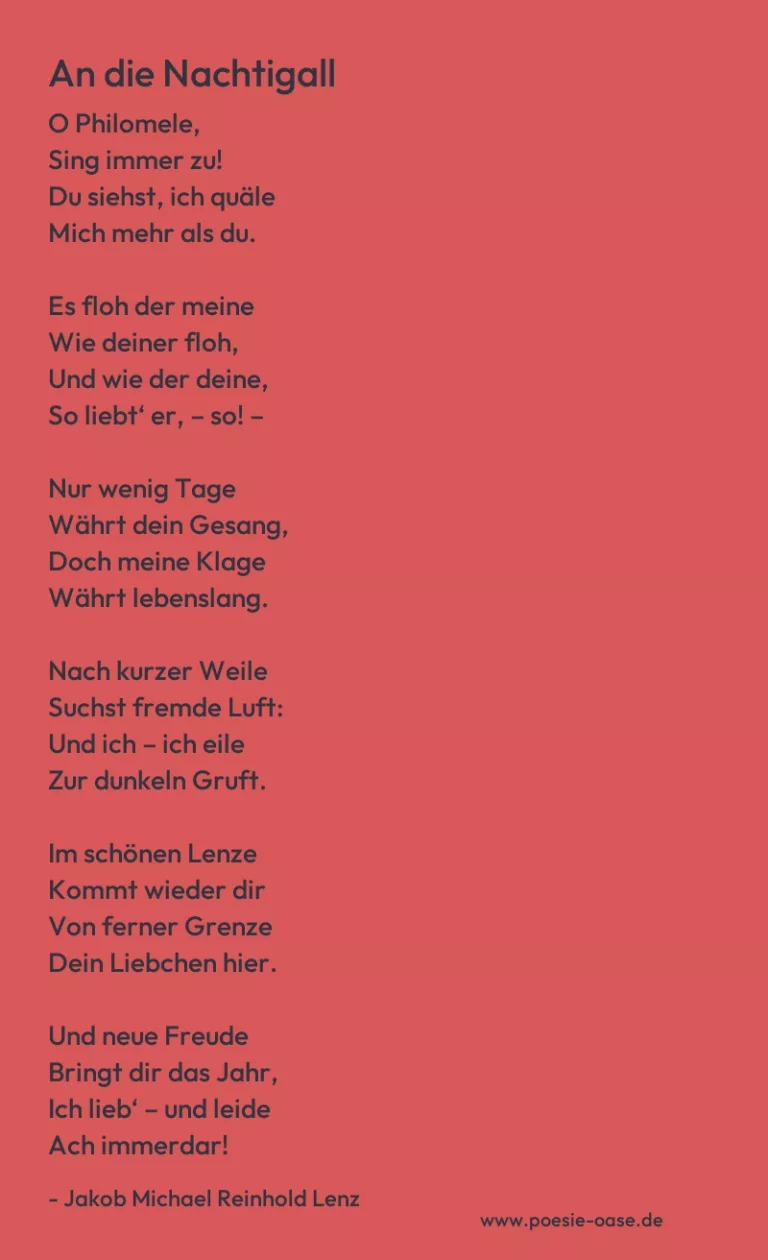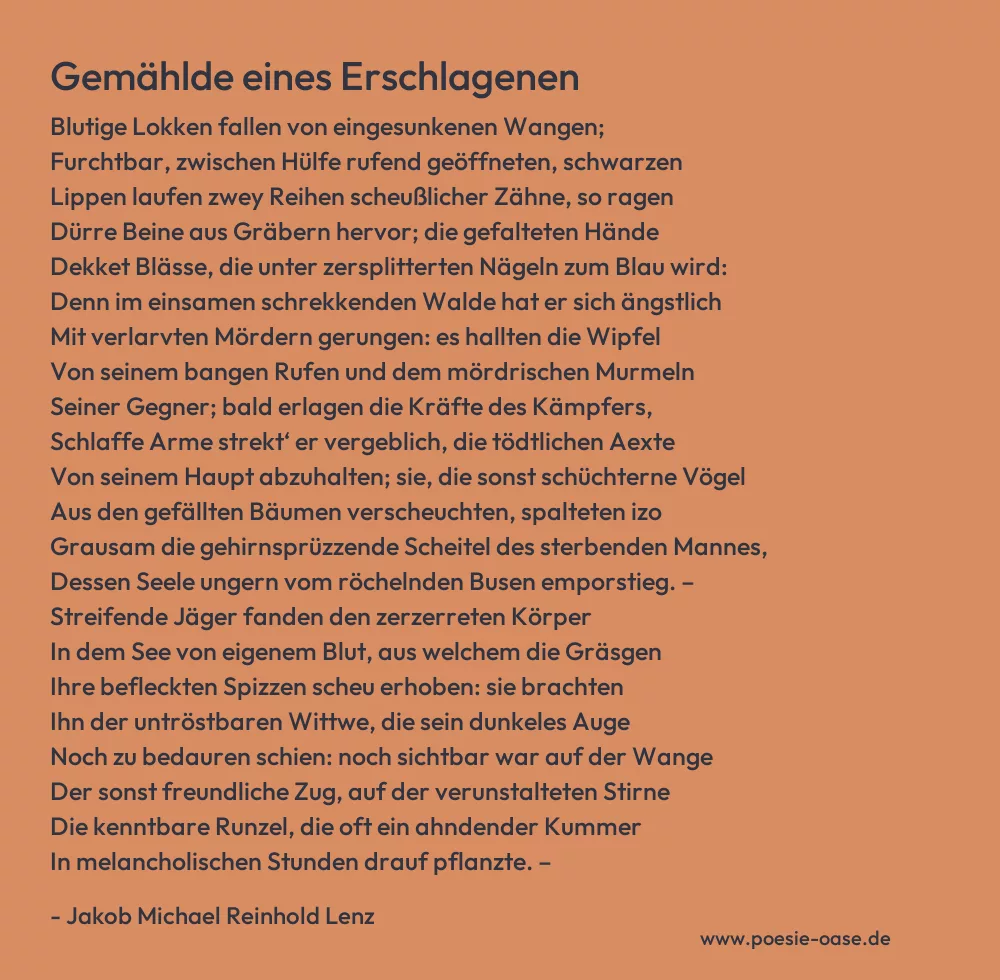Gemählde eines Erschlagenen
Blutige Lokken fallen von eingesunkenen Wangen;
Furchtbar, zwischen Hülfe rufend geöffneten, schwarzen
Lippen laufen zwey Reihen scheußlicher Zähne, so ragen
Dürre Beine aus Gräbern hervor; die gefalteten Hände
Dekket Blässe, die unter zersplitterten Nägeln zum Blau wird:
Denn im einsamen schrekkenden Walde hat er sich ängstlich
Mit verlarvten Mördern gerungen: es hallten die Wipfel
Von seinem bangen Rufen und dem mördrischen Murmeln
Seiner Gegner; bald erlagen die Kräfte des Kämpfers,
Schlaffe Arme strekt‘ er vergeblich, die tödtlichen Aexte
Von seinem Haupt abzuhalten; sie, die sonst schüchterne Vögel
Aus den gefällten Bäumen verscheuchten, spalteten izo
Grausam die gehirnsprüzzende Scheitel des sterbenden Mannes,
Dessen Seele ungern vom röchelnden Busen emporstieg. –
Streifende Jäger fanden den zerzerreten Körper
In dem See von eigenem Blut, aus welchem die Gräsgen
Ihre befleckten Spizzen scheu erhoben: sie brachten
Ihn der untröstbaren Wittwe, die sein dunkeles Auge
Noch zu bedauren schien: noch sichtbar war auf der Wange
Der sonst freundliche Zug, auf der verunstalteten Stirne
Die kenntbare Runzel, die oft ein ahndender Kummer
In melancholischen Stunden drauf pflanzte. –
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
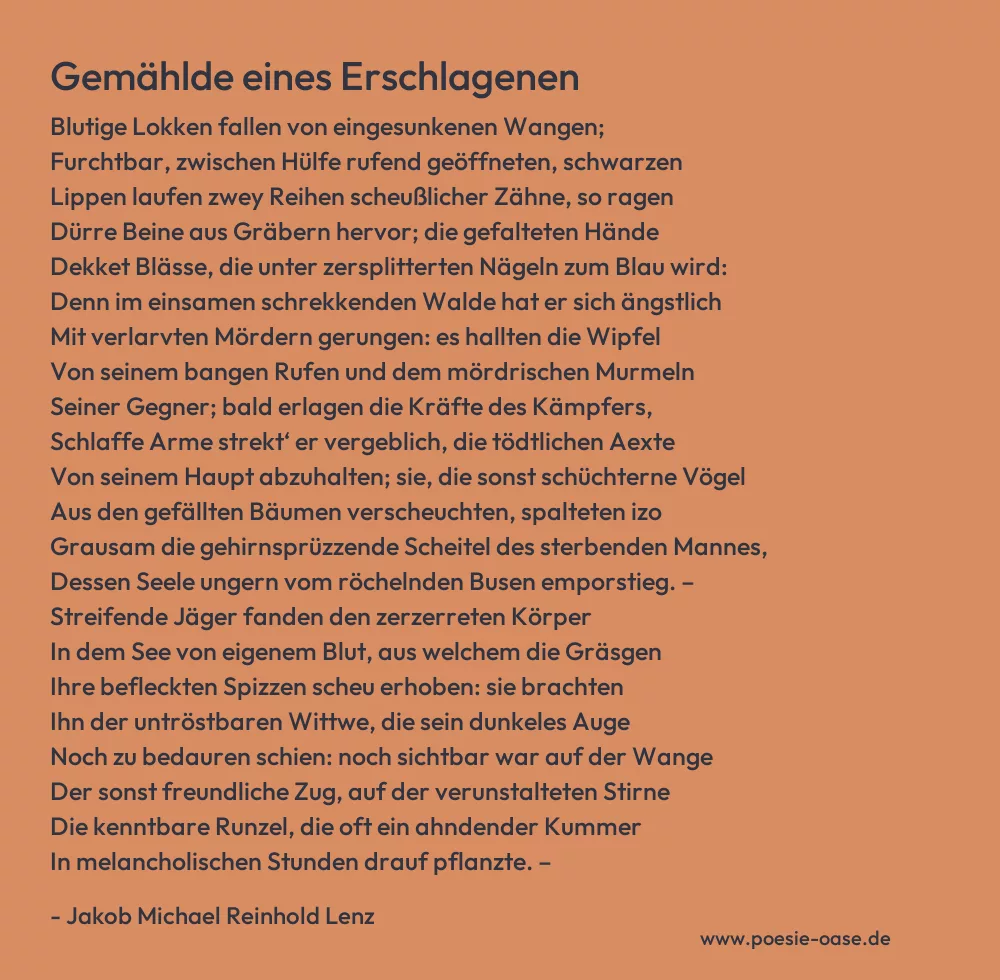
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Gemälde eines Erschlagenen“ von Jakob Michael Reinhold Lenz zeichnet das erschreckende und düstere Bild eines Mannes, der in einem verzweifelten, einsamen Kampf stirbt. Es wird eine grausame Szenerie beschrieben, die den physisch und psychisch zerstörten Körper des Kämpfers im Moment seines Todes festhält. Die blutigen „Lokken“, die von „eingesunkenen Wangen“ fallen, das „schwarze“ Öffnen der Lippen, und die „scheußlichen Zähne“ geben dem Gedicht eine nahezu groteske, beängstigende Drastik. Diese entstellte Darstellung des Leichnams betont die Brutalität des Kampfes und das Leiden, das der Mann während seines Todes erfahren muss.
Der Kampf selbst wird als qualvoll und von Angst durchzogen geschildert. Die „verlarvten Mörder“, mit denen der Mann kämpft, könnten für die Unsichtbarkeit und Grausamkeit seiner Gegner stehen. Das Bild der „tödlichen Äxte“, die den „Gehirnsprüzzenden Scheitel“ des Mannes aufspalten, ist ein starkes Symbol für die brutale Zerstörung des Körpers und des Lebens. Gleichzeitig wird der Mann als eine Figur dargestellt, die trotz aller Anstrengungen und Kämpfe gegen die Gewalt und die Hilflosigkeit ankämpft, was in der Beschreibung seiner „vergeblichen“ Armbewegungen und seiner unaufhörlichen „Rufen“ zum Ausdruck kommt.
In der zweiten Hälfte des Gedichts tritt ein Moment der Nachbetrachtung auf. Der zerfallene Körper des Mannes wird von Jägern gefunden, und seine Überreste sprechen von einem früheren Leben. Die „untröstbare Witwe“, die ihm das letzte Geleit gibt, deutet auf die tiefe emotionale Wirkung des Todes hin. Die „sichtbare“ Erinnerung an das „freundliche Zug“ in seinem Gesicht und die „kenntbare Runzel“ auf seiner Stirn verstärken die Dramatik des Gedichts, indem sie den Verlust eines liebenden Menschen zeigen, dessen Leben und Charakter nun von Gewalt und Entstellung überschattet sind.
Das Gedicht verwendet eine starke, fast qualvolle Bildsprache, um die Gewalt des Todes und die Unvermeidbarkeit des menschlichen Leidens darzustellen. Es ist ein scharfer Kommentar zur Grausamkeit des Lebens und zum Schicksal des Individuums, das, trotz seiner Verletzlichkeit und des Kampfes, letztlich im Angesicht des Todes auf sich allein gestellt ist. Der Kontrast zwischen der äußeren Zerstörung des Körpers und den emotionalen Erinnerungen, die an den Toten haften bleiben, verstärkt das tragische Element des Gedichts.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.