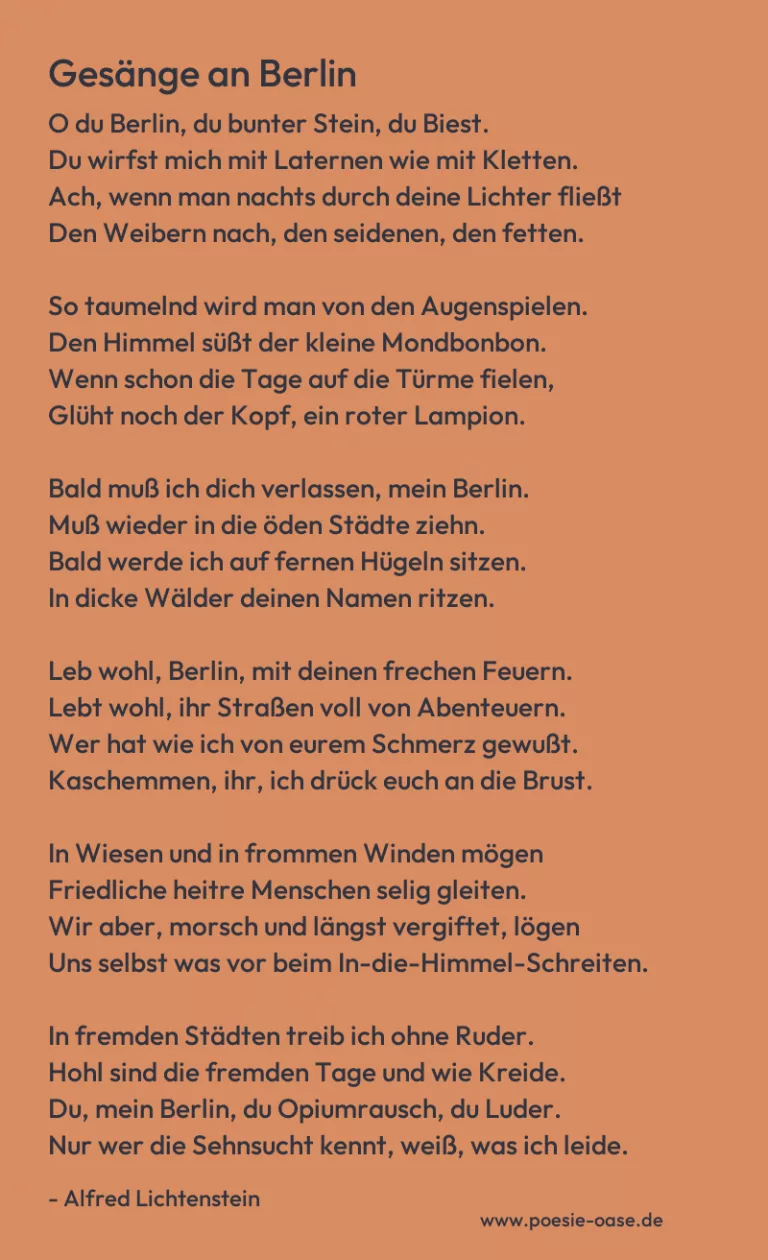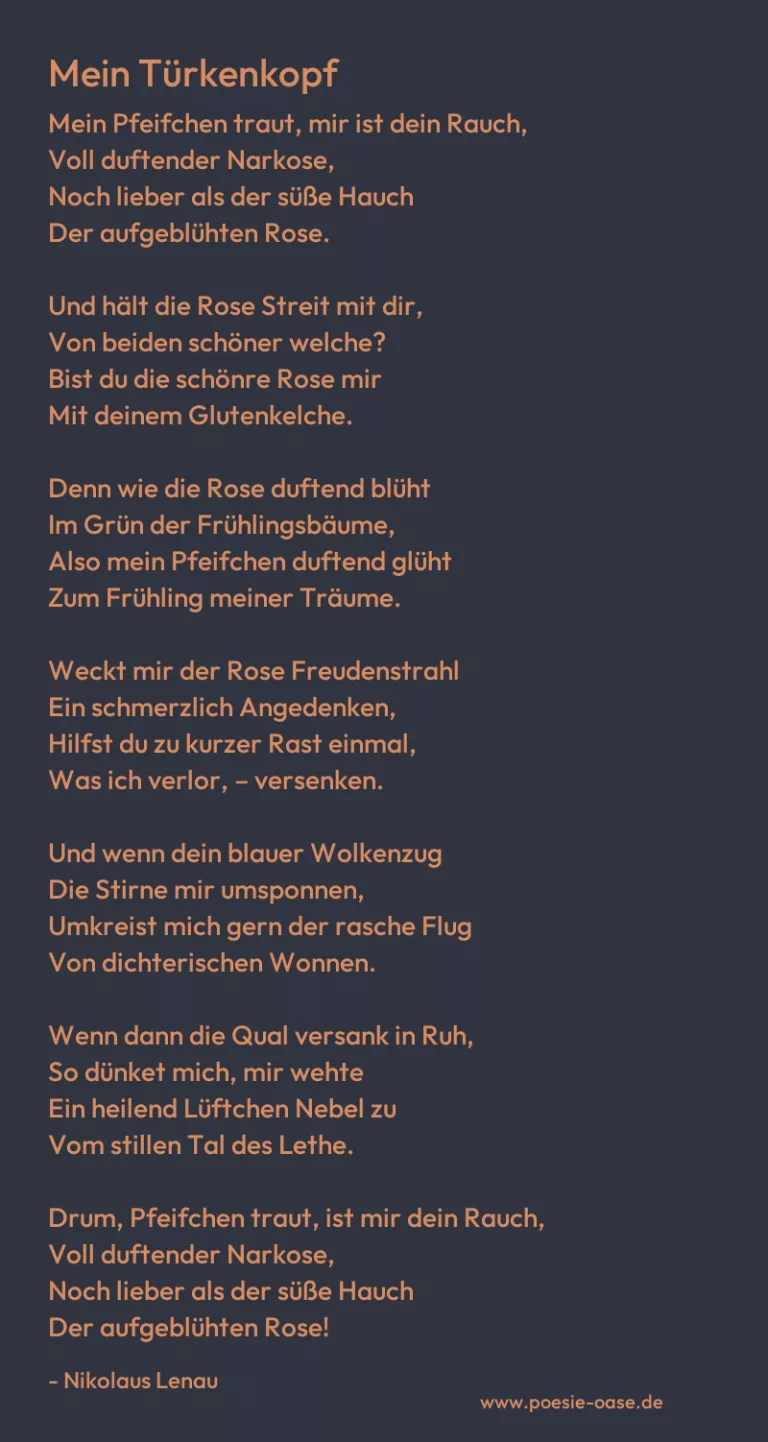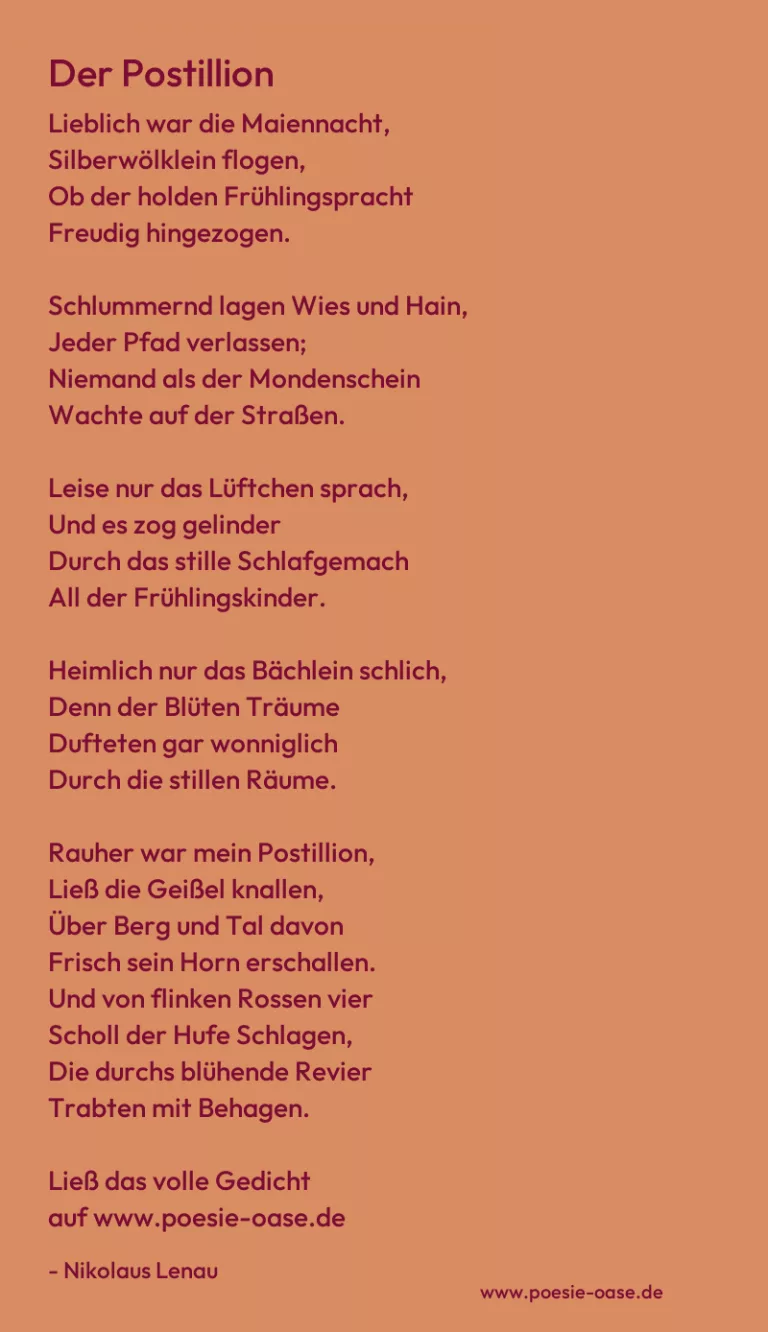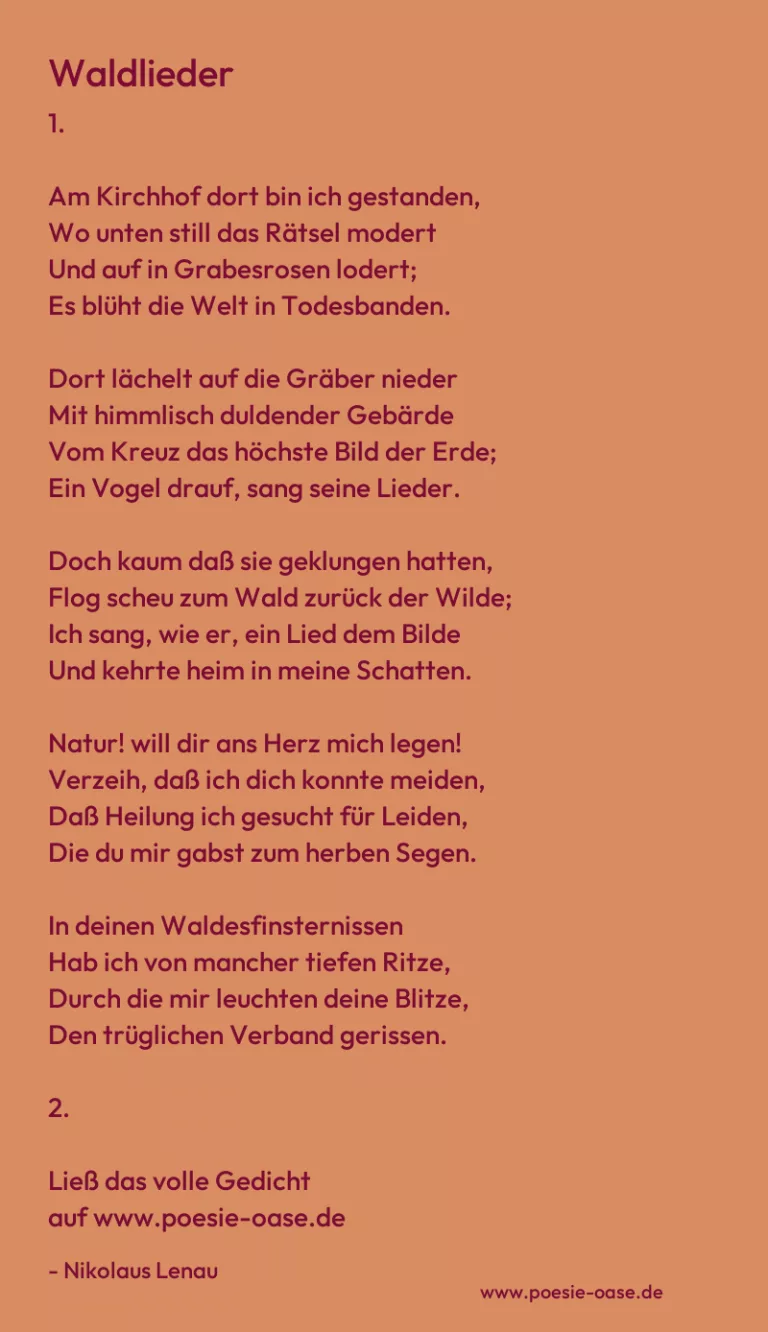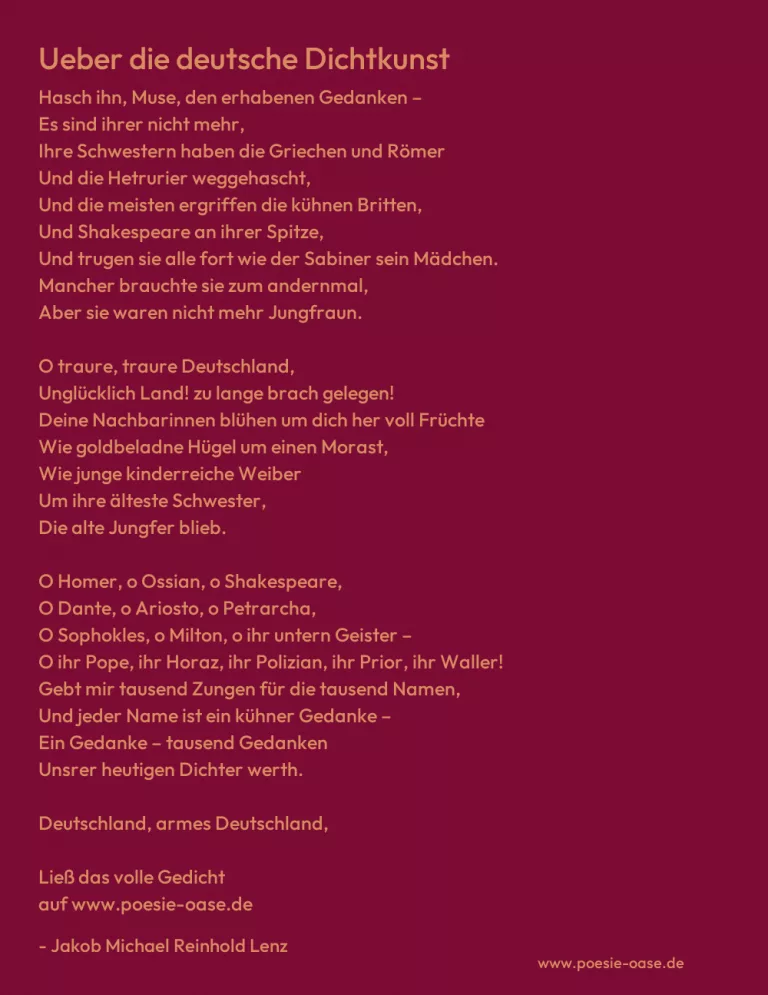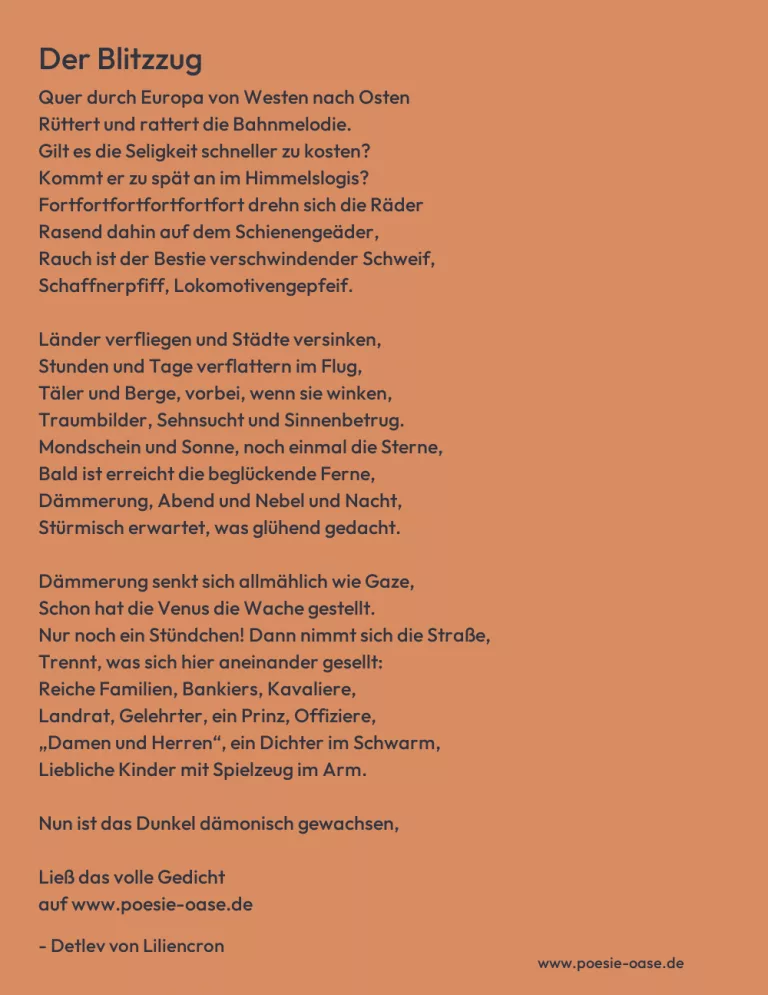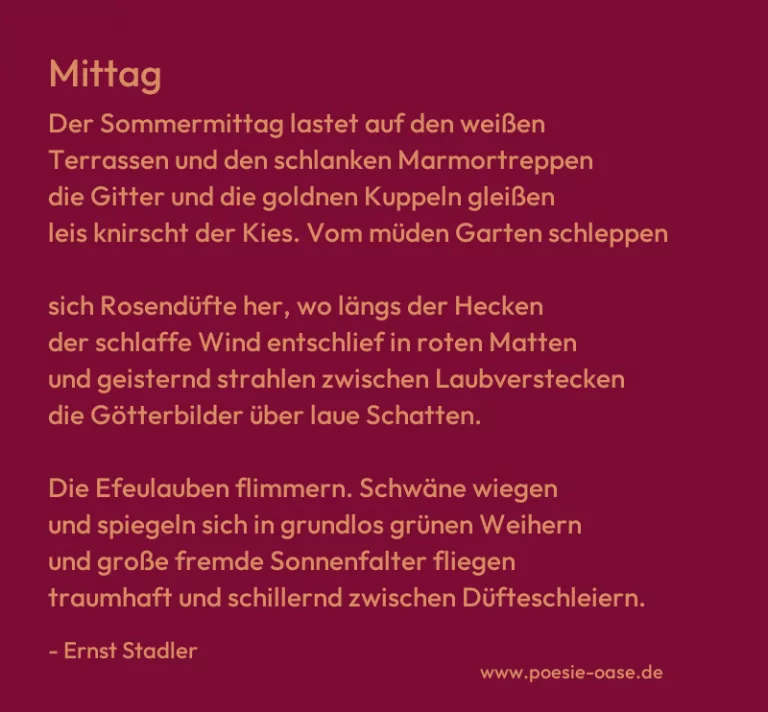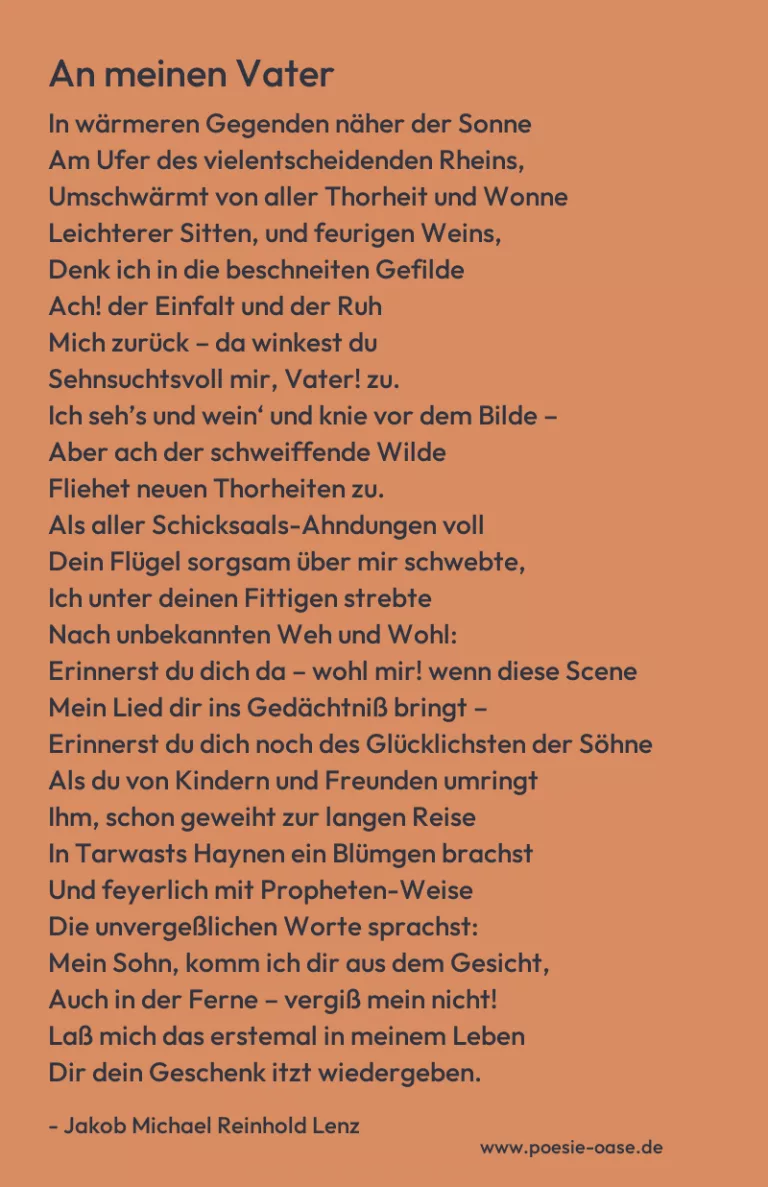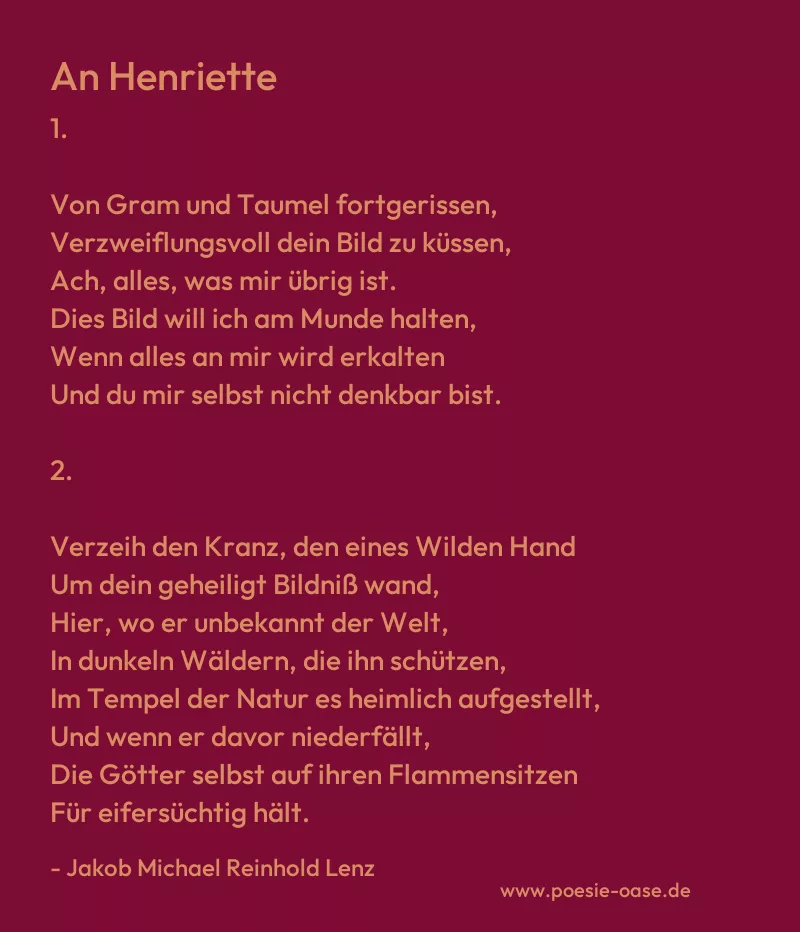An Henriette
1.
Von Gram und Taumel fortgerissen,
Verzweiflungsvoll dein Bild zu küssen,
Ach, alles, was mir übrig ist.
Dies Bild will ich am Munde halten,
Wenn alles an mir wird erkalten
Und du mir selbst nicht denkbar bist.
2.
Verzeih den Kranz, den eines Wilden Hand
Um dein geheiligt Bildniß wand,
Hier, wo er unbekannt der Welt,
In dunkeln Wäldern, die ihn schützen,
Im Tempel der Natur es heimlich aufgestellt,
Und wenn er davor niederfällt,
Die Götter selbst auf ihren Flammensitzen
Für eifersüchtig hält.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
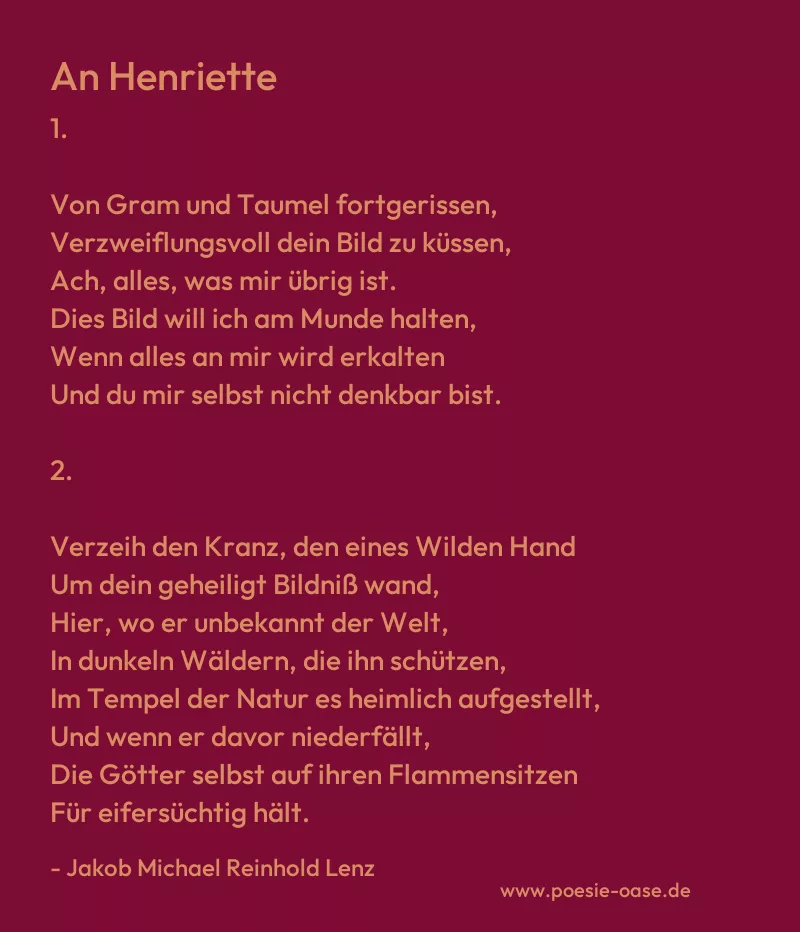
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An Henriette“ von Jakob Michael Reinhold Lenz zeigt eine intensive und leidenschaftliche Reflexion über Liebe und Verlust. Der Sprecher ist von tiefer Verzweiflung und innerer Zerrissenheit ergriffen, die ihn dazu treiben, das Bild der geliebten Henriette als einzigen Trost in einer Welt zu betrachten, die für ihn zunehmend kalt und leer wird. In der ersten Strophe beschreibt er, wie er sich von Gram und Taumel fortgerissen fühlt, und das Bild von Henriette wird zu einem symbolischen Anker, der ihm im Angesicht seiner inneren Leere Halt gibt. Das Bild ist nicht nur ein Erinnerungsstück, sondern eine Quelle der Sehnsucht und des Trostes, die ihm in seiner Verzweiflung das Gefühl vermittelt, „etwas“ zu besitzen, selbst wenn alles andere in ihm „erkaltet“.
Die zweite Strophe bringt eine mystische und fast religiöse Dimension in das Gedicht. Der Sprecher bittet um Verzeihung für den „Kranz“, den er aus den Händen eines „Wilden“ um das Bild von Henriette gelegt hat. Dieser Kranz und der Akt des Aufstellens des Bildnisses in einem „Tempel der Natur“ sind tief symbolisch und verweben die Themen von Verehrung und der heiligen Bedeutung des Bildes. Der „Wilde“, der den Kranz niederlegt, könnte für eine Form von ungestümer, fast instinktiver Liebe stehen, die in einer heiligen Umgebung stattfindet. Der „Tempel der Natur“ und das Bild von Henriette in diesem Tempel stellen eine Verbindung zwischen der irdischen und der spirituellen Welt dar, was der Liebe eine fast göttliche Qualität verleiht.
Die Vorstellung, dass „die Götter selbst auf ihren Flammensitzen für eifersüchtig“ gehalten werden, verstärkt die Idee, dass die Liebe des Sprechers zu Henriette nicht nur menschlich, sondern auch universell und übernatürlich ist. Die Eifersucht der Götter könnte als Ausdruck der Intensität und Exklusivität der Liebe verstanden werden, die der Sprecher empfindet. Diese Liebe ist nicht nur eine weltliche Angelegenheit, sondern eine Leidenschaft, die die Grenzen des Menschlichen überschreitet und in den Bereich des Göttlichen und Unnahbaren vordringt. Das Gedicht zeigt somit eine innige Verehrung, die in einer Mischung aus Verzweiflung, Sehnsucht und einem Hauch von göttlicher Anbetung schwingt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.