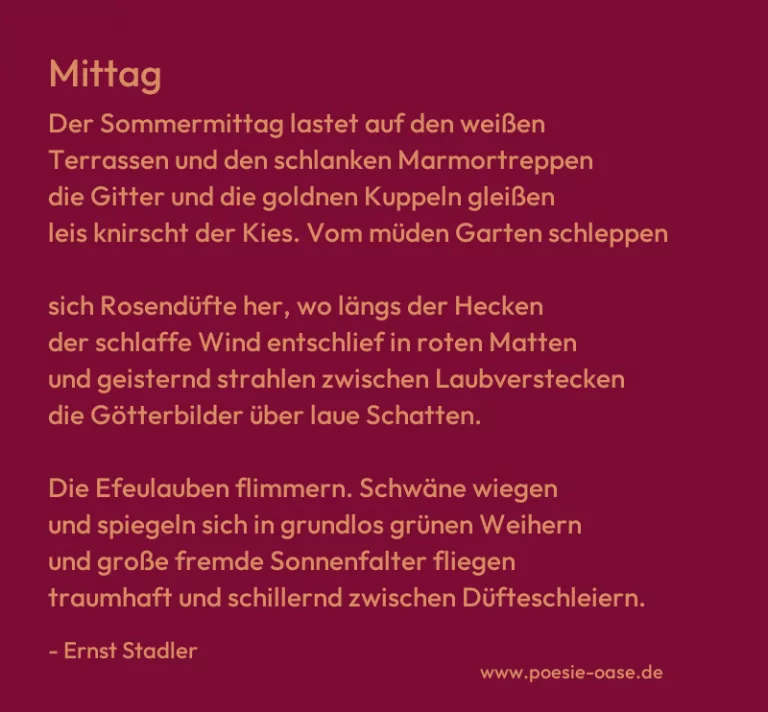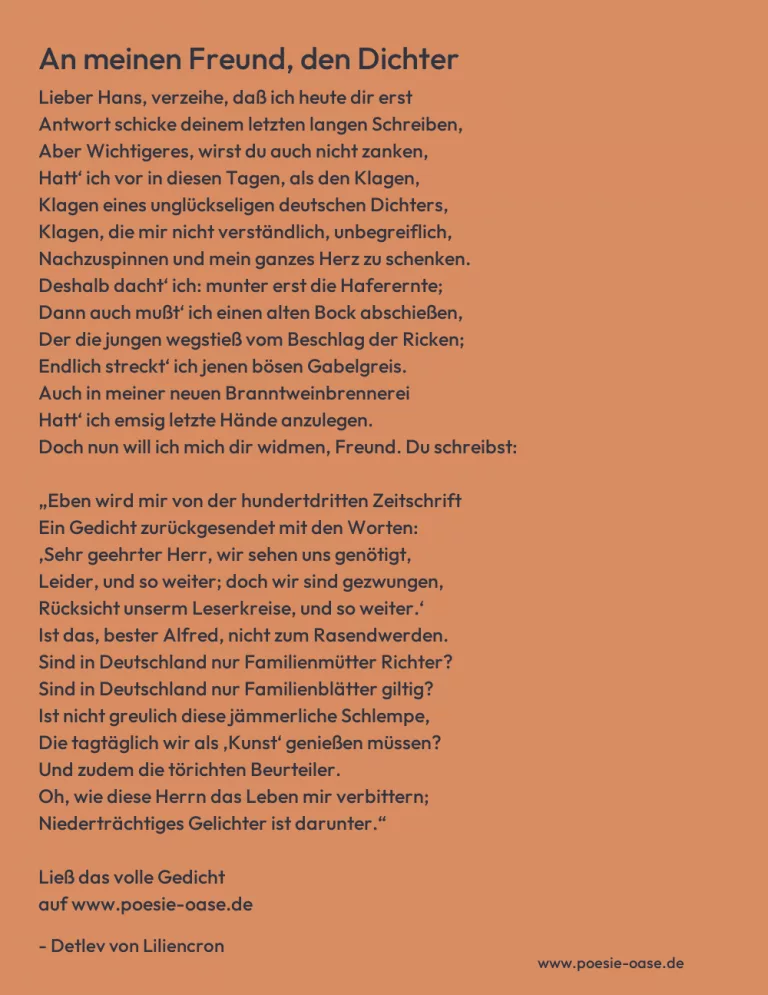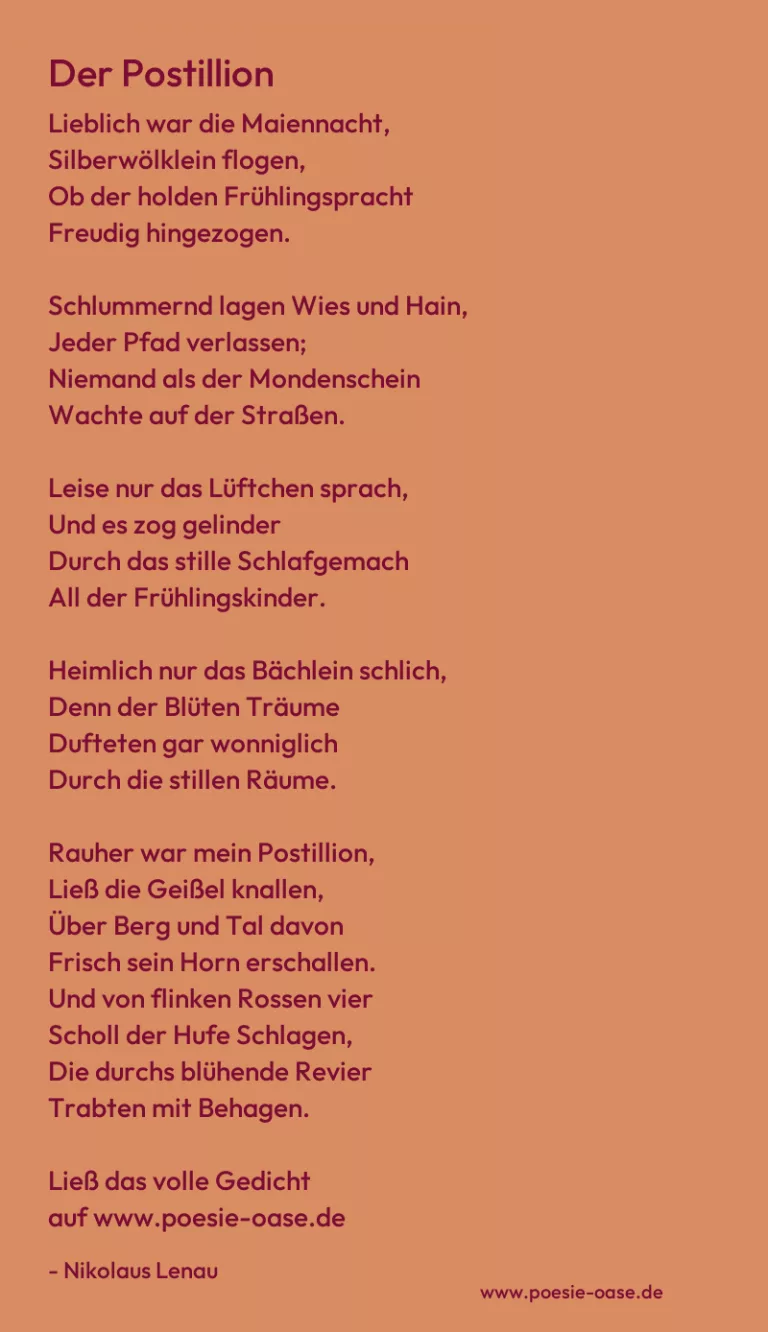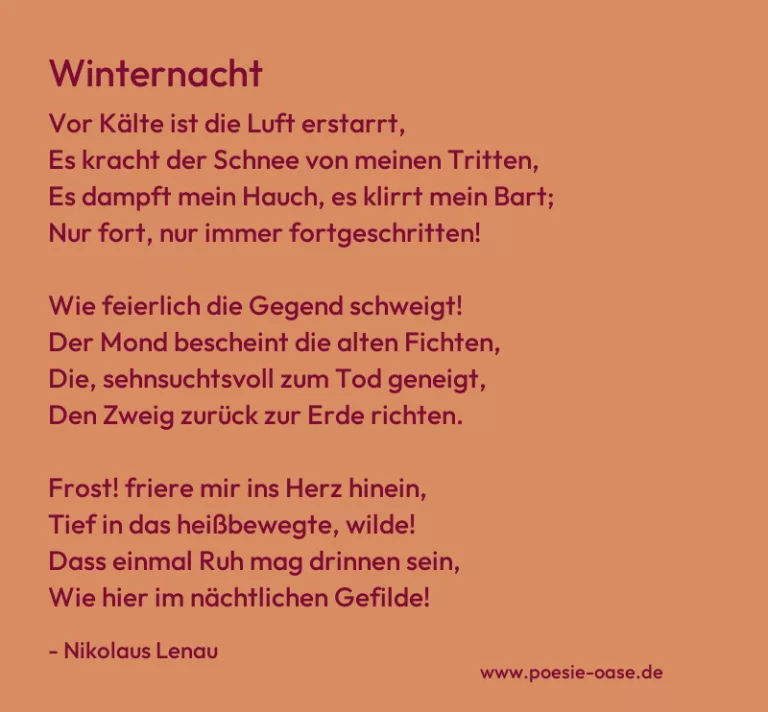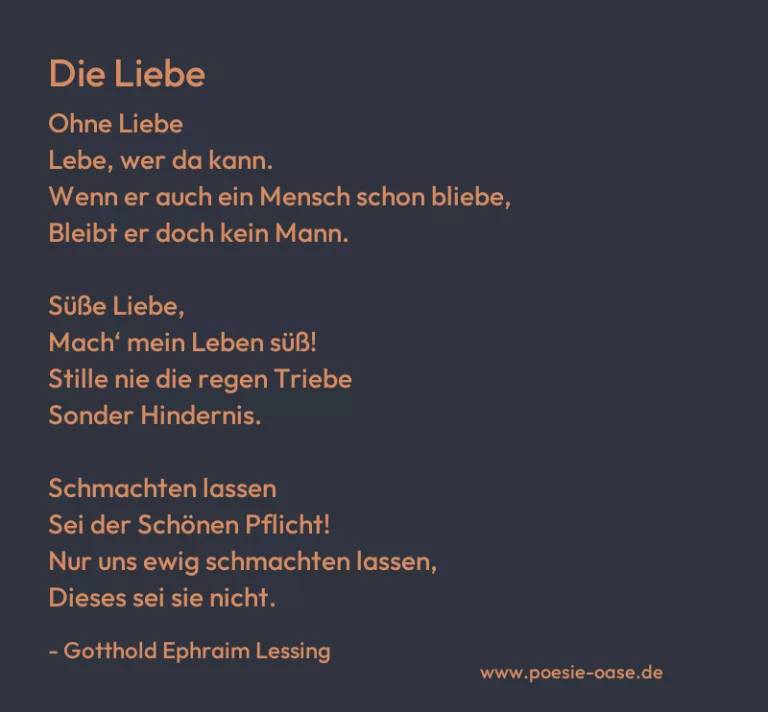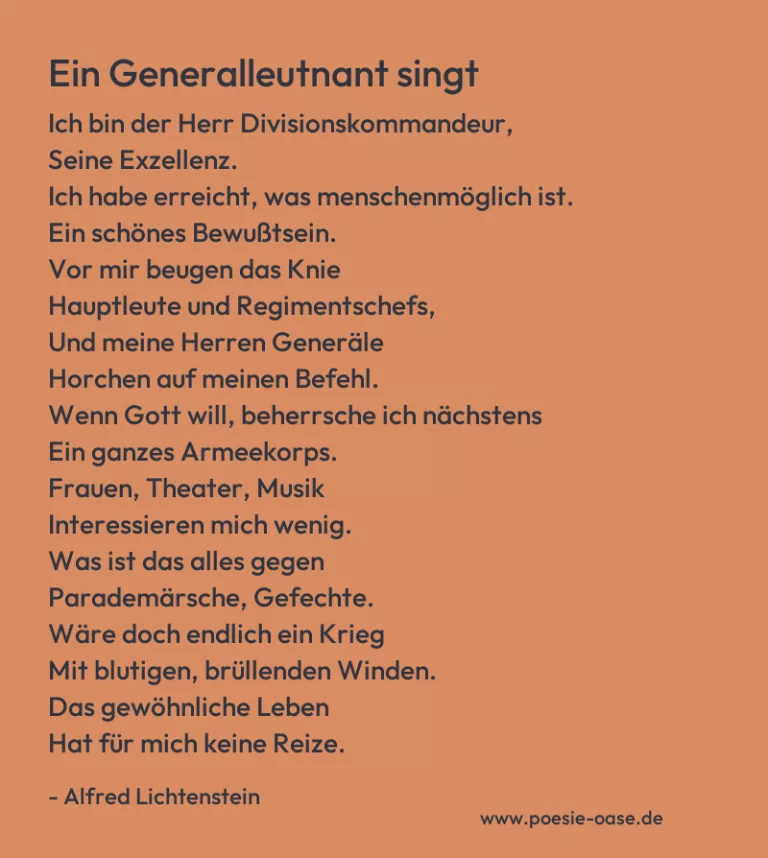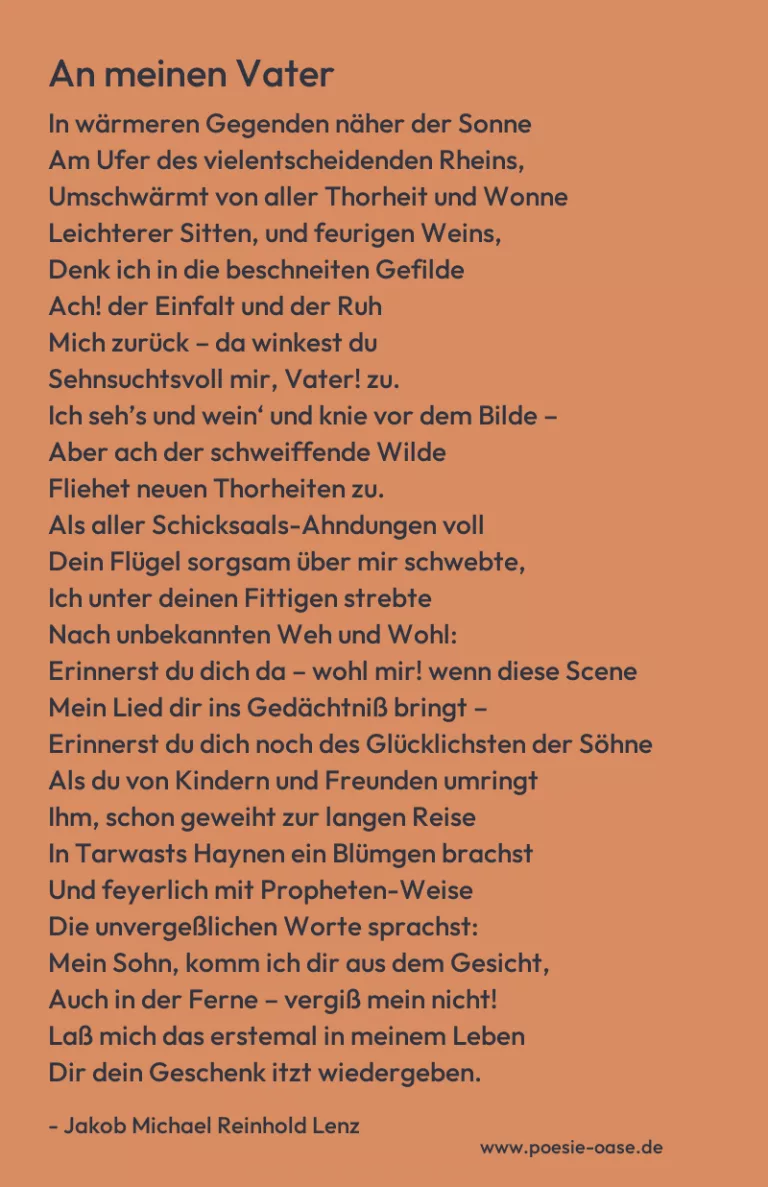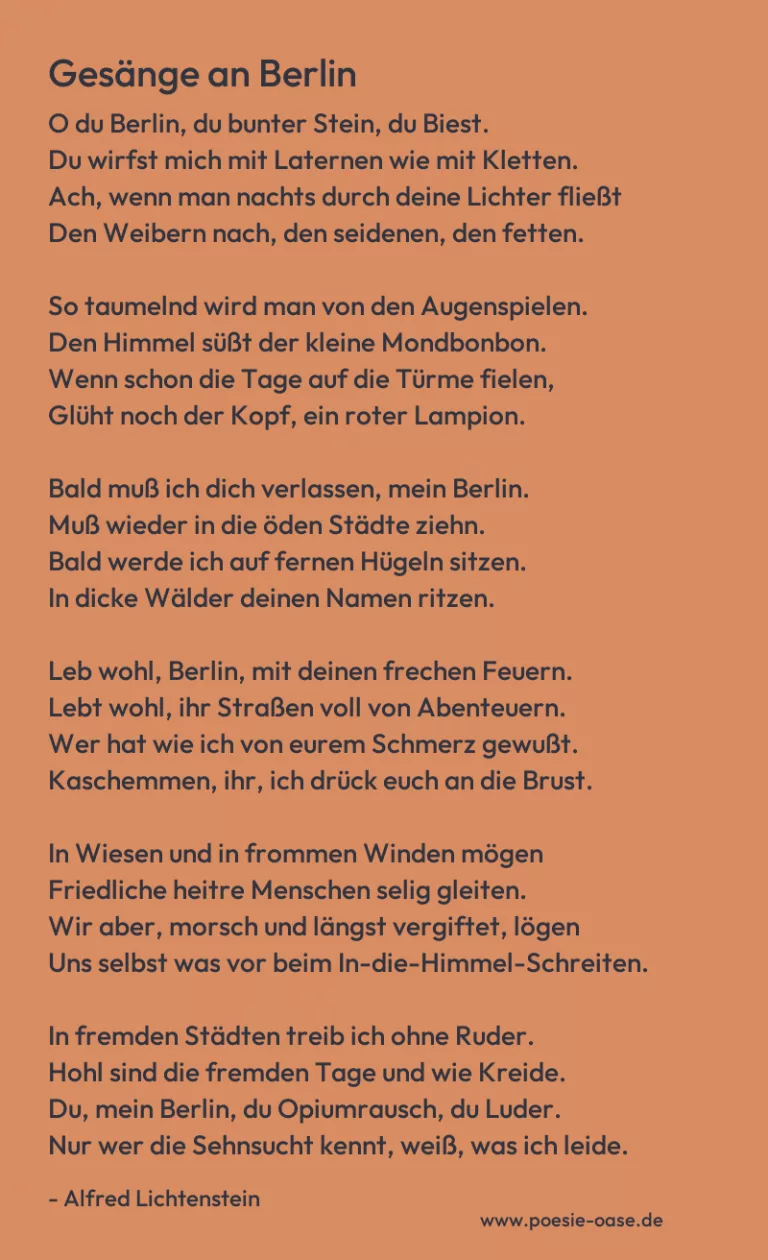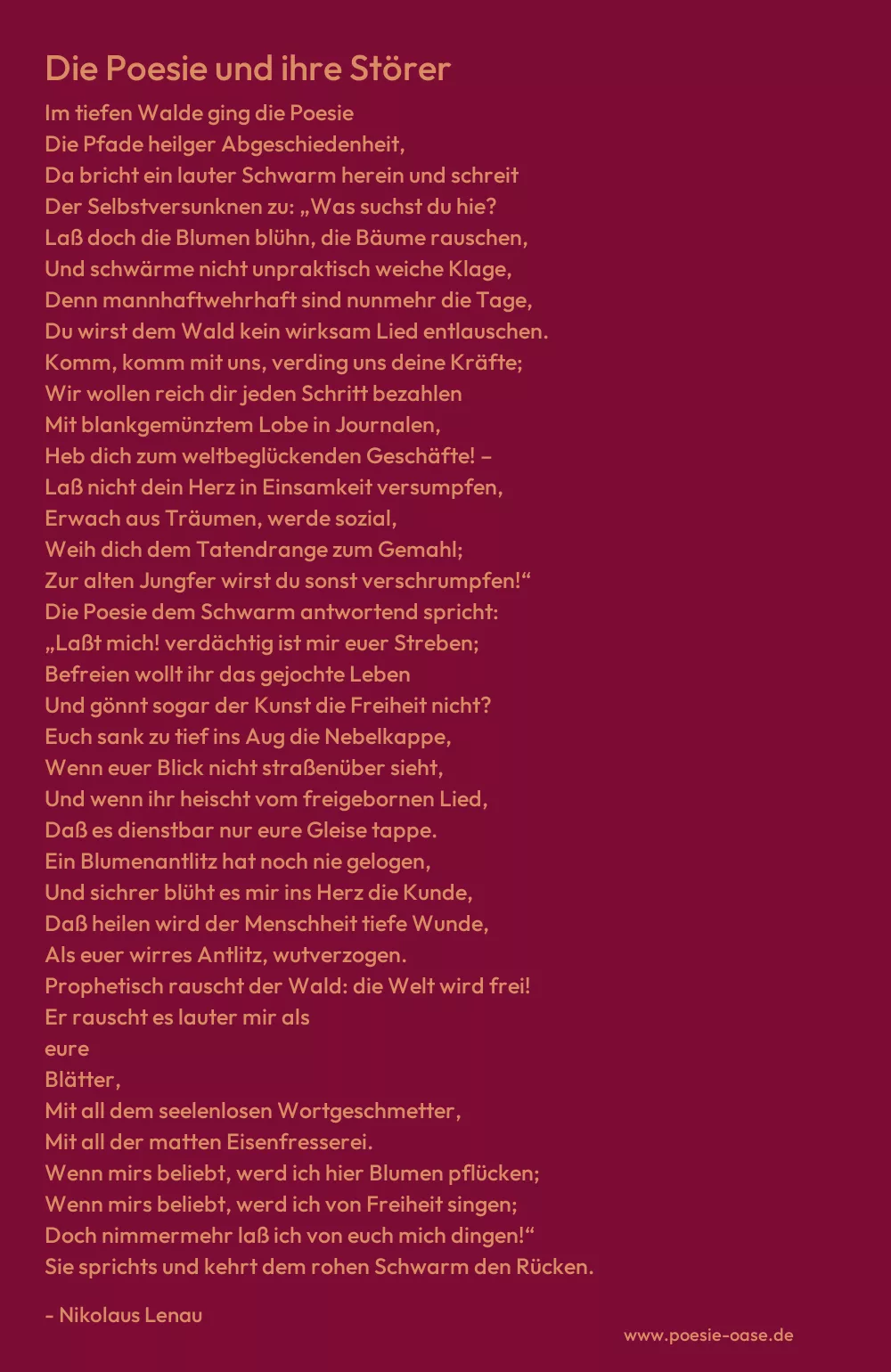Alltag, Einsamkeit, Emotionen & Gefühle, Fleiß, Frieden, Frühling, Gegenwart, Gemeinfrei, Helden & Prinzessinnen, Herzschmerz, Leichtigkeit, Liebe & Romantik, Märchen & Fantasie, Spiritualität, Wagnisse, Wälder & Bäume, Weisheiten
Die Poesie und ihre Störer
Im tiefen Walde ging die Poesie
Die Pfade heilger Abgeschiedenheit,
Da bricht ein lauter Schwarm herein und schreit
Der Selbstversunknen zu: „Was suchst du hie?
Laß doch die Blumen blühn, die Bäume rauschen,
Und schwärme nicht unpraktisch weiche Klage,
Denn mannhaftwehrhaft sind nunmehr die Tage,
Du wirst dem Wald kein wirksam Lied entlauschen.
Komm, komm mit uns, verding uns deine Kräfte;
Wir wollen reich dir jeden Schritt bezahlen
Mit blankgemünztem Lobe in Journalen,
Heb dich zum weltbeglückenden Geschäfte! –
Laß nicht dein Herz in Einsamkeit versumpfen,
Erwach aus Träumen, werde sozial,
Weih dich dem Tatendrange zum Gemahl;
Zur alten Jungfer wirst du sonst verschrumpfen!“
Die Poesie dem Schwarm antwortend spricht:
„Laßt mich! verdächtig ist mir euer Streben;
Befreien wollt ihr das gejochte Leben
Und gönnt sogar der Kunst die Freiheit nicht?
Euch sank zu tief ins Aug die Nebelkappe,
Wenn euer Blick nicht straßenüber sieht,
Und wenn ihr heischt vom freigebornen Lied,
Daß es dienstbar nur eure Gleise tappe.
Ein Blumenantlitz hat noch nie gelogen,
Und sichrer blüht es mir ins Herz die Kunde,
Daß heilen wird der Menschheit tiefe Wunde,
Als euer wirres Antlitz, wutverzogen.
Prophetisch rauscht der Wald: die Welt wird frei!
Er rauscht es lauter mir als
eure
Blätter,
Mit all dem seelenlosen Wortgeschmetter,
Mit all der matten Eisenfresserei.
Wenn mirs beliebt, werd ich hier Blumen pflücken;
Wenn mirs beliebt, werd ich von Freiheit singen;
Doch nimmermehr laß ich von euch mich dingen!“
Sie sprichts und kehrt dem rohen Schwarm den Rücken.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
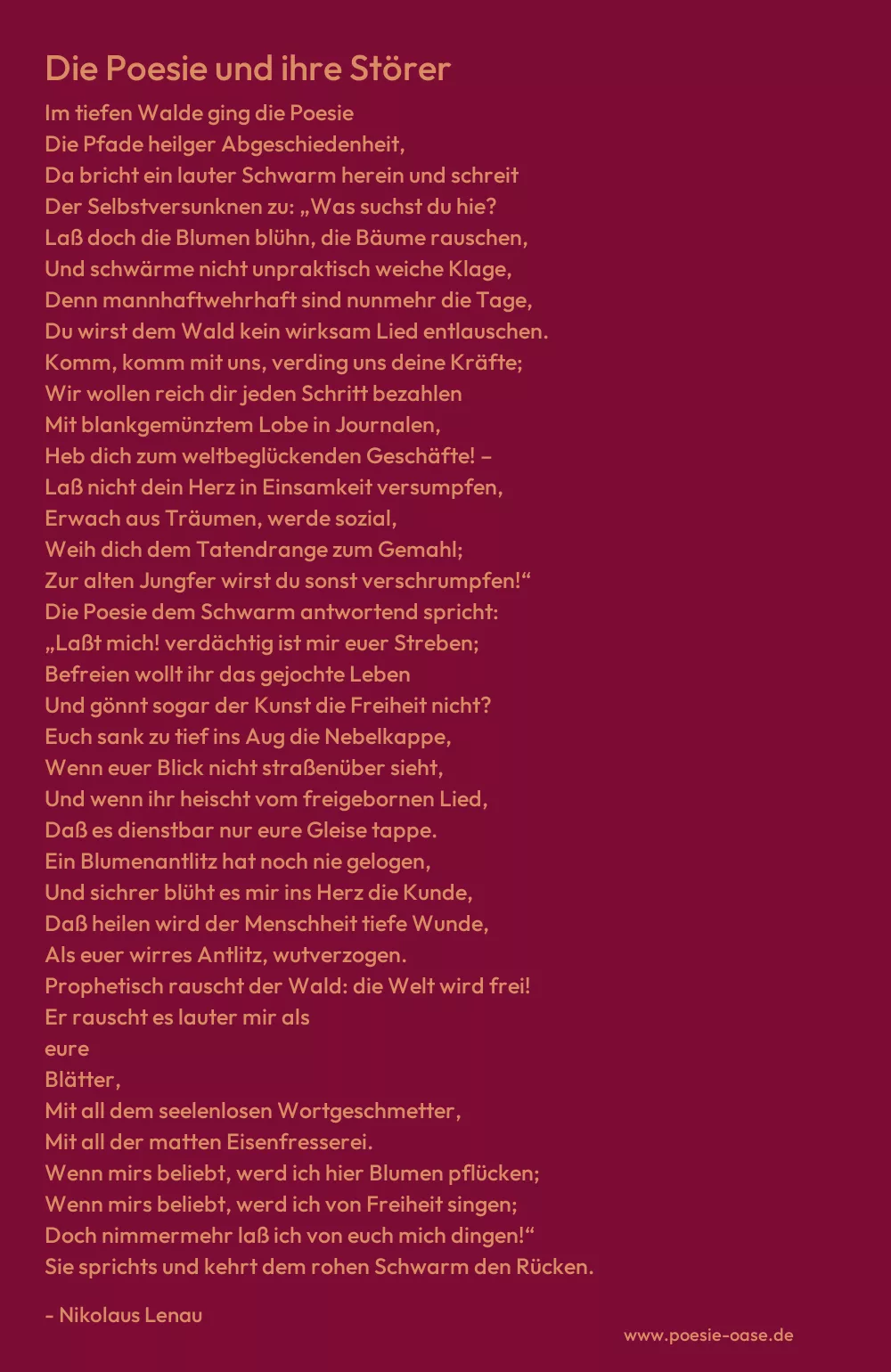
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Poesie und ihre Störer“ von Nikolaus Lenau thematisiert den Konflikt zwischen künstlerischer Innerlichkeit und den Forderungen einer zunehmend materialistisch und pragmatisch geprägten Gesellschaft. In einer allegorischen Darstellung trifft die Poesie, personifiziert als weibliche Gestalt, auf eine laute, fordernde Menschenmenge, die versucht, sie in ihren Dienst zu stellen und ihre Freiheit zu beschneiden.
Der erste Teil des Gedichts zeichnet das Bild der Poesie als stilles, versunkenes Wesen, das im Schutzraum des Waldes seine Inspiration sucht. Dieser Rückzugsort steht für Innerlichkeit, Naturverbundenheit und geistige Unabhängigkeit. Der „laute Schwarm“ stört diese Abgeschiedenheit mit Forderungen nach gesellschaftlichem Nutzen, Aktivismus und Anerkennung in der Öffentlichkeit. Der Ton dieser Menge ist belehrend, herablassend und drängt die Poesie zur Anpassung an die „mannhaftwehrhaften“ Zeiten.
Die Poesie jedoch wehrt sich mit Nachdruck gegen diese Instrumentalisierung. In ihrer Antwort verweist sie auf die Heuchelei derer, die angeblich Freiheit bringen wollen, aber nicht einmal der Kunst ihre Freiheit zugestehen. Ihre Kritik richtet sich gegen eine Gesellschaft, die nur auf das Nützliche, Messbare und Lautstarke setzt – und dabei die heilende, tiefere Wahrheit des Schönen und Stillen verkennt. Die Poesie erkennt im Wald, im Natursymbol, eine stärkere und wahrhaftigere Freiheitsverheißung als in den Reden und Schriften ihrer Gegner.
Zugleich lehnt sie das Versprechen materieller Anerkennung („blankgemünztes Lobe in Journalen“) entschieden ab. Der poetische Geist lässt sich nicht kaufen und nicht zwingen. Die abschließende Geste – dass sie dem Schwarm den Rücken kehrt – symbolisiert den unbeirrten Rückzug in die geistige Freiheit, die nicht mit dem gesellschaftlichen Nutzenkalkül kompatibel ist.
Lenau verteidigt hier mit leidenschaftlicher Sprache die Autonomie der Kunst und warnt vor einer Zeit, in der alles dem Zweckdenken untergeordnet wird. Das Gedicht ist nicht nur ein Plädoyer für die Poesie, sondern auch ein Appell, der inneren Stimme und der Schönheit Raum zu lassen – als Quelle wirklicher, nicht bloß äußerlicher Freiheit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.