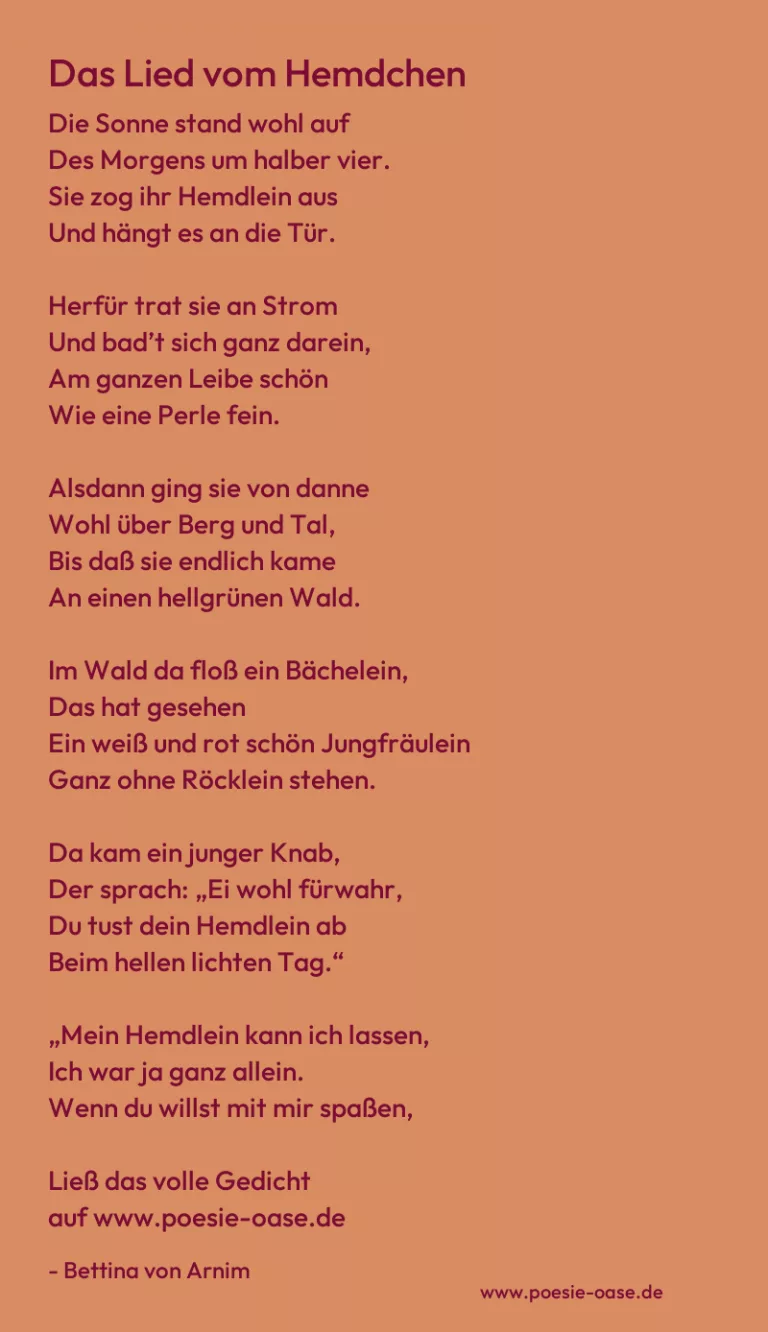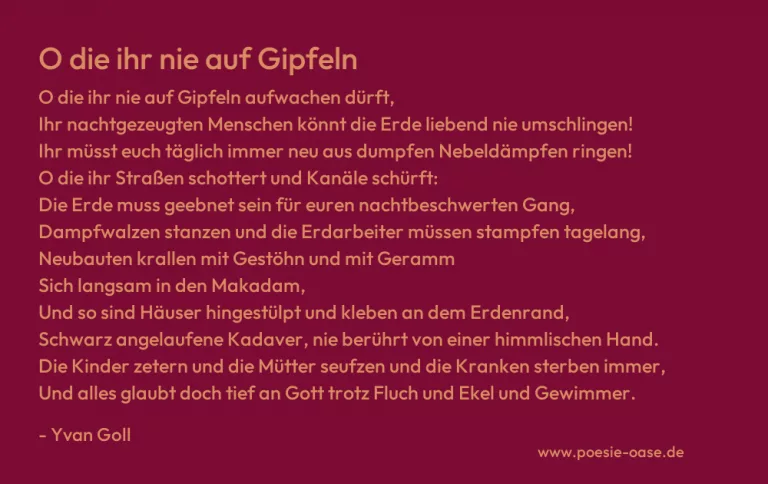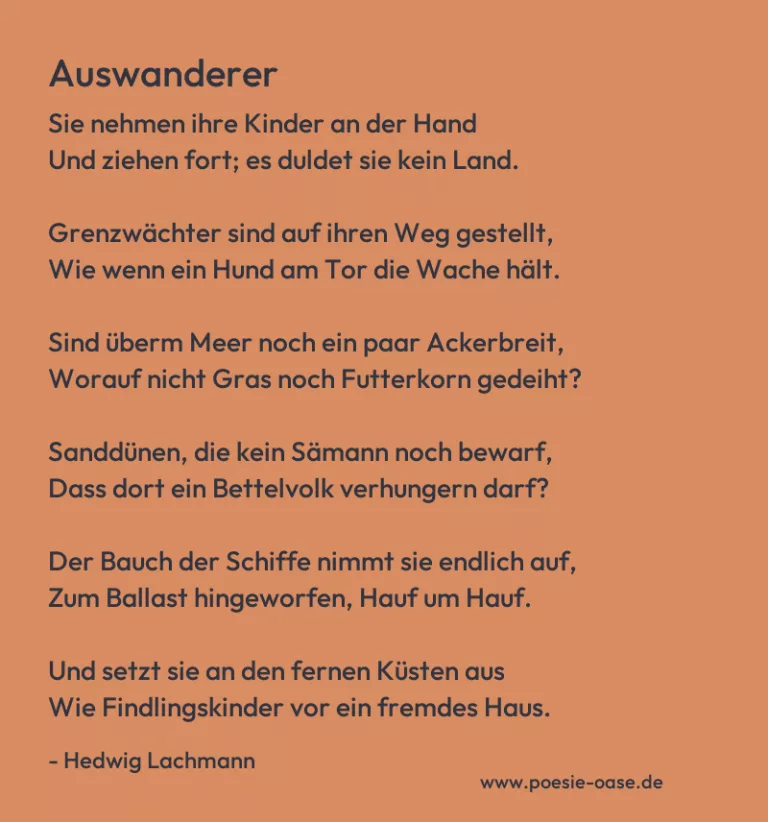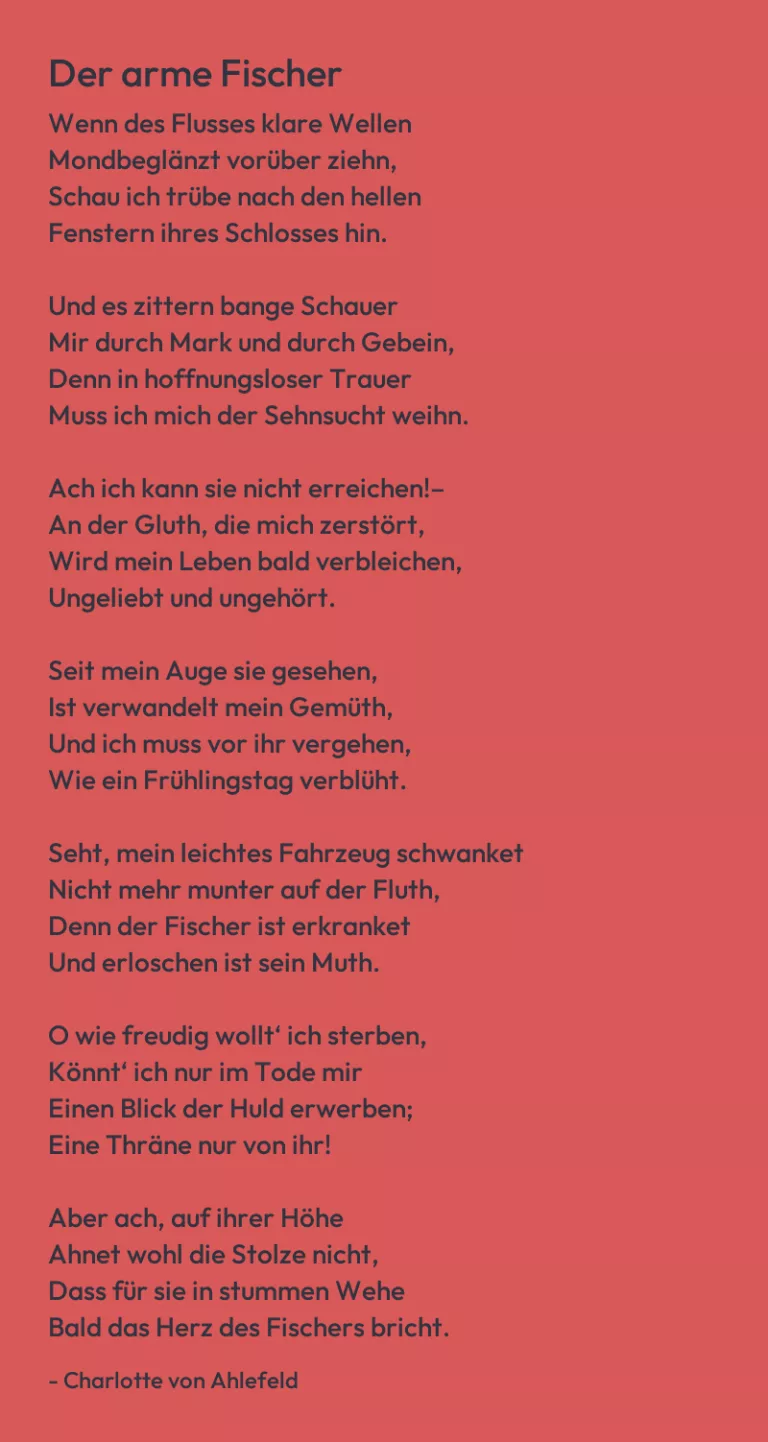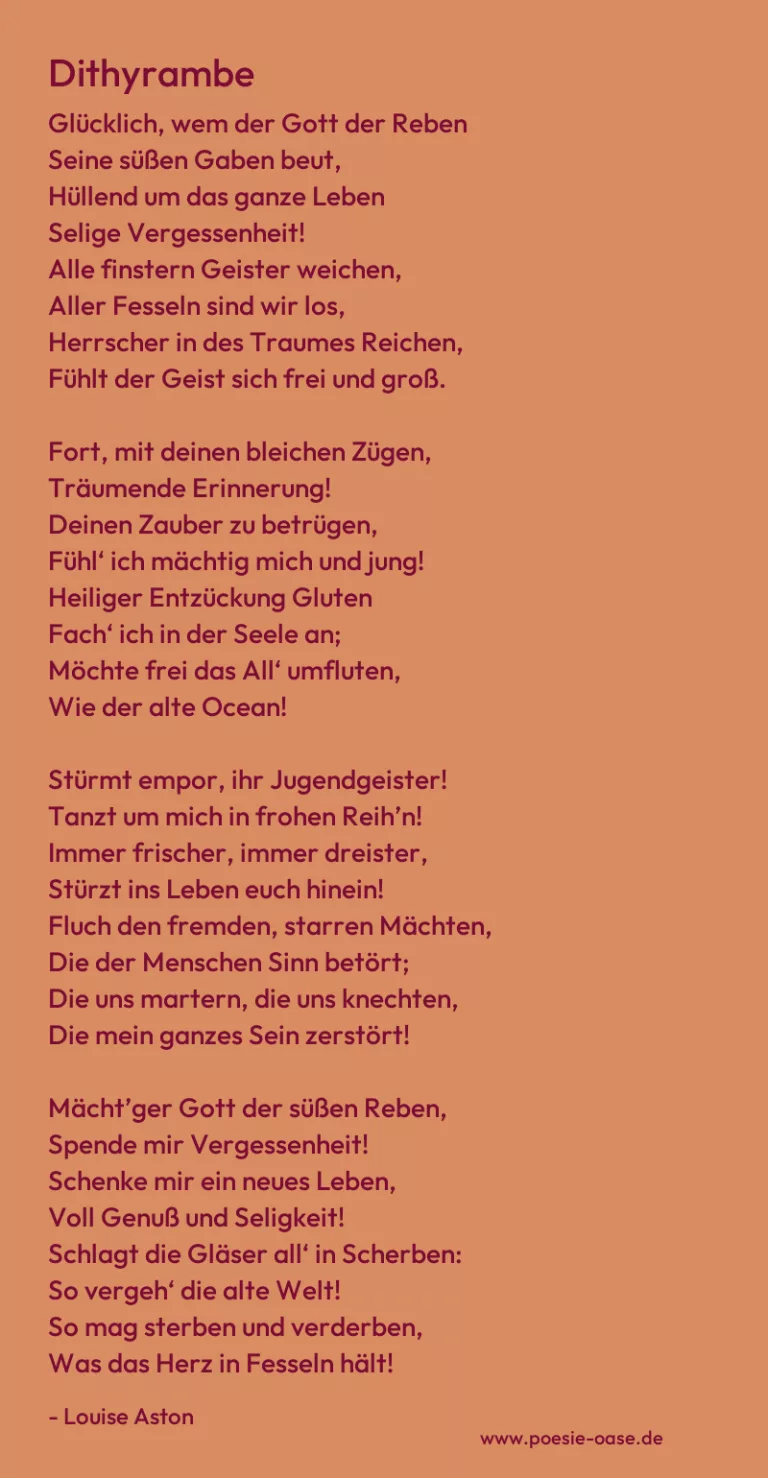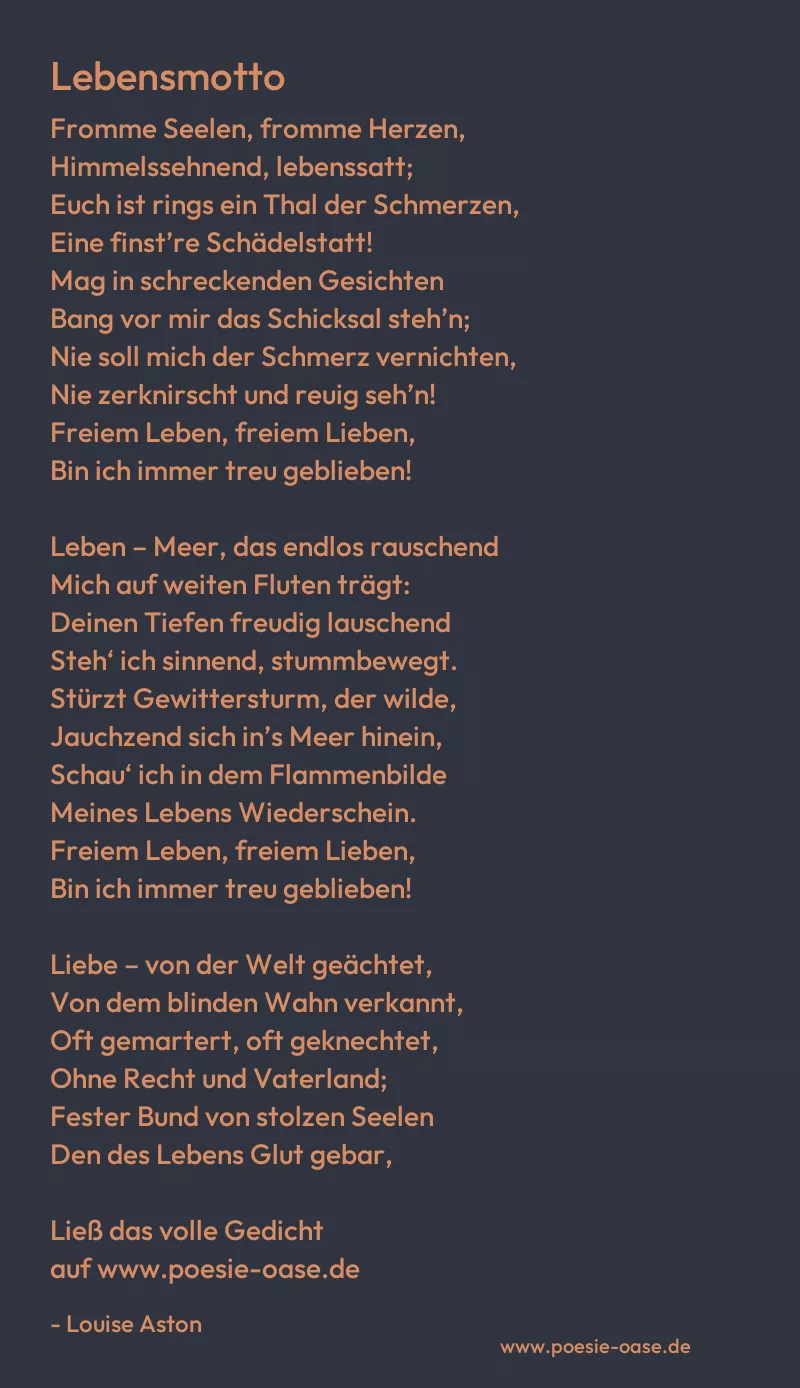Fromme Seelen, fromme Herzen,
Himmelssehnend, lebenssatt;
Euch ist rings ein Thal der Schmerzen,
Eine finst’re Schädelstatt!
Mag in schreckenden Gesichten
Bang vor mir das Schicksal steh’n;
Nie soll mich der Schmerz vernichten,
Nie zerknirscht und reuig seh’n!
Freiem Leben, freiem Lieben,
Bin ich immer treu geblieben!
Leben – Meer, das endlos rauschend
Mich auf weiten Fluten trägt:
Deinen Tiefen freudig lauschend
Steh‘ ich sinnend, stummbewegt.
Stürzt Gewittersturm, der wilde,
Jauchzend sich in’s Meer hinein,
Schau‘ ich in dem Flammenbilde
Meines Lebens Wiederschein.
Freiem Leben, freiem Lieben,
Bin ich immer treu geblieben!
Liebe – von der Welt geächtet,
Von dem blinden Wahn verkannt,
Oft gemartert, oft geknechtet,
Ohne Recht und Vaterland;
Fester Bund von stolzen Seelen
Den des Lebens Glut gebar,
Freier Herzen freies Wählen
Vor der Schöpfung Hochaltar!
Freiem Leben, freiem Lieben,
Bin ich immer treu geblieben!
Und so lang‘ die Pulse beben,
Bis zum letzten Athemzug,
Weih‘ der Liebe ich dies Leben,
Ihrem Segen, ihrem Fluch!
Schöne Welt, du blühend Eden,
Deiner Freuden reicher Schatz
Giebt für alle Schicksals Fehden
Vollen, köstlichen Ersatz!
Freiem Lieben, freiem Leben,
Hab‘ ich ewig mich ergeben!