Ich, der brennende Wüstenwind,
erkaltete und nahm Gestalt an.
Wo ist die Sonne, die mich auflösen kann,
oder der Blitz, der mich zerschmettern kann!
Blick‘ nun: ein steinernes Sphinxhaupt,
zürnend zu allen Himmeln auf.
Ich, der brennende Wüstenwind,
erkaltete und nahm Gestalt an.
Wo ist die Sonne, die mich auflösen kann,
oder der Blitz, der mich zerschmettern kann!
Blick‘ nun: ein steinernes Sphinxhaupt,
zürnend zu allen Himmeln auf.
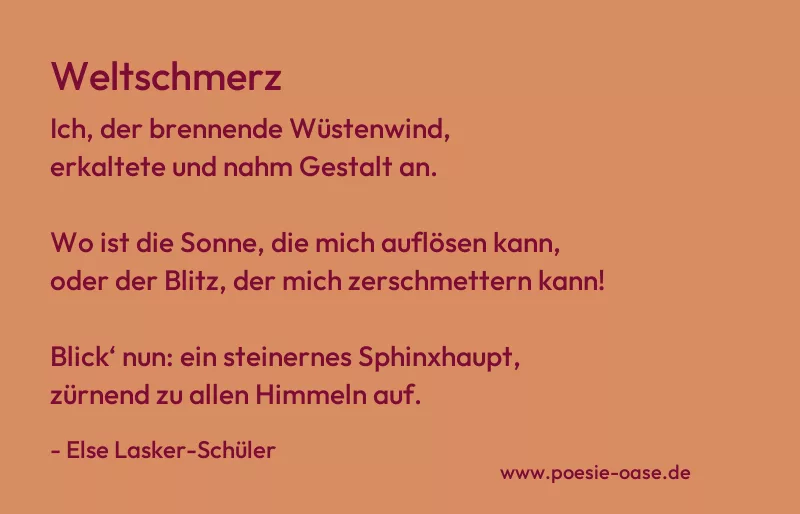
Das Gedicht „Weltschmerz“ von Else Lasker-Schüler thematisiert die existenzielle Erstarrung des Ichs und die Sehnsucht nach einer alles überwindenden, befreienden Kraft. Es ist eine verdichtete Klage über innere Verhärtung und emotionale Isolation, verbunden mit einer tiefen Lebensmüdigkeit. Der Begriff „Weltschmerz“ selbst steht für eine melancholische Grundhaltung, ein Leiden an der Welt, das hier in kraftvolle, symbolhafte Bilder gefasst wird.
Die erste Zeile stellt das lyrische Ich als „brennenden Wüstenwind“ vor – ein Symbol für Energie, Leidenschaft, Bewegung und innere Glut. Doch dieser Wind „erkaltete und nahm Gestalt an“: Aus Energie wird Form, aus Bewegung wird Stillstand. Das Ich verwandelt sich von einem dynamischen Naturphänomen in etwas Starres – eine Metapher für seelische Verhärtung und das Ende eines emotionalen oder kreativen Flusses.
In der zweiten Strophe richtet sich der Blick des lyrischen Ichs auf mögliche Auswege aus diesem Zustand: Die Sonne, die es auflösen könnte, oder der Blitz, der es zerschmettern könnte. Beides sind mächtige Naturkräfte, die einer höheren Ordnung angehören – entweder Erlösung oder Zerstörung. Diese Zeilen deuten auf eine tiefe Verzweiflung hin, in der selbst ein gewaltsames Ende als erlösender als der gegenwärtige Zustand empfunden wird.
Das Gedicht endet mit dem eindrucksvollen Bild eines „steinernen Sphinxhauptes“, das „zürnend zu allen Himmeln aufblickt“. Die Sphinx steht für Rätsel, Starrheit und eine rätselhafte, unerlöste Existenz. Dass sie aus Stein ist, verstärkt den Eindruck völliger Erstarrung. Der zürnende Blick zu allen Himmeln signalisiert eine Rebellion gegen das Schicksal, gegen Götter oder das Leben selbst – ein stummer, aber kraftvoller Ausdruck inneren Widerstands.
Insgesamt verdichtet Else Lasker-Schüler in wenigen Versen eine tiefe seelische Notlage. Zwischen dem Wunsch nach Auflösung, der Erfahrung existenzieller Starre und dem Aufbegehren gegen das eigene Ausgeliefertsein entsteht ein intensives Bild des Weltschmerzes – eine poetische Form von Einsamkeit und innerem Aufruhr.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.