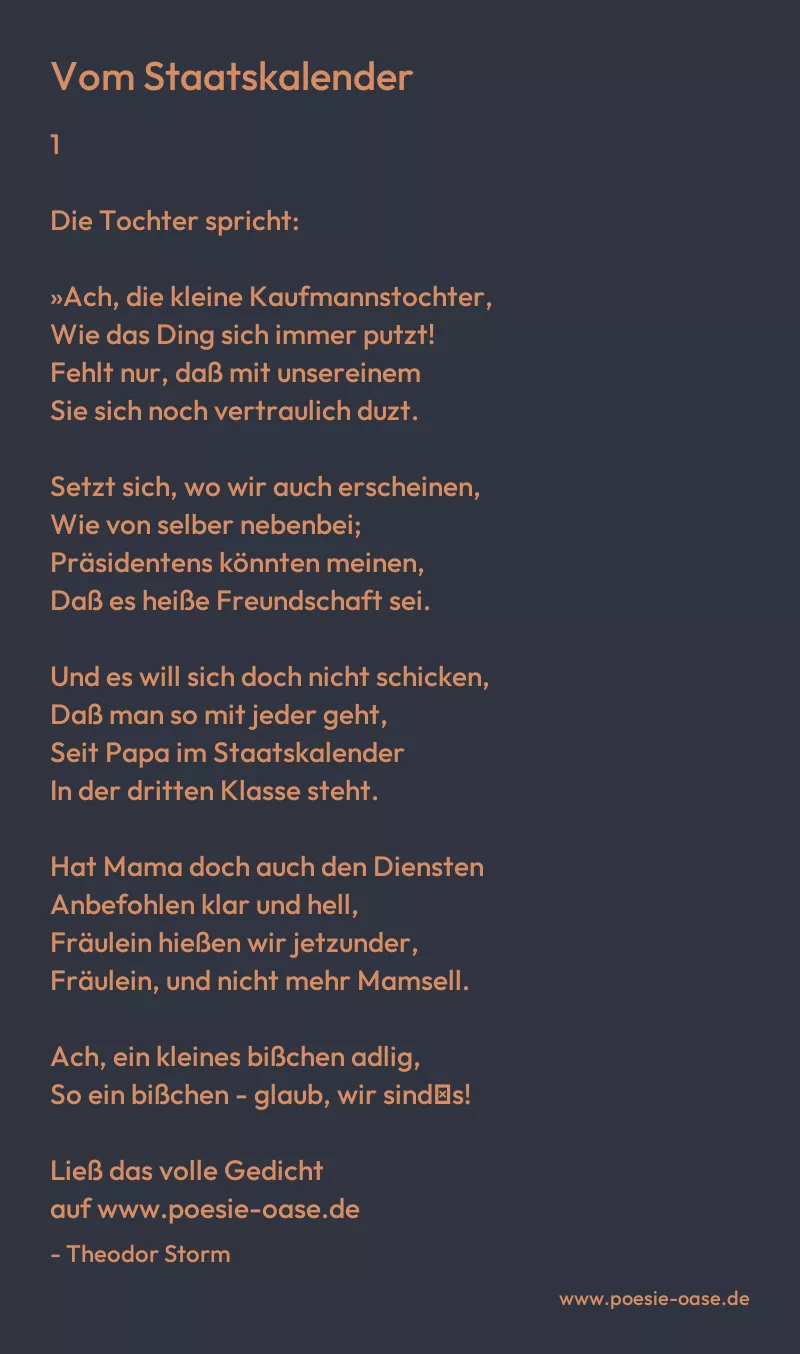1
Die Tochter spricht:
»Ach, die kleine Kaufmannstochter,
Wie das Ding sich immer putzt!
Fehlt nur, daß mit unsereinem
Sie sich noch vertraulich duzt.
Setzt sich, wo wir auch erscheinen,
Wie von selber nebenbei;
Präsidentens könnten meinen,
Daß es heiße Freundschaft sei.
Und es will sich doch nicht schicken,
Daß man so mit jeder geht,
Seit Papa im Staatskalender
In der dritten Klasse steht.
Hat Mama doch auch den Diensten
Anbefohlen klar und hell,
Fräulein hießen wir jetzunder,
Fräulein, und nicht mehr Mamsell.
Ach, ein kleines bißchen adlig,
So ein bißchen – glaub, wir sind′s!
Morgen in der goldnen Kutsche
Holt uns ein verwünschter Prinz!«
2
Ein Golem
Ihr sagt, es sei ein Kämmerer,
Ein schöner Staatskalenderer;
Doch sieht denn nicht ein jeder,
Daß er genäht aus Leder?
Kommt nur der rechte Regentropf
Und wäscht die Nummer ihm vom Kopf,
So ruft gewiß ein jeder:
Herrgott, ein Kerl von Leder!