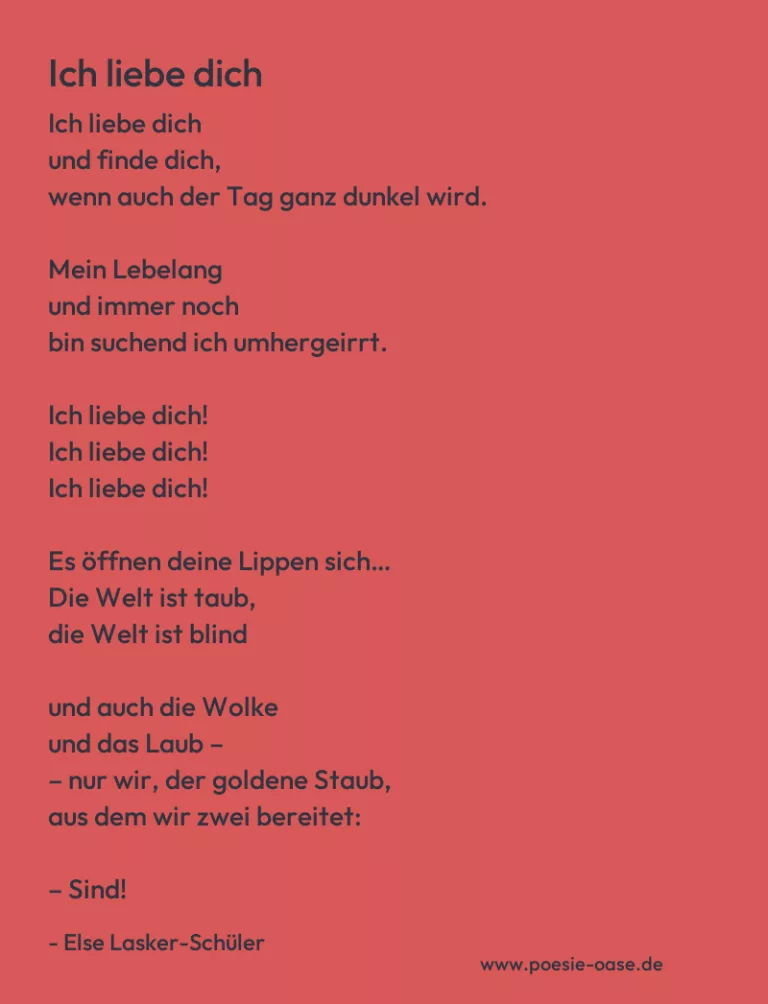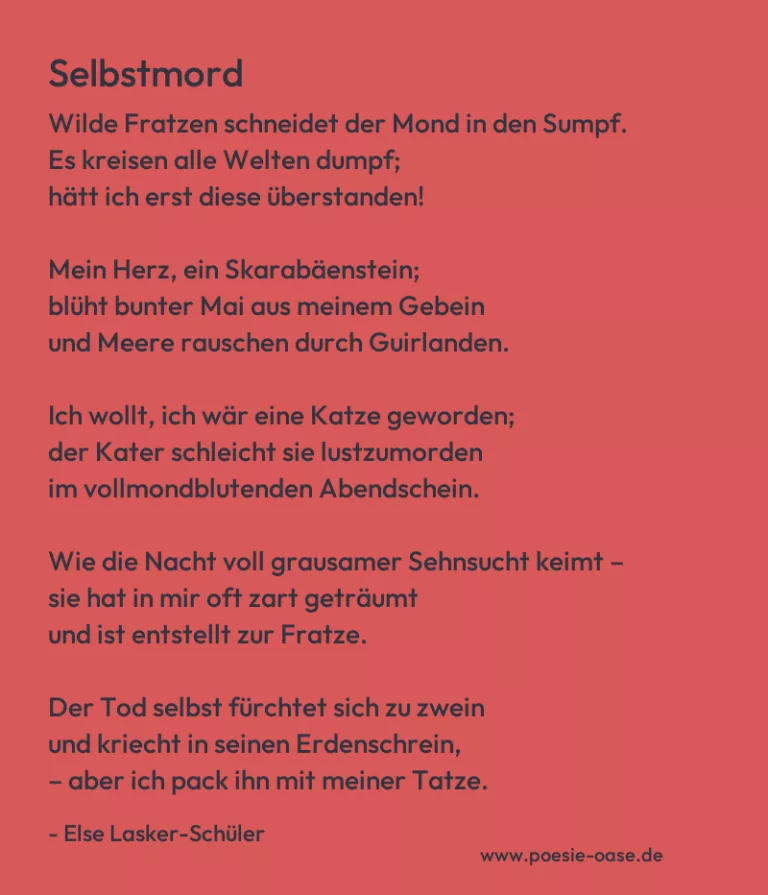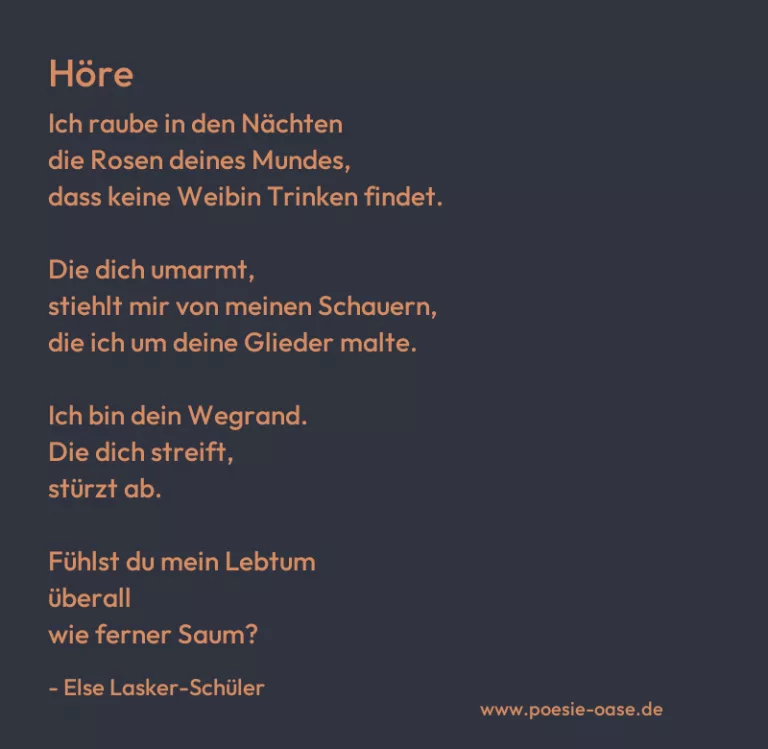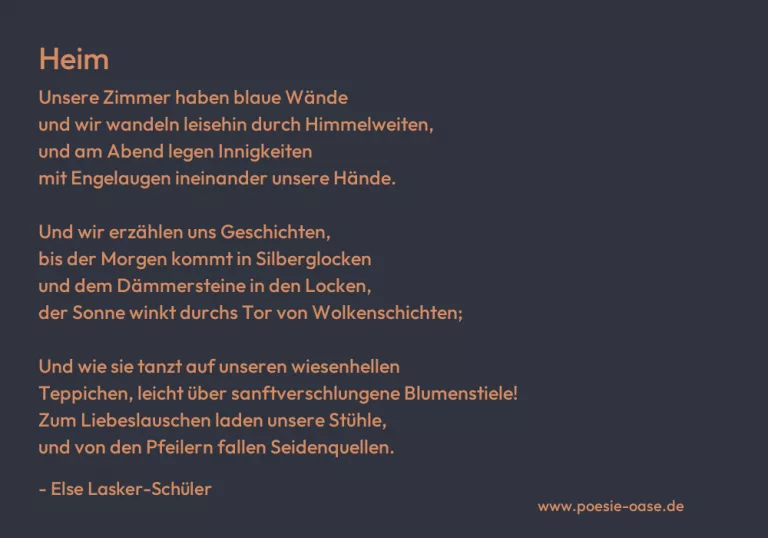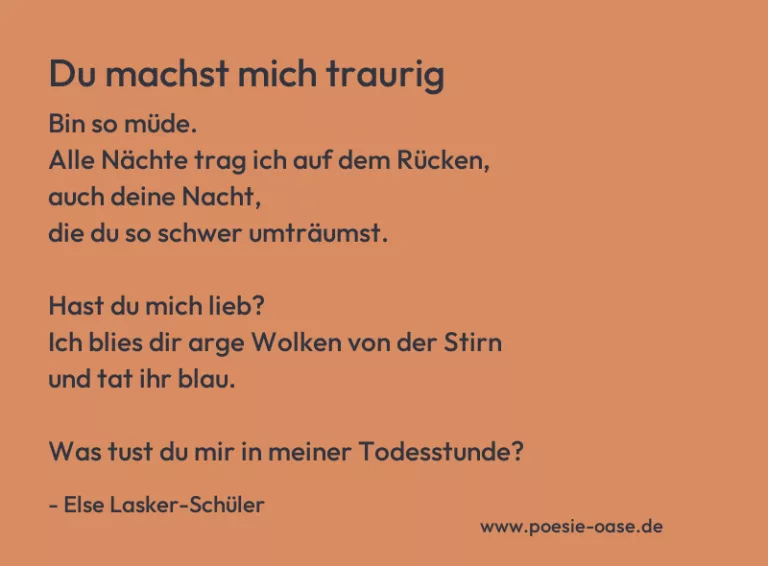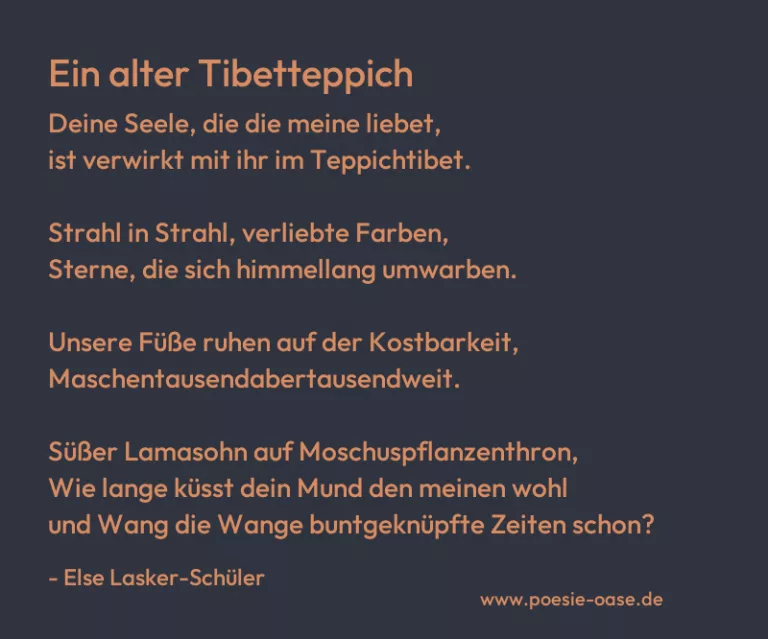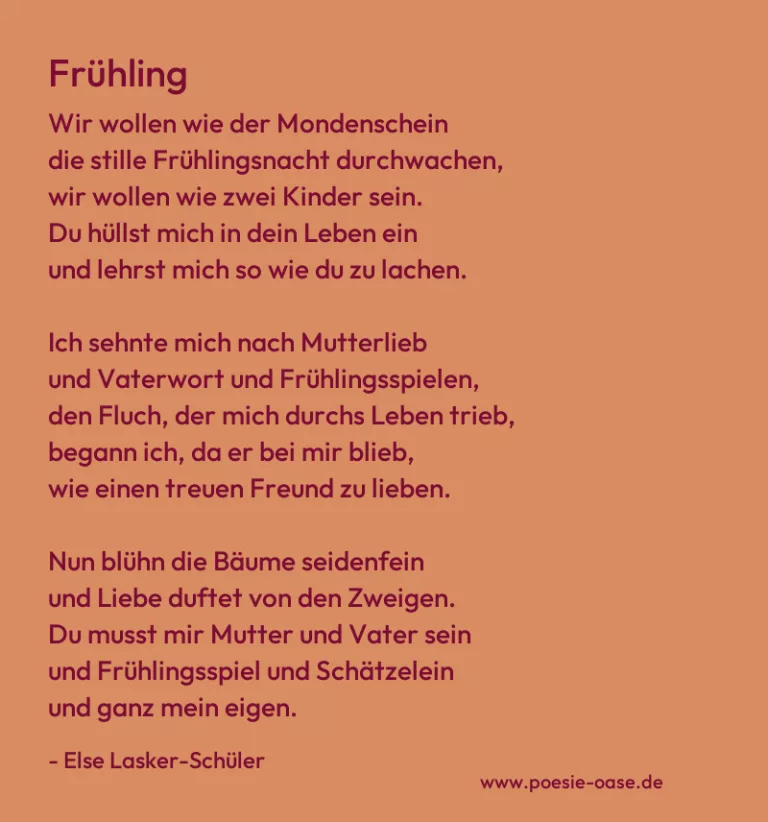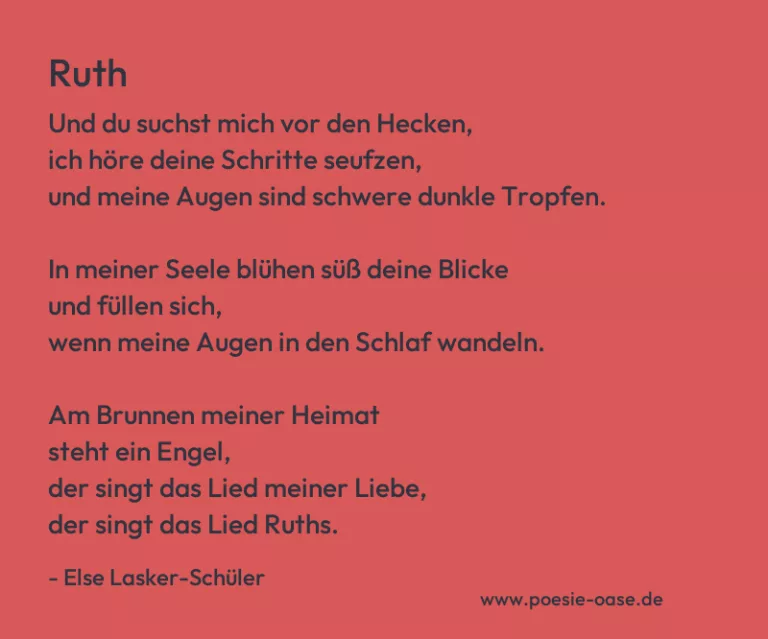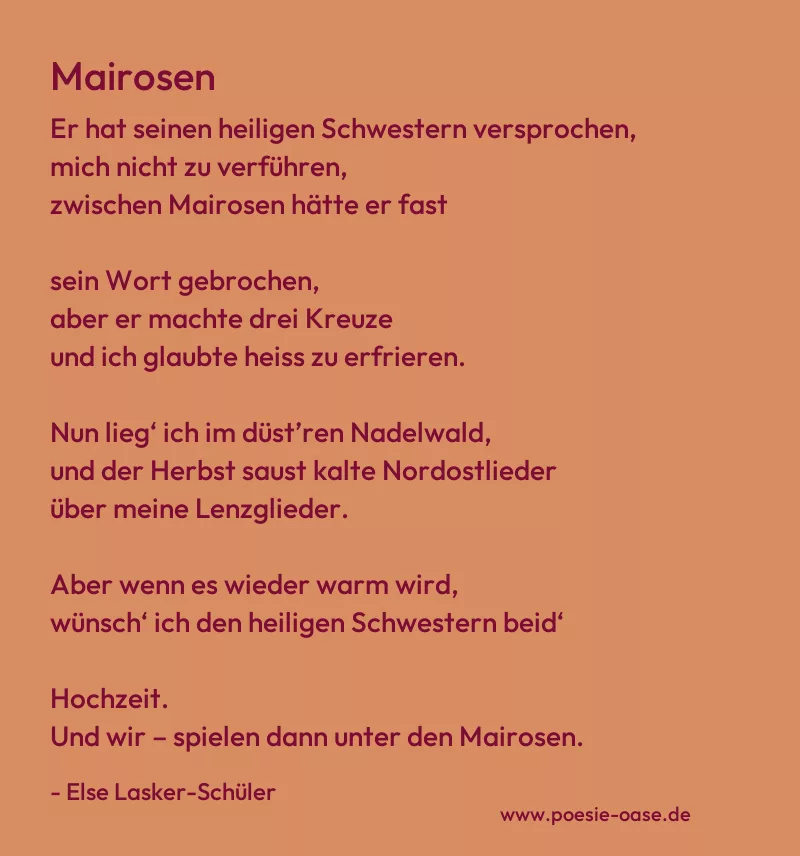Mairosen
Er hat seinen heiligen Schwestern versprochen,
mich nicht zu verführen,
zwischen Mairosen hätte er fast
sein Wort gebrochen,
aber er machte drei Kreuze
und ich glaubte heiss zu erfrieren.
Nun lieg‘ ich im düst’ren Nadelwald,
und der Herbst saust kalte Nordostlieder
über meine Lenzglieder.
Aber wenn es wieder warm wird,
wünsch‘ ich den heiligen Schwestern beid‘
Hochzeit.
Und wir – spielen dann unter den Mairosen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
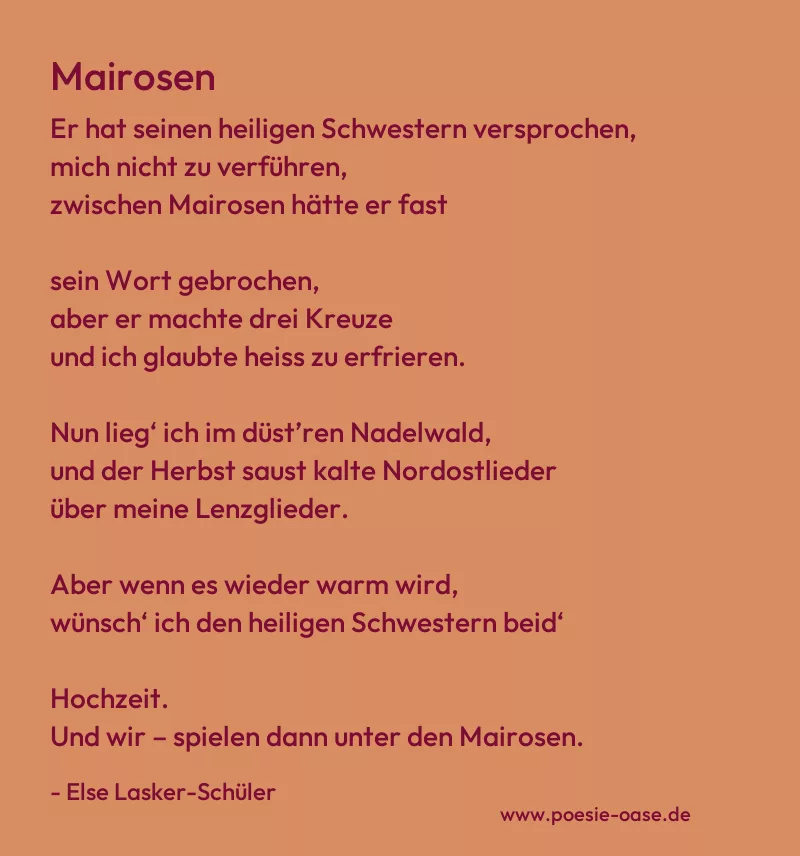
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Mairosen“ von Else Lasker-Schüler beschreibt eine leidenschaftliche und zugleich tragische Geschichte von Liebe, Verführung und Enttäuschung, die mit starken religiösen und naturverbundenen Symbolen durchzogen ist. In der ersten Strophe wird die Beziehung zwischen dem lyrischen Sprecher und einem anderen Mann eingeführt. Der Mann hat „seinen heiligen Schwestern versprochen, mich nicht zu verführen“, was auf ein Versprechen hinweist, sich einer Verführung oder einer Liebe zu entziehen. Das Bild der „heiligen Schwestern“ suggeriert eine moralische oder religiöse Verpflichtung, die gegen die leidenschaftlichen Wünsche des Mannes steht. Doch zwischen den „Mairosen“ droht er, sein Wort zu brechen, was auf eine verbotene Anziehung hinweist, die dennoch nicht ganz unterdrückt werden kann.
In der zweiten Strophe wird das Drama weiter entfaltet: Der Mann macht „drei Kreuze“ als symbolische Geste, um sich von seiner Verführungslust zu befreien, aber das Bild der Kreuze verweist auch auf religiöse Reinheit und den Konflikt zwischen menschlichen Gelüsten und moralischer Zurückhaltung. Der Sprecher glaubt, „heiss zu erfrieren“, was die Kälte und den emotionalen Schmerz ausdrückt, der aus der unerwiderten Liebe oder der verwehrten Zuneigung resultiert. Die Wärme, die in der ersten Strophe durch die „Mairosen“ erweckt wird, wird hier von der Kälte des Herbstes verdrängt, was die emotionale Distanz und Enttäuschung widerspiegelt.
Die dritte Strophe bringt das Bild des „düsteren Nadelwaldes“, der in seiner dunklen, kalten Atmosphäre die innere Welt des Sprechers widerspiegelt. Der Herbst, der „kalte Nordostlieder“ über die „Lenzglieder“ sausen lässt, verdeutlicht das Ende der Liebe und der lebendigen Energie des Frühlings. Die „Lenzglieder“ als Symbol für die Jugend und den Frühling werden vom kalten Wind des Herbstes entweicht, was eine metaphorische Darstellung des Verfalls und der Entfremdung ist.
Doch in der letzten Strophe flackert eine Hoffnung auf. Wenn es wieder „warm wird“, wünscht sich der Sprecher, dass die „heiligen Schwestern“ „Hochzeit“ feiern und dass der Sprecher und der Geliebte schließlich „unter den Mairosen spielen“ – ein Bild der Versöhnung und des Neuanfangs. Das Spiel unter den Mairosen steht für eine unschuldige, leidenschaftliche Liebe, die von den moralischen Verpflichtungen befreit ist. Diese Hoffnung auf eine neue Möglichkeit der Liebe und Verbindung, frei von den religiösen und moralischen Bindungen, stellt den Abschluss des Gedichts dar und spiegelt den ewigen Wunsch nach einer erfüllten, ungebremsten Liebe wider.
„Mairosen“ ist ein Gedicht, das die Spannungen zwischen moralischen Normen, religiösen Versprechungen und menschlichen Leidenschaften thematisiert. Es entfaltet eine tragische Geschichte von Verlangen und Zurückhaltung, von Erfüllung und Enttäuschung. Die Naturbilder, wie die Mairosen und der Nadelwald, verstärken die emotionalen Zustände des lyrischen Ichs und lassen die ewige Sehnsucht nach Liebe und Zugehörigkeit spürbar werden.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.