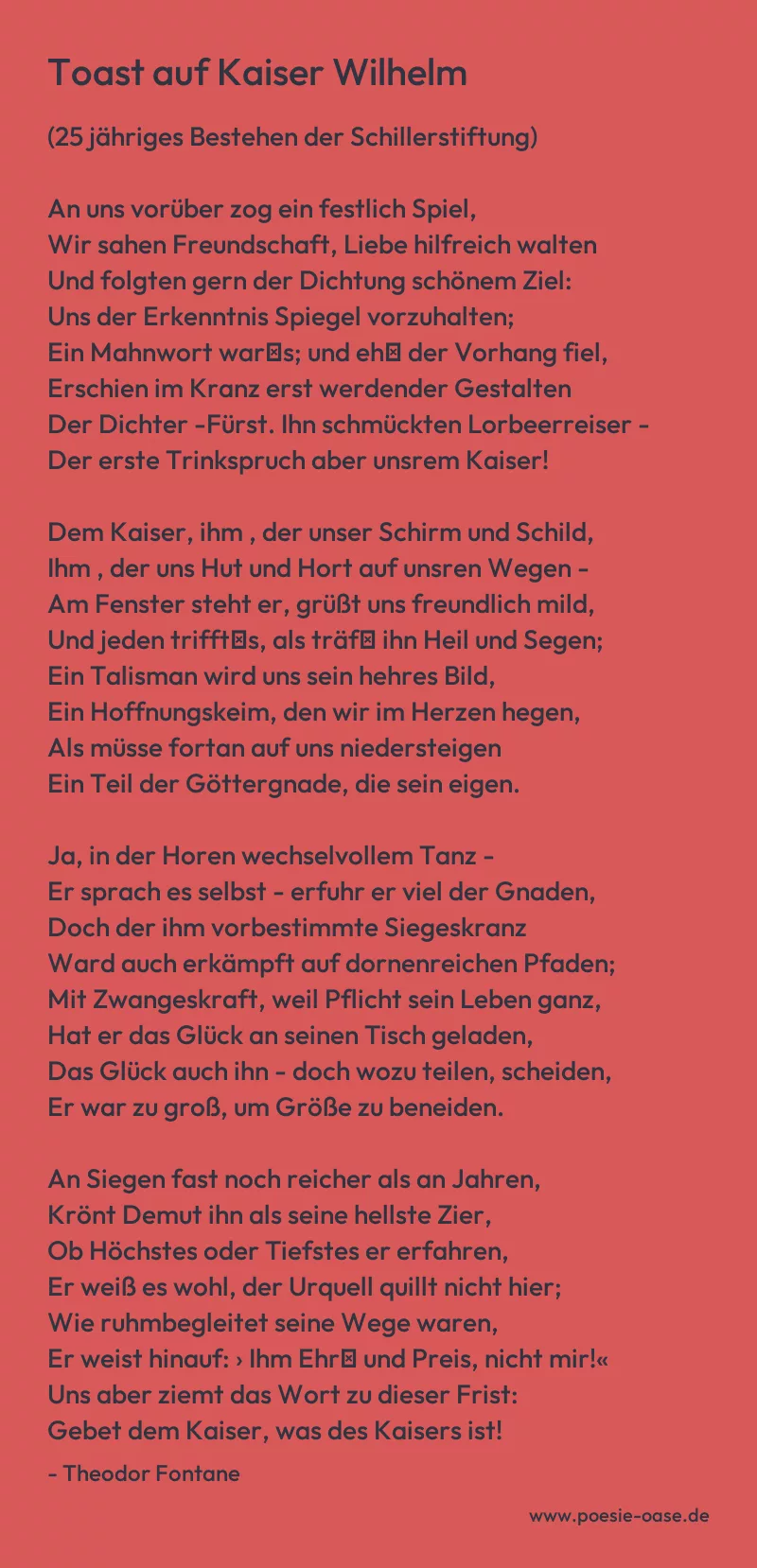(25 jähriges Bestehen der Schillerstiftung)
An uns vorüber zog ein festlich Spiel,
Wir sahen Freundschaft, Liebe hilfreich walten
Und folgten gern der Dichtung schönem Ziel:
Uns der Erkenntnis Spiegel vorzuhalten;
Ein Mahnwort war′s; und eh′ der Vorhang fiel,
Erschien im Kranz erst werdender Gestalten
Der Dichter -Fürst. Ihn schmückten Lorbeerreiser –
Der erste Trinkspruch aber unsrem Kaiser!
Dem Kaiser, ihm , der unser Schirm und Schild,
Ihm , der uns Hut und Hort auf unsren Wegen –
Am Fenster steht er, grüßt uns freundlich mild,
Und jeden trifft′s, als träf′ ihn Heil und Segen;
Ein Talisman wird uns sein hehres Bild,
Ein Hoffnungskeim, den wir im Herzen hegen,
Als müsse fortan auf uns niedersteigen
Ein Teil der Göttergnade, die sein eigen.
Ja, in der Horen wechselvollem Tanz –
Er sprach es selbst – erfuhr er viel der Gnaden,
Doch der ihm vorbestimmte Siegeskranz
Ward auch erkämpft auf dornenreichen Pfaden;
Mit Zwangeskraft, weil Pflicht sein Leben ganz,
Hat er das Glück an seinen Tisch geladen,
Das Glück auch ihn – doch wozu teilen, scheiden,
Er war zu groß, um Größe zu beneiden.
An Siegen fast noch reicher als an Jahren,
Krönt Demut ihn als seine hellste Zier,
Ob Höchstes oder Tiefstes er erfahren,
Er weiß es wohl, der Urquell quillt nicht hier;
Wie ruhmbegleitet seine Wege waren,
Er weist hinauf: › Ihm Ehr′ und Preis, nicht mir!«
Uns aber ziemt das Wort zu dieser Frist:
Gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist!