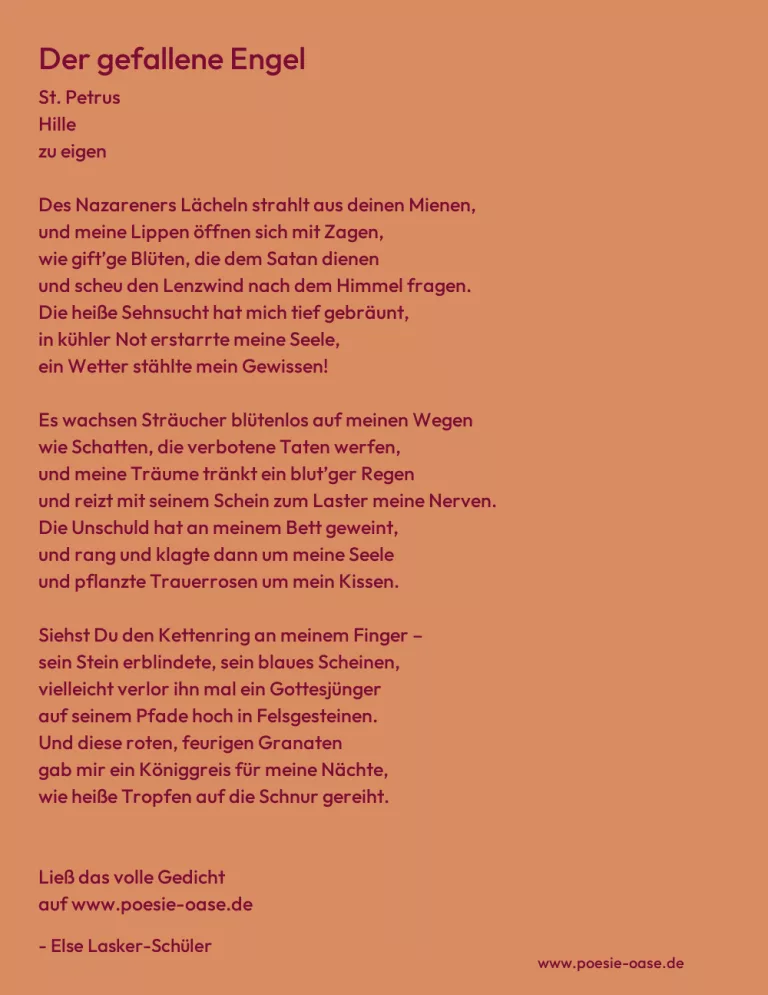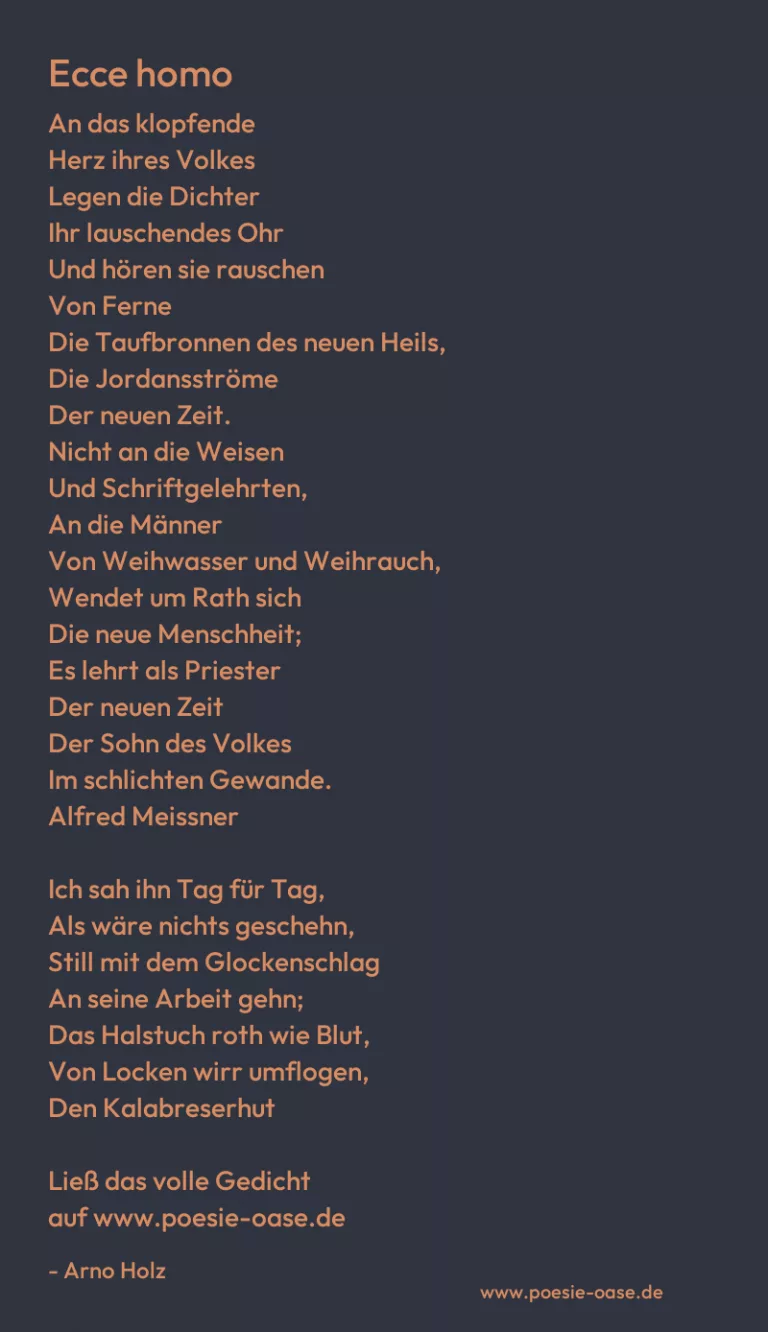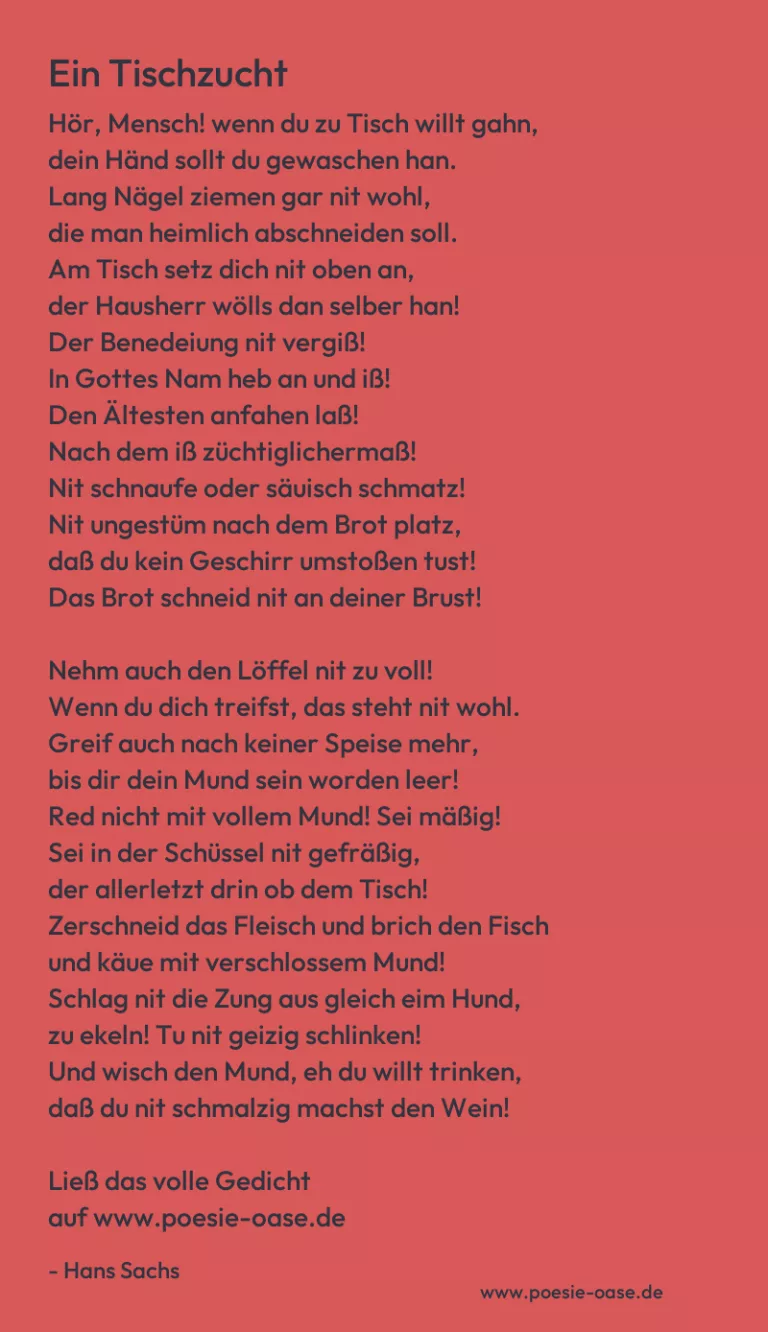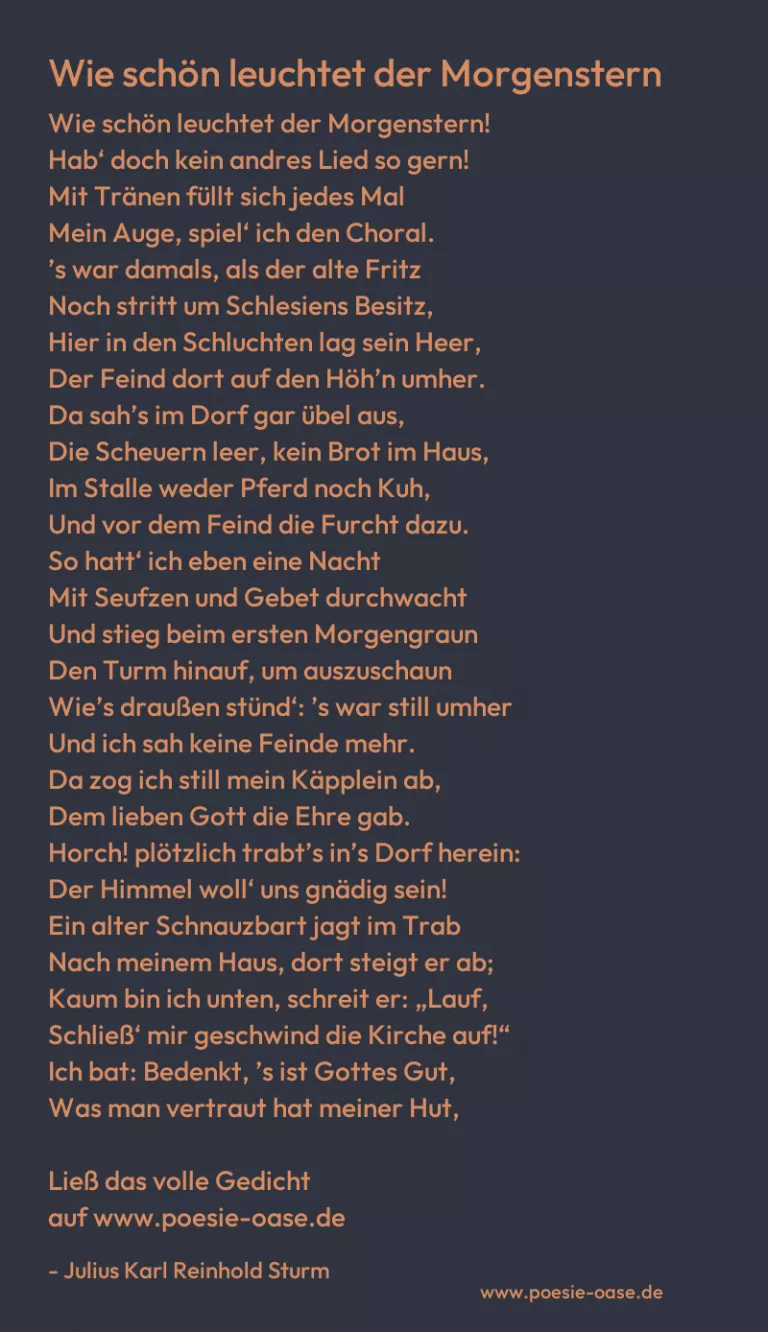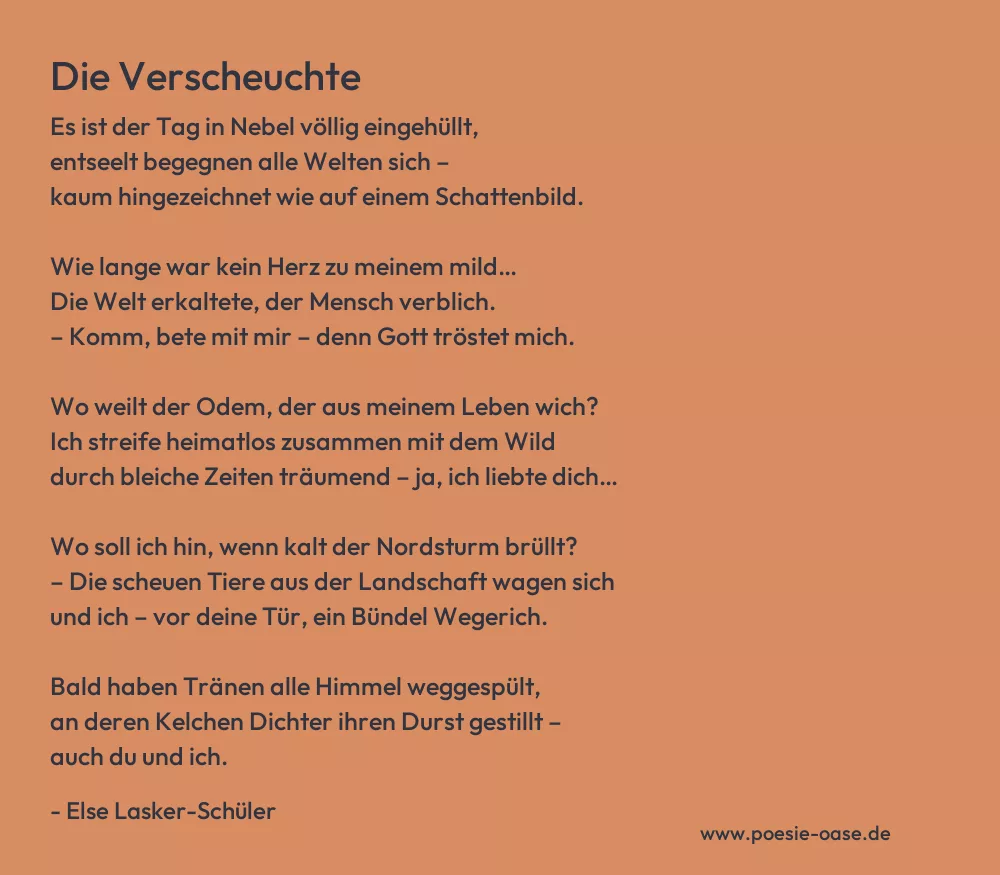Die Verscheuchte
Es ist der Tag in Nebel völlig eingehüllt,
entseelt begegnen alle Welten sich –
kaum hingezeichnet wie auf einem Schattenbild.
Wie lange war kein Herz zu meinem mild…
Die Welt erkaltete, der Mensch verblich.
– Komm, bete mit mir – denn Gott tröstet mich.
Wo weilt der Odem, der aus meinem Leben wich?
Ich streife heimatlos zusammen mit dem Wild
durch bleiche Zeiten träumend – ja, ich liebte dich…
Wo soll ich hin, wenn kalt der Nordsturm brüllt?
– Die scheuen Tiere aus der Landschaft wagen sich
und ich – vor deine Tür, ein Bündel Wegerich.
Bald haben Tränen alle Himmel weggespült,
an deren Kelchen Dichter ihren Durst gestillt –
auch du und ich.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
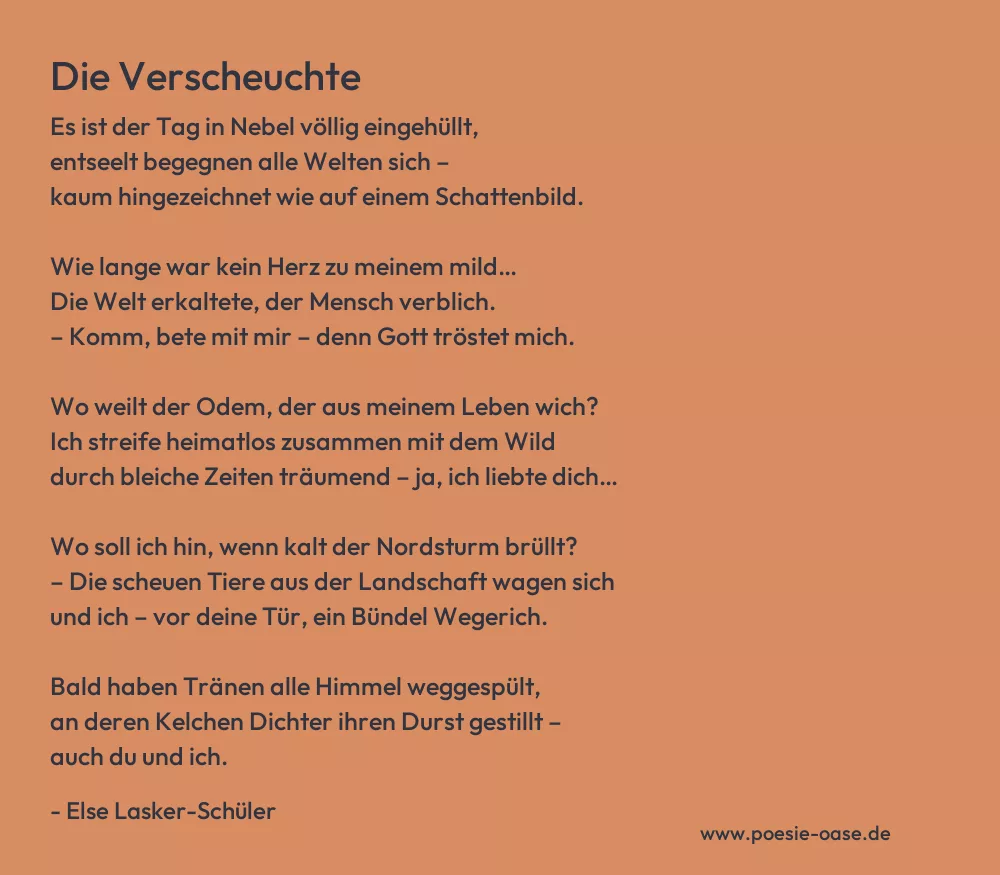
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Verscheuchte“ von Else Lasker-Schüler vermittelt ein tiefes Gefühl von Verlassenheit und Entfremdung. Zu Beginn wird der Tag als „in Nebel völlig eingehüllt“ beschrieben, was eine undurchdringliche Dunkelheit und Verwirrung symbolisiert. Die Welt erscheint „entseelt“, als ob sie jegliche Lebenskraft verloren hätte. Die „hingezeichneten“ Bilder deuten auf eine Realität hin, die sich nur vage und flüchtig darstellt, fast wie eine Erinnerung oder ein Schatten.
Die Sprecherin klagt, dass „kein Herz zu meinem mild“ gewesen sei, was das Fehlen von Nähe und Verständnis ausdrückt. Die Kälte, die die Welt umgibt, wird als „erkaltete“ Welt beschrieben, und der Mensch „verblich“ – ein starkes Bild für die Entfremdung von den eigenen Gefühlen und der Welt. In dieser Einsamkeit sucht die Sprecherin Trost bei Gott, indem sie sagt: „Komm, bete mit mir – denn Gott tröstet mich.“ Hier zeigt sich die verzweifelte Suche nach einem höheren Halt und einer Quelle der Geborgenheit inmitten der emotionalen Kälte.
Die Frage „Wo weilt der Odem, der aus meinem Leben wich?“ zeigt die tiefe Leere, die die Sprecherin empfindet, und ihre Suche nach dem verlorenen Lebensgeist. Sie fühlt sich „heimatlos“ und streift „mit dem Wild“ durch die „bleichen Zeiten“, was auf ein Leben in Unsicherheit und Trauer hinweist. Die Erinnerung an ihre Liebe wird in der Zeile „ja, ich liebte dich“ wieder wach, doch auch diese Liebe scheint von der Welt und der Zeit abgelöst zu sein.
Am Ende des Gedichts zeigt sich eine weitere Dimension der Entfremdung und Verzweiflung: Der „Nordsturm“ brüllt, was auf die harschen, unaufhörlichen Widrigkeiten des Lebens hinweist, während die „scheuen Tiere“ sich aus der Landschaft wagen – möglicherweise ein Bild für die zögerliche, ängstliche Bewegung der Sprecherin in einer Welt, die sie nicht mehr versteht. Sie beschreibt sich selbst als „ein Bündel Wegerich“ vor der Tür des Geliebten, was das Bild einer bescheidenen, hilflosen Enttäuschung verstärkt. Der abschließende Vers, dass „Tränen alle Himmel weggespült“ haben, deutet auf das Verschwinden von Schönheit und Inspiration hin – selbst die Dichter, die einst „Durst gestillt“ haben, sind nun von der Welt der Tränen und des Verlusts abgelöst.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.