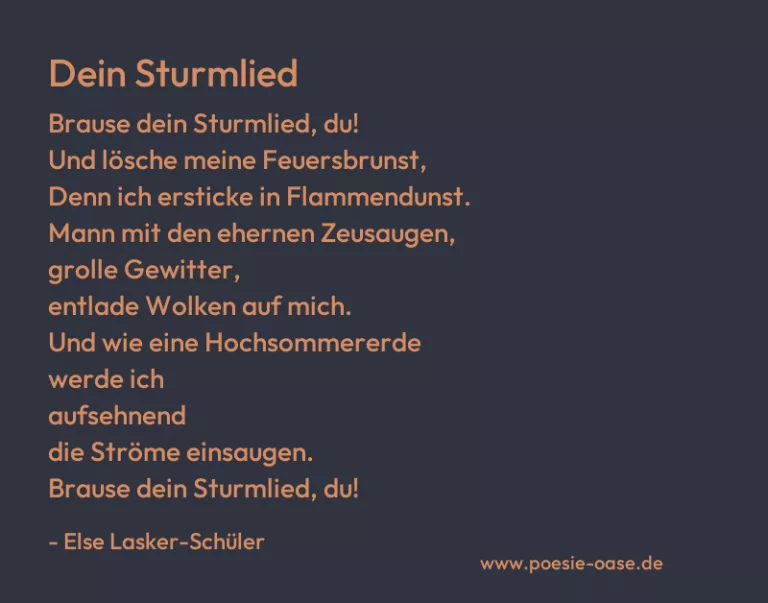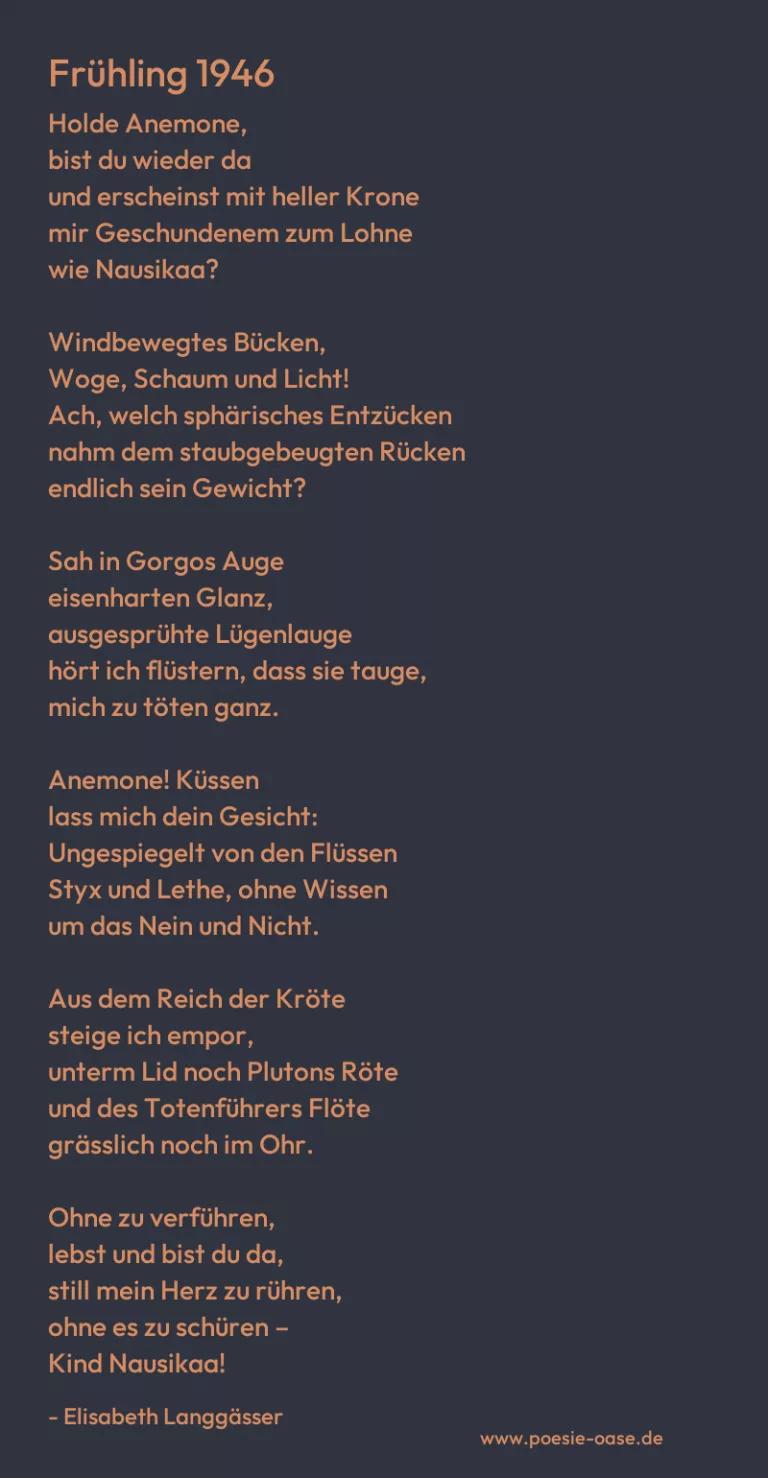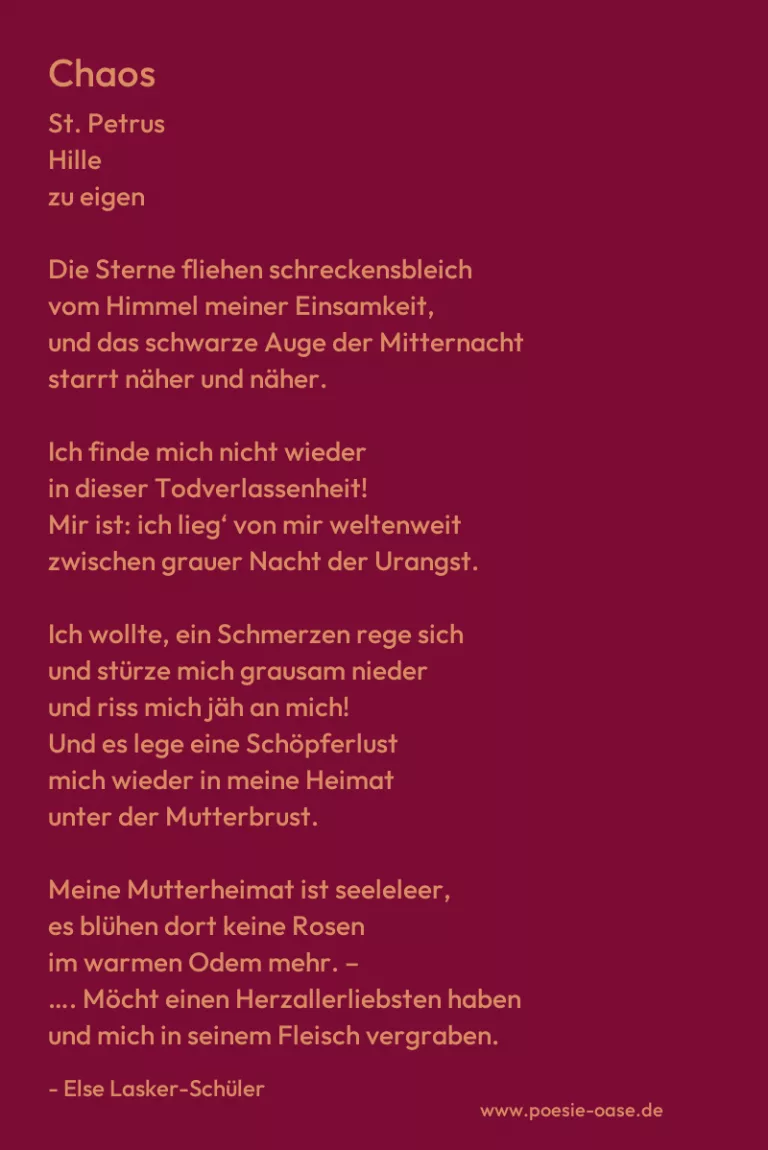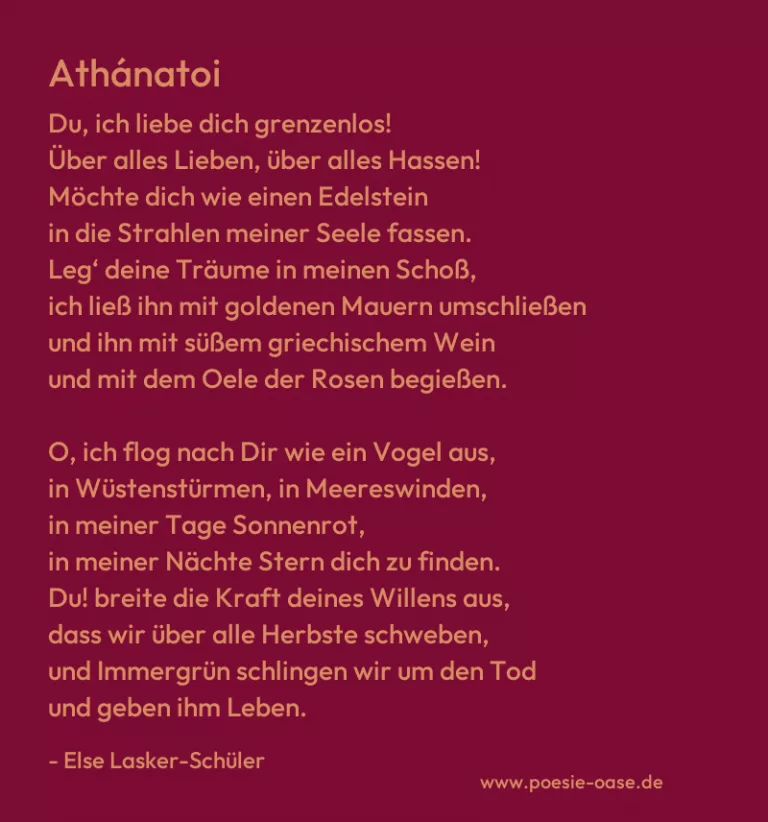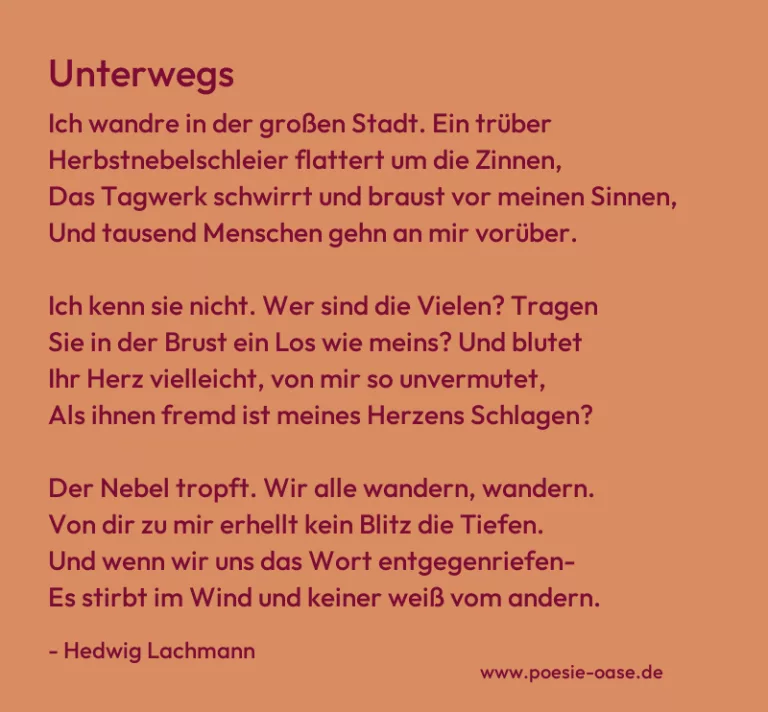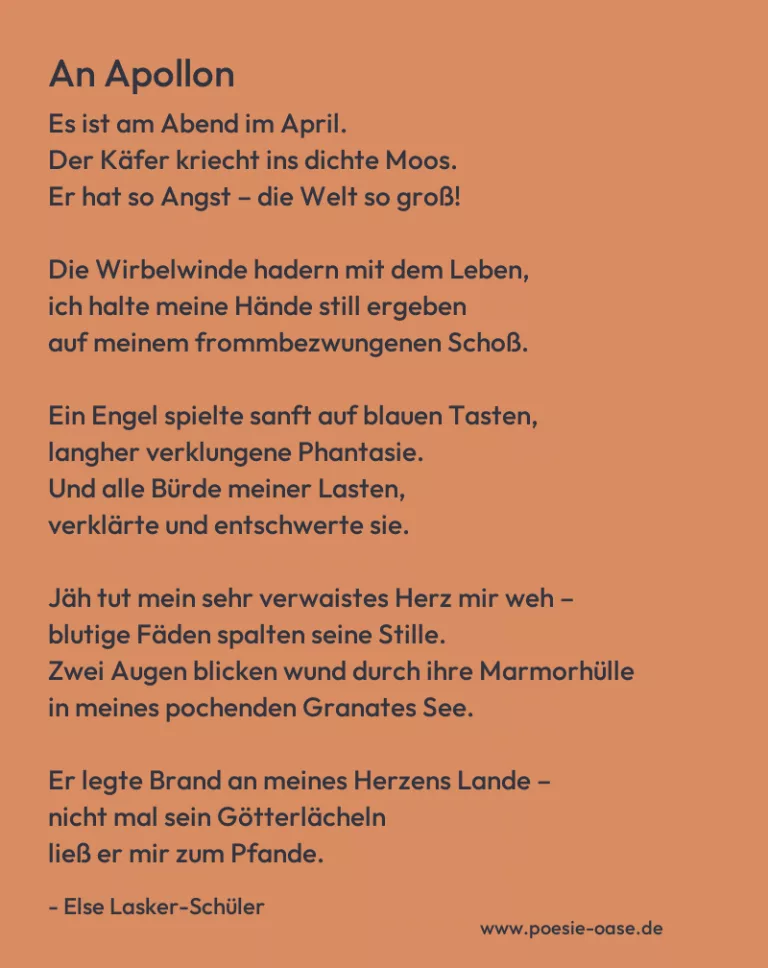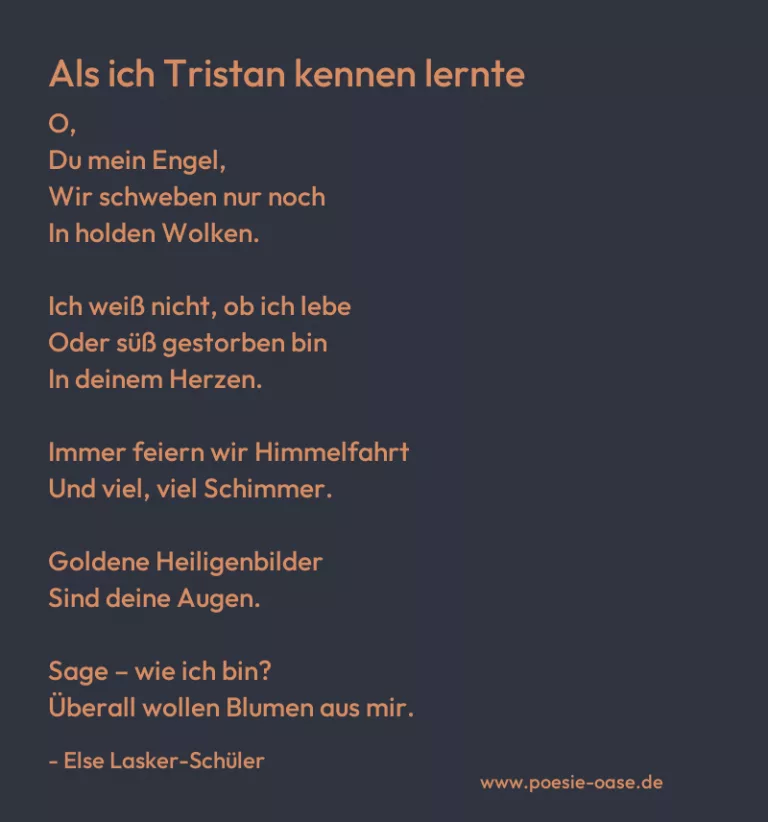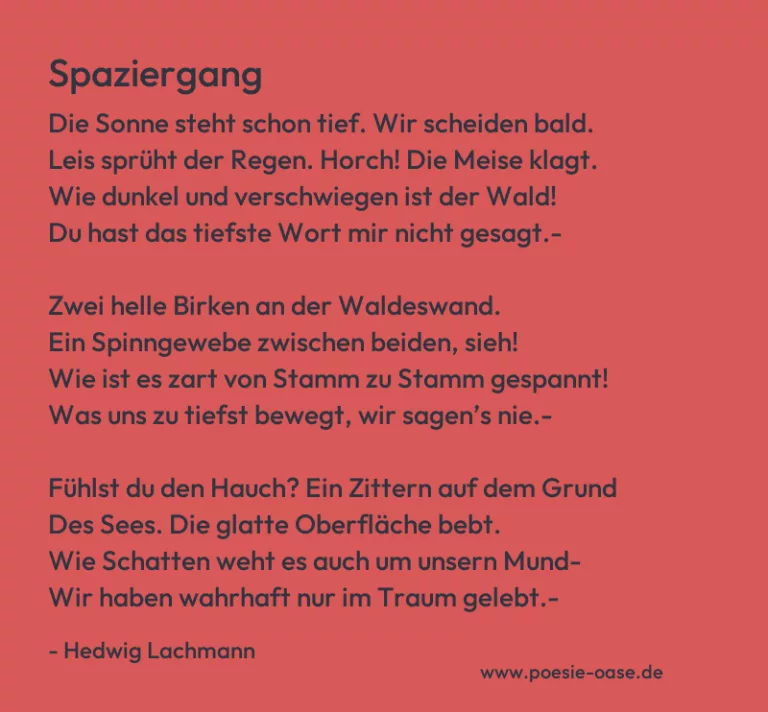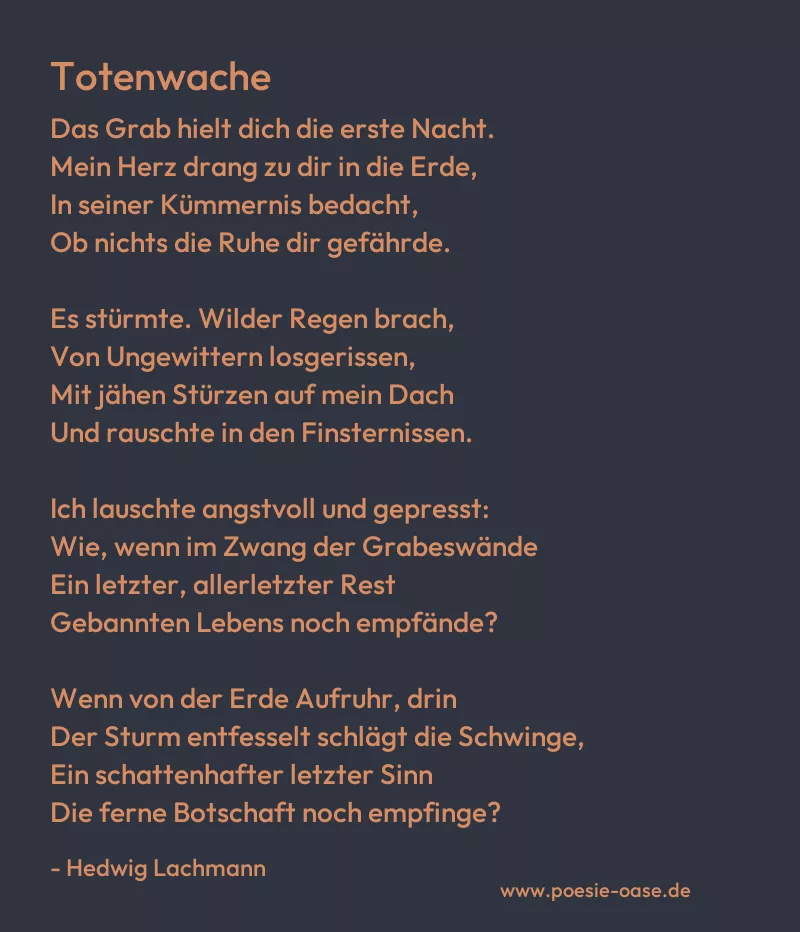Totenwache
Das Grab hielt dich die erste Nacht.
Mein Herz drang zu dir in die Erde,
In seiner Kümmernis bedacht,
Ob nichts die Ruhe dir gefährde.
Es stürmte. Wilder Regen brach,
Von Ungewittern losgerissen,
Mit jähen Stürzen auf mein Dach
Und rauschte in den Finsternissen.
Ich lauschte angstvoll und gepresst:
Wie, wenn im Zwang der Grabeswände
Ein letzter, allerletzter Rest
Gebannten Lebens noch empfände?
Wenn von der Erde Aufruhr, drin
Der Sturm entfesselt schlägt die Schwinge,
Ein schattenhafter letzter Sinn
Die ferne Botschaft noch empfinge?
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
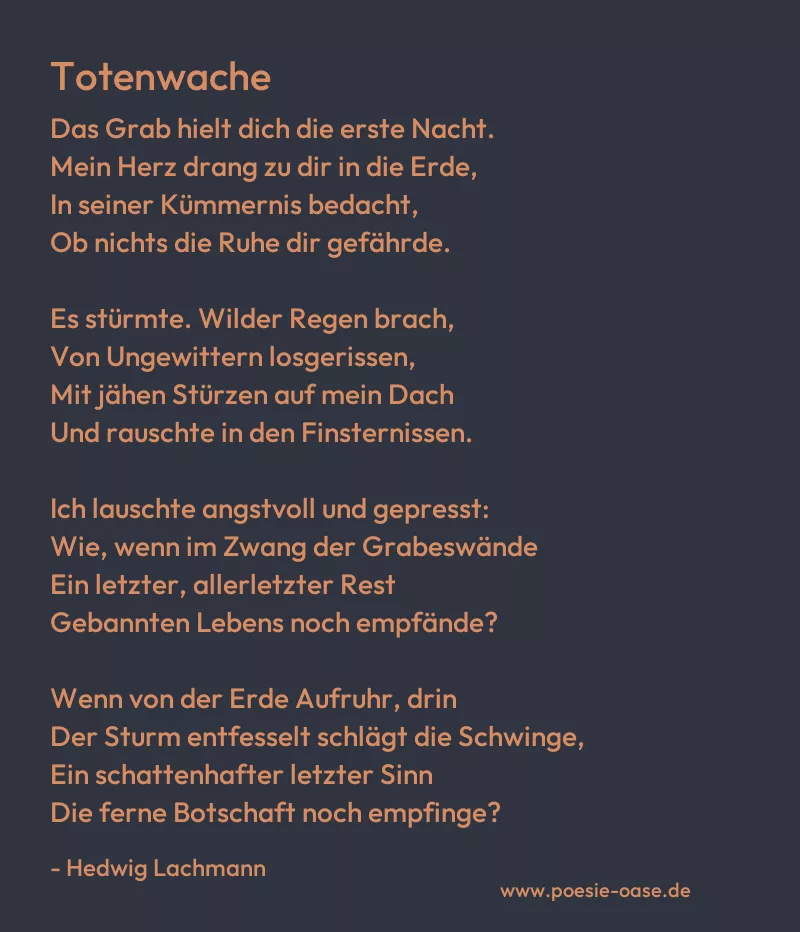
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Totenwache“ von Hedwig Lachmann thematisiert die tief empfundene Trauer und die Ängste der Sprecherin in der Nacht nach dem Tod eines geliebten Menschen. Die erste Strophe beschreibt das Bild eines Grabes, das den Körper des Verstorbenen in der „ersten Nacht“ hält. Die Sprecherin fühlt eine tiefe Kümmernis und ihre Gedanken dringen „zu dir in die Erde“, was auf die unaufhörliche Nähe und Verbundenheit hinweist, die sie trotz des physischen Todes noch empfindet. Ihre Sorge, dass „nichts die Ruhe dir gefährde“, zeigt ihre Angst, dass etwas das friedliche Dasein des Verstorbenen stören könnte, was die Zerbrechlichkeit und den Respekt vor dem Tod betont.
In der zweiten Strophe wird diese Besorgnis durch das wilde Wetter verstärkt. Der „wilde Regen“ und das „Ungewitter“ symbolisieren nicht nur die äußeren Umstände der Nacht, sondern auch die innere Unruhe und den Sturm der Gefühle der Sprecherin. Der „jäh“ heranbrachende Regen und das Rauschen in den „Finsternissen“ verstärken die düstere Atmosphäre und vermitteln das Gefühl eines Unheils, das sich über die Nacht legt. Das Bild des Sturms auf dem Dach unterstreicht das Gefühl von Bedrohung und die Wahrnehmung der Sprecherin, dass selbst die Natur in dieser Nacht von Chaos und Zerstörung geprägt ist.
In der dritten Strophe wird die tiefe Angst der Sprecherin greifbar, als sie sich fragt, ob „ein letzter, allerletzter Rest“ von „gebändigtem Leben“ im Körper des Verstorbenen noch existieren könnte. Diese Vorstellung des „lebensverbliebenen Rests“ lässt auf die Angst der Sprecherin schließen, dass der Tod nicht endgültig ist und dass in den „Grabeswänden“ noch ein „letzter Sinn“ oder eine „ferne Botschaft“ existieren könnte. Die Vorstellung, dass das Leben des Verstorbenen noch in irgendeiner Form weiterbestehen könnte, verstärkt die Angst vor der endgültigen Trennung und der Ungewissheit des Todes.
Das Gedicht ist durchzogen von einer dichten Atmosphäre der Trauer und der existenziellen Unruhe. Es behandelt nicht nur den Tod als körperliches Ende, sondern auch die geistige und seelische Auseinandersetzung mit der Frage, ob der Tod wirklich das endgültige Ende des Lebens ist oder ob noch etwas von dem Verstorbenen in der Erde verweilen könnte. Lachmann vermittelt auf eindrucksvolle Weise die tiefe Ungewissheit und die lähmende Angst vor der endgültigen Trennung durch den Tod.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.