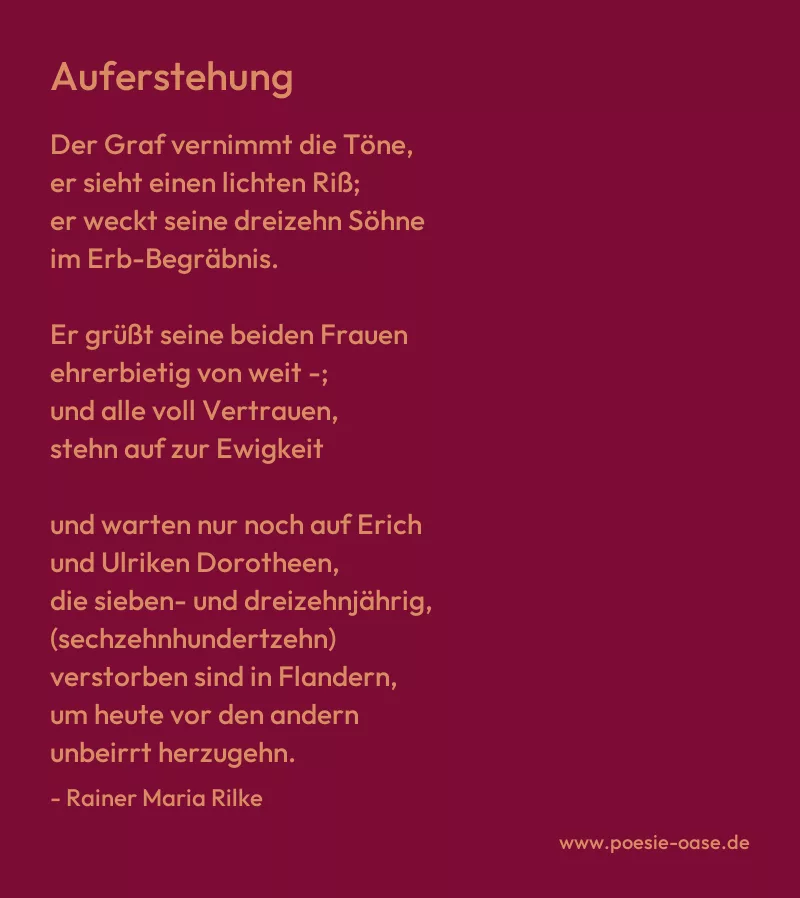Auferstehung
Der Graf vernimmt die Töne,
er sieht einen lichten Riß;
er weckt seine dreizehn Söhne
im Erb-Begräbnis.
Er grüßt seine beiden Frauen
ehrerbietig von weit -;
und alle voll Vertrauen,
stehn auf zur Ewigkeit
und warten nur noch auf Erich
und Ulriken Dorotheen,
die sieben- und dreizehnjährig,
(sechzehnhundertzehn)
verstorben sind in Flandern,
um heute vor den andern
unbeirrt herzugehn.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
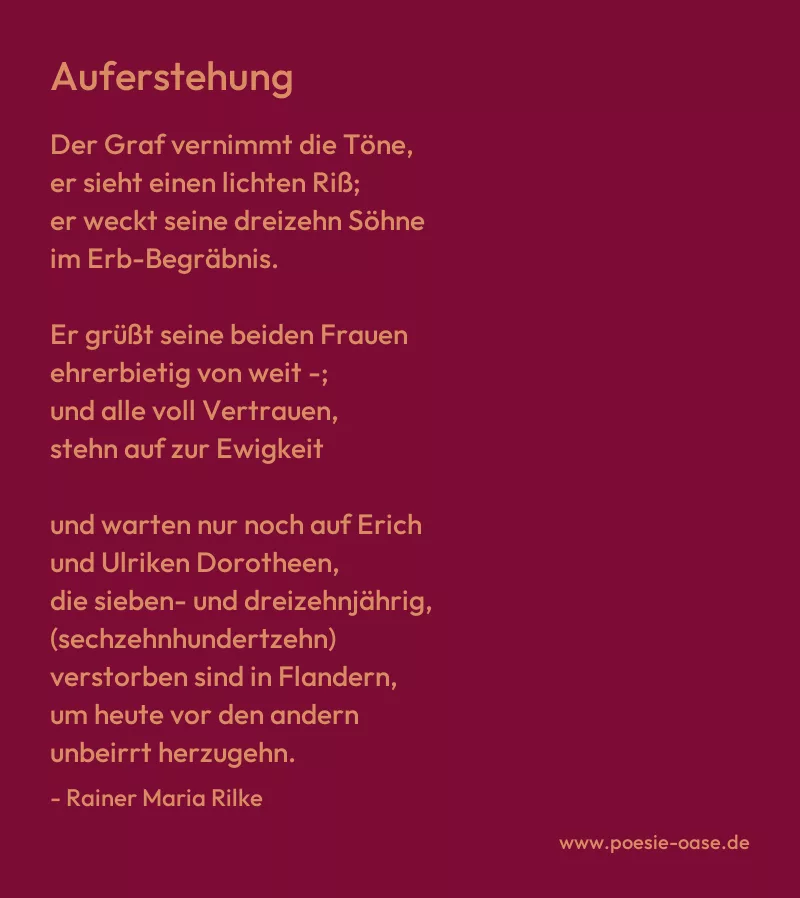
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Auferstehung“ von Rainer Maria Rilke beschreibt eine Szene der Wiedergeburt und des Übergangs in die Ewigkeit, eingebettet in eine spezifische historische und familiäre Konstellation. Das zentrale Bild ist die Auferstehung einer Adelsfamilie, die aus dem Grab erwacht, um in ein neues Dasein einzutreten. Die ersten beiden Strophen etablieren die Szene: Der Graf, das Familienoberhaupt, vernimmt die „Töne“ der Auferstehung und sieht einen „lichten Riß“, ein Zeichen des Übergangs. Er weckt seine dreizehn Söhne, und die gesamte Familie, einschließlich der beiden Frauen, bereitet sich auf den Eintritt in die Ewigkeit vor.
Die dritte Strophe führt die beiden fehlenden Familienmitglieder ein: Erich und Ulrike Dorothea, die in jungem Alter verstorben sind. Die Jahreszahl „sechzehnhundertzehn“ verankert das Geschehen in einer konkreten historischen Zeit, was die Auferstehung aus dem Grab von einem abstrakten Konzept in eine greifbare, spezifische Erfahrung verwandelt. Die Erwähnung des Todesortes „Flandern“ deutet auf kriegerische Auseinandersetzungen hin und verstärkt den Eindruck der historischen Verankerung. Der Hinweis auf die jungen Verstorbenen deutet auf eine tiefe Tragik und Verlust innerhalb der Familie.
Die letzten beiden Zeilen, „um heute vor den andern / unbeirrt herzugehn“, unterstreichen die Bedeutung der beiden jungen Verstorbenen. Sie sind nicht nur Teil der Familie, sondern werden eine besondere Rolle in der Auferstehung einnehmen, indem sie „unbeirrt“ vorangehen. Dies deutet auf eine Art von Führung oder Vorbildfunktion hin. Die Verwendung des Wortes „herzugehn“ verstärkt den Eindruck eines Prozesses oder einer Prozession, bei dem die Familie gemeinsam in die Ewigkeit schreitet.
Rilkes Gedicht zeichnet sich durch seine schlichte Sprache und die konkreten Bilder aus. Die Verwendung von Namen, Jahreszahlen und geografischen Angaben erzeugt eine dichte Atmosphäre, die das abstrakte Thema der Auferstehung mit dem Leben und der Geschichte verbindet. Die Bedeutung des Gedichts liegt in der Darstellung des Übergangs, der Hoffnung und des gemeinsamen Schicksals der Familie, sowie in der Betonung der Rolle der jüngsten Mitglieder, die in diesem Kontext eine besondere Würde erhalten.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.