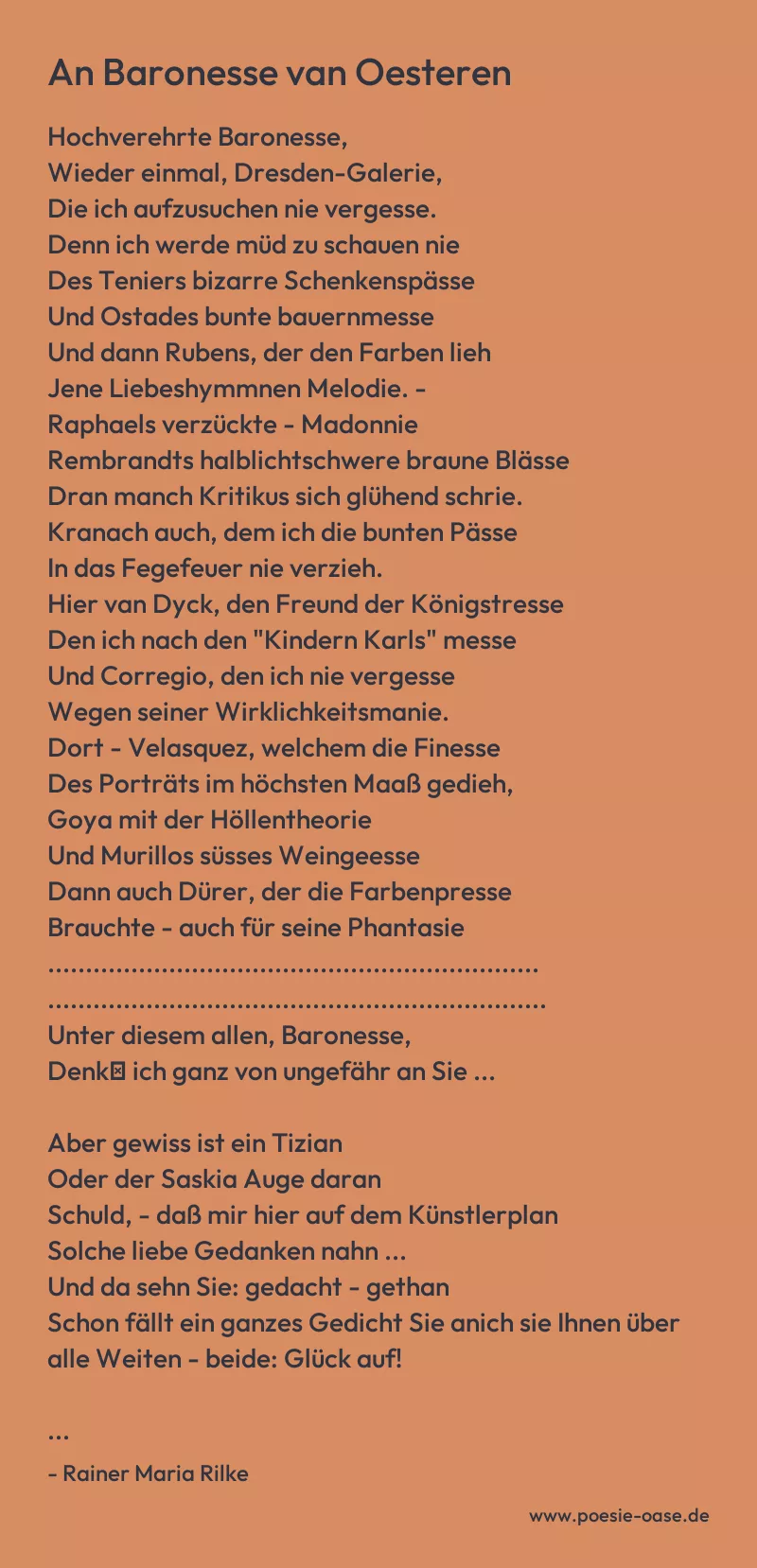An Baronesse van Oesteren
Hochverehrte Baronesse,
Wieder einmal, Dresden-Galerie,
Die ich aufzusuchen nie vergesse.
Denn ich werde müd zu schauen nie
Des Teniers bizarre Schenkenspässe
Und Ostades bunte bauernmesse
Und dann Rubens, der den Farben lieh
Jene Liebeshymmnen Melodie. –
Raphaels verzückte – Madonnie
Rembrandts halblichtschwere braune Blässe
Dran manch Kritikus sich glühend schrie.
Kranach auch, dem ich die bunten Pässe
In das Fegefeuer nie verzieh.
Hier van Dyck, den Freund der Königstresse
Den ich nach den „Kindern Karls“ messe
Und Corregio, den ich nie vergesse
Wegen seiner Wirklichkeitsmanie.
Dort – Velasquez, welchem die Finesse
Des Porträts im höchsten Maaß gedieh,
Goya mit der Höllentheorie
Und Murillos süsses Weingeesse
Dann auch Dürer, der die Farbenpresse
Brauchte – auch für seine Phantasie
………………………………………………………..
…………………………………………………………
Unter diesem allen, Baronesse,
Denk′ ich ganz von ungefähr an Sie …
Aber gewiss ist ein Tizian
Oder der Saskia Auge daran
Schuld, – daß mir hier auf dem Künstlerplan
Solche liebe Gedanken nahn …
Und da sehn Sie: gedacht – gethan
Schon fällt ein ganzes Gedicht Sie anich sie Ihnen über alle Weiten – beide: Glück auf!
…
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
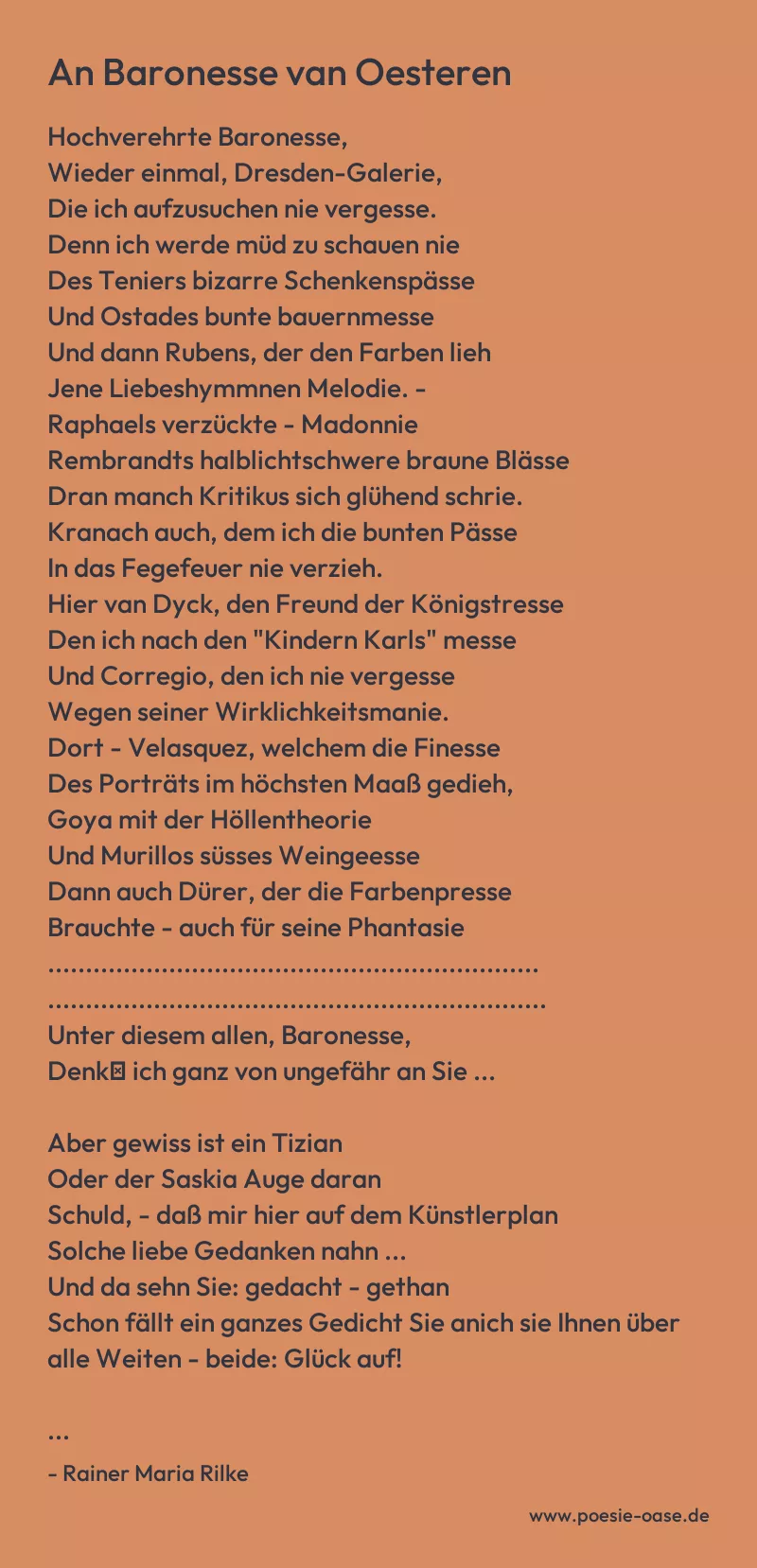
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An Baronesse van Oesteren“ von Rainer Maria Rilke ist eine liebevolle und humorvolle Widmung, die die Betrachtung von Kunst in der Dresdner Galerie mit dem Gedanken an die Baronesse verbindet. Das Gedicht beginnt mit einer direkten Anrede und der Feststellung, dass der Dichter die Galerie regelmäßig besucht, da er sich nie am Betrachten der Kunst sattsehen kann. Es folgt eine Aufzählung verschiedener Künstler und ihrer Werke, die Rilke in der Galerie betrachtet.
In der Aufzählung der Künstler und ihrer Werke spiegelt sich Rilkes Begeisterung für die Kunst wider. Er nennt sowohl bekannte Namen wie Rubens, Raphael, Rembrandt und Velasquez als auch weniger bekannte Künstler wie Teniers und Ostade. Durch die Nennung verschiedener Stile und Epochen zeigt er die Vielfalt der Kunst, die ihn fasziniert. Die bildhaften Beschreibungen der Kunstwerke, wie etwa „Rubens, der den Farben lieh / Jene Liebeshymmnen Melodie“ oder „Rembrandts halblichtschwere braune Blässe“, vermitteln dem Leser einen Eindruck von der Schönheit und den Emotionen, die die Kunst in ihm auslöst.
Der eigentliche Clou des Gedichts liegt in der überraschenden Wendung am Ende der Aufzählung. Nach der Beschreibung der Kunstwerke und der tiefen Auseinandersetzung mit ihnen kommt die Baronesse ins Spiel. Rilke gesteht, dass all die Kunst ihn an sie erinnert hat. Dieser Übergang von der Kunst zur geliebten Person verleiht dem Gedicht eine persönliche Note und macht es zu einer charmanten Liebeserklärung. Die letzte Strophe, die mit „Aber gewiss ist ein Tizian / Oder der Saskia Auge daran / Schuld“ beginnt, nimmt die Schuld für die Gedanken an die Baronesse auf sich und schließt das Gedicht mit einem spielerischen Bekenntnis ab.
Die Sprache des Gedichts ist elegant und bildhaft, typisch für Rilkes Stil. Er nutzt eine Vielzahl von Adjektiven und Vergleichen, um die Kunstwerke lebendig werden zu lassen. Der Reim und der Rhythmus des Gedichts tragen zur Harmonie und zum Lesevergnügen bei. Der liebevolle Ton des Gedichts macht es zu einer warmherzigen Hommage an die Kunst und an die Person, an die der Dichter in diesem Moment denkt. Durch die Kombination von Kunstbetrachtung und Liebeserklärung entsteht ein vielschichtiges und bezauberndes Gedicht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.