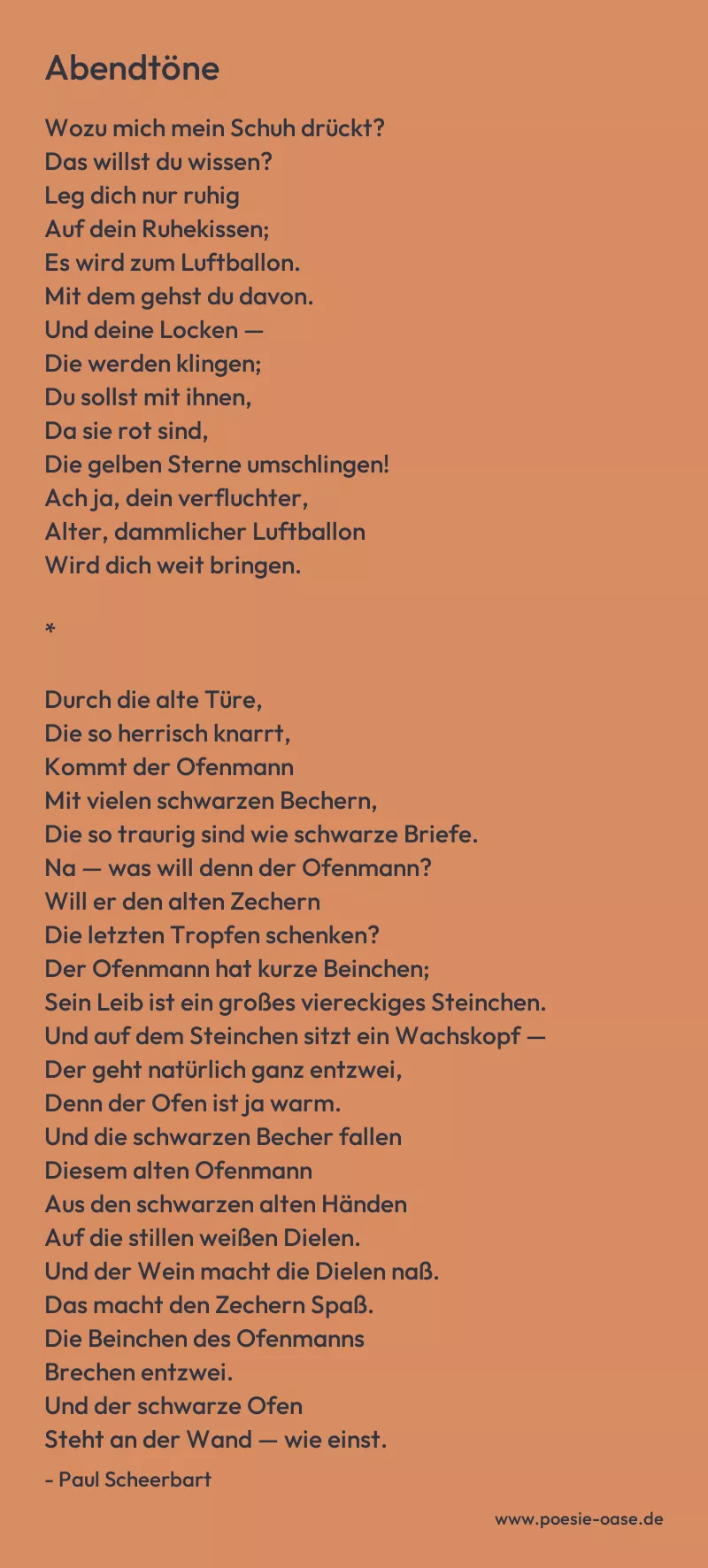Abendtöne
Wozu mich mein Schuh drückt?
Das willst du wissen?
Leg dich nur ruhig
Auf dein Ruhekissen;
Es wird zum Luftballon.
Mit dem gehst du davon.
Und deine Locken —
Die werden klingen;
Du sollst mit ihnen,
Da sie rot sind,
Die gelben Sterne umschlingen!
Ach ja, dein verfluchter,
Alter, dammlicher Luftballon
Wird dich weit bringen.
*
Durch die alte Türe,
Die so herrisch knarrt,
Kommt der Ofenmann
Mit vielen schwarzen Bechern,
Die so traurig sind wie schwarze Briefe.
Na — was will denn der Ofenmann?
Will er den alten Zechern
Die letzten Tropfen schenken?
Der Ofenmann hat kurze Beinchen;
Sein Leib ist ein großes viereckiges Steinchen.
Und auf dem Steinchen sitzt ein Wachskopf —
Der geht natürlich ganz entzwei,
Denn der Ofen ist ja warm.
Und die schwarzen Becher fallen
Diesem alten Ofenmann
Aus den schwarzen alten Händen
Auf die stillen weißen Dielen.
Und der Wein macht die Dielen naß.
Das macht den Zechern Spaß.
Die Beinchen des Ofenmanns
Brechen entzwei.
Und der schwarze Ofen
Steht an der Wand — wie einst.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
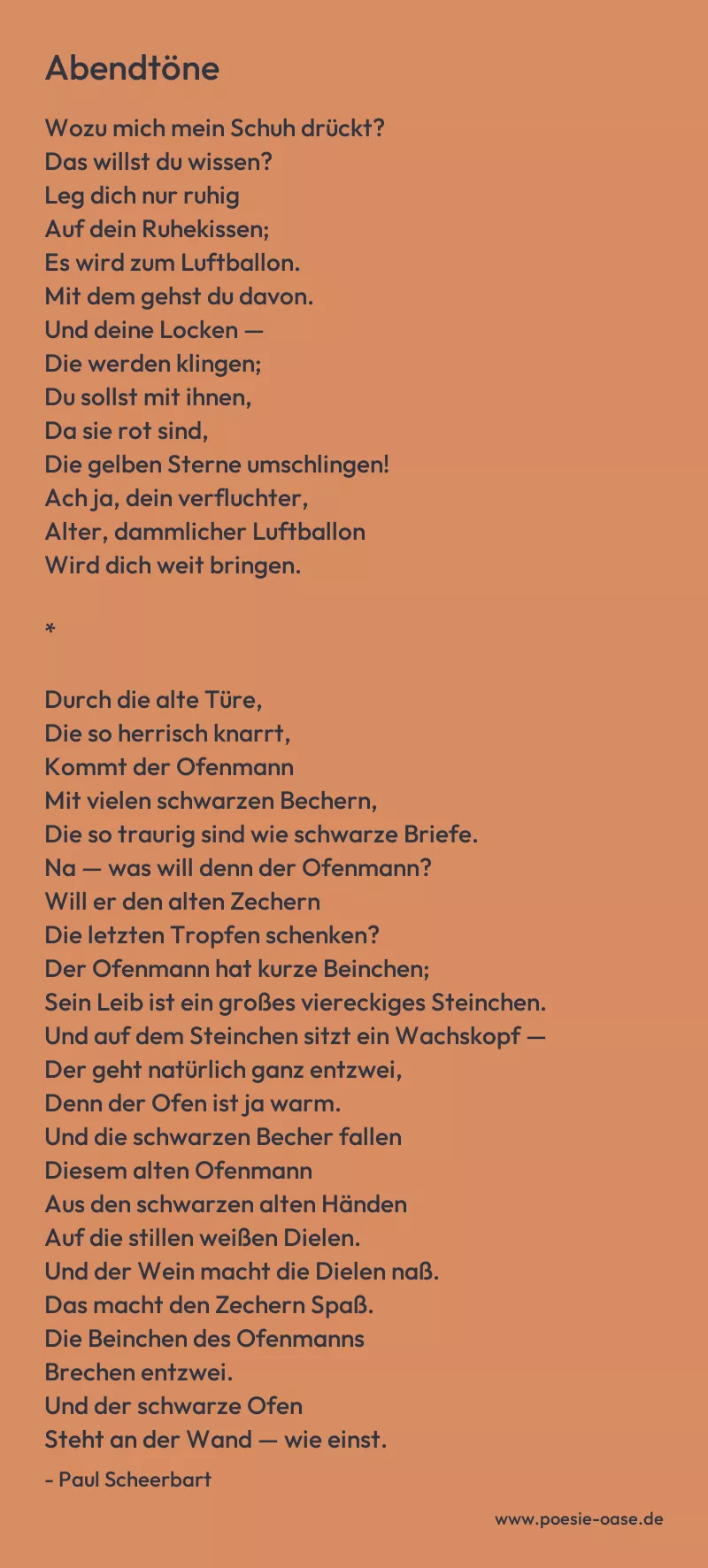
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Abendtöne“ von Paul Scheerbart entfaltet sich in zwei Teilen, die durch ihren Kontrast eine ganz eigene Atmosphäre erzeugen. Der erste Teil wirkt leicht und traumhaft, fast spielerisch. Der Sprecher wendet sich scheinbar an eine Person, vielleicht einen Geliebten oder eine Geliebte, und lädt sie ein, sich dem Traum hinzugeben. Die Beschwerden des Tages, symbolisiert durch den drückenden Schuh, sollen vergessen werden. Ein Luftballon, der als Fluchtmittel dient, und die roten Locken, die die gelben Sterne umarmen, erzeugen Bilder von Schwerelosigkeit, Fantasie und einer Verbindung zur kosmischen Welt. Die Sprache ist einfach, fast kindlich, mit sanften Reimen, die die Leichtigkeit und den surrealen Charakter der Szene unterstreichen. Der „verfluchte, alte, dammliche Luftballon“ verweist auf das spielerische Element der Moderne, das Scheerbart in vielen seiner Werke zum Ausdruck bringt.
Der zweite Teil des Gedichts vollzieht einen radikalen Bruch. Die Leichtigkeit weicht einer düsteren Szenerie, die von Tod, Verfall und Abschied geprägt ist. Der „Ofenmann“, der mit schwarzen Bechern eintritt, wirkt wie eine Todesgestalt, die an die Vergänglichkeit des Lebens erinnert. Die „schwarzen Becher“, die „traurig sind wie schwarze Briefe“, sind ein starkes Symbol für Trauer und Verlust. Die Szene ist von einer bedrückenden Atmosphäre geprägt. Der Ofenmanns, der an eine grobe, unbeholfene Gestalt erinnert, die an einem Wachskopf zu zerbrechen droht, veranschaulicht die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens. Der Wein, der auf die Dielen tropft, kann als Bild für die Auflösung des Lebens und des Körpers interpretiert werden.
Scheerbart verwendet eine Reihe von Symbolen, um die beiden gegensätzlichen Stimmungen und Themen zu verdeutlichen. Der Luftballon steht für die Flucht aus der Realität und die Sehnsucht nach einer anderen Welt. Die roten Locken, die Sterne umschlingen, symbolisieren die Verbindung des Menschen mit dem Kosmos und die Suche nach Schönheit und Unendlichkeit. Im zweiten Teil repräsentieren die schwarzen Becher, der Ofenmann und die zerbrochenen Gliedmaßen die Endlichkeit des Lebens, den Tod und die Trauer über den Verlust.
Die Spannung zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Leichtigkeit und Schwere ist ein zentrales Thema des Gedichts. Scheerbart entwirft eine Welt, in der das Spielerische, die Fantasie und die Sehnsucht nach dem Übersinnlichen dem Fakt der Vergänglichkeit gegenüberstehen. Das Gedicht spiegelt die Widersprüche des Lebens wider und lädt den Leser ein, über die Natur des Seins und die Beziehung zwischen Traum und Realität nachzudenken. Die beiden Teile, die sich in ihrer Stimmung und Symbolik unterscheiden, verschmelzen zu einem komplexen Bild des menschlichen Daseins.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.