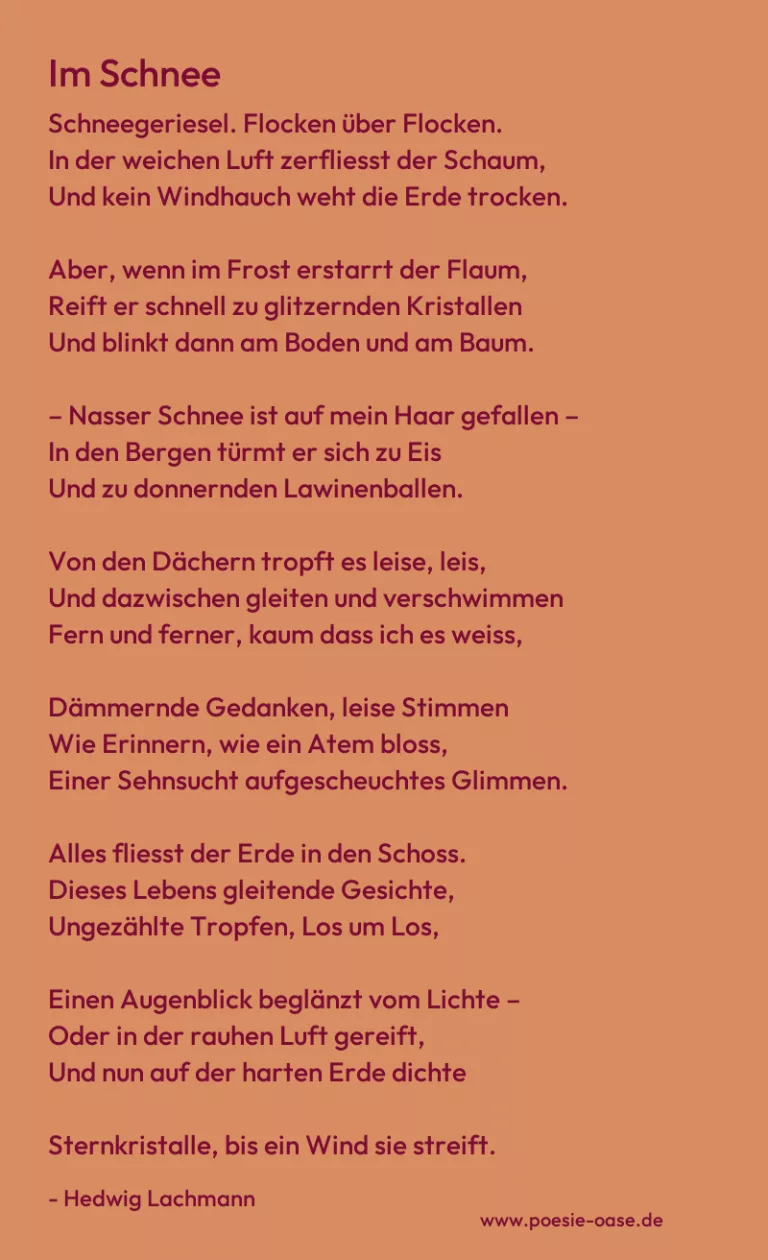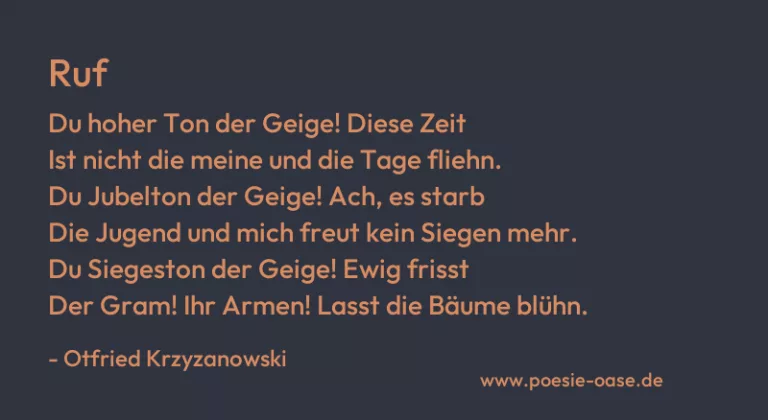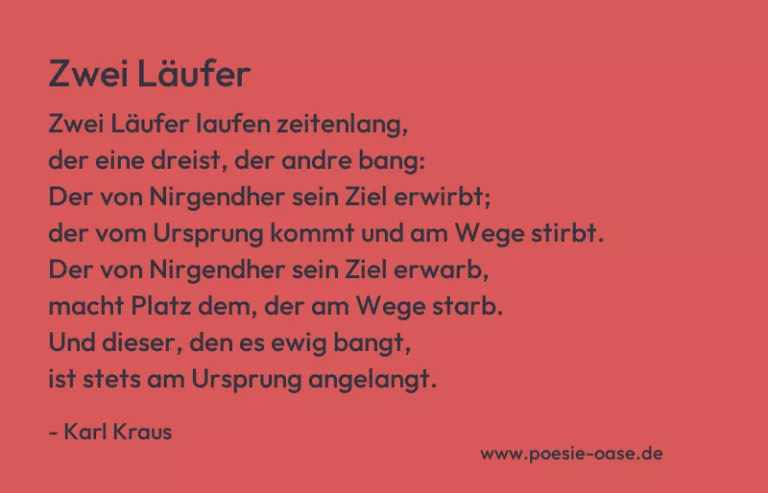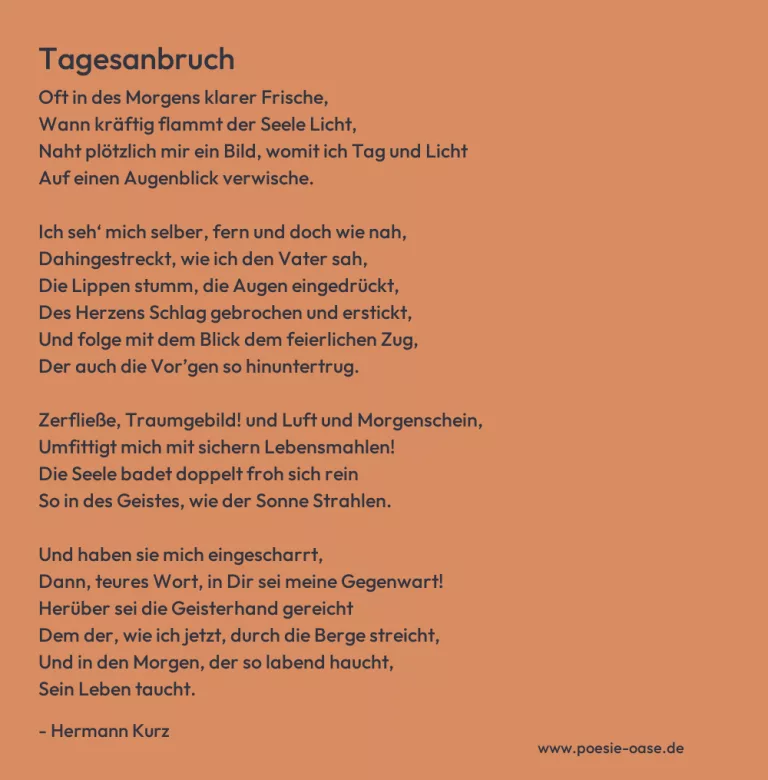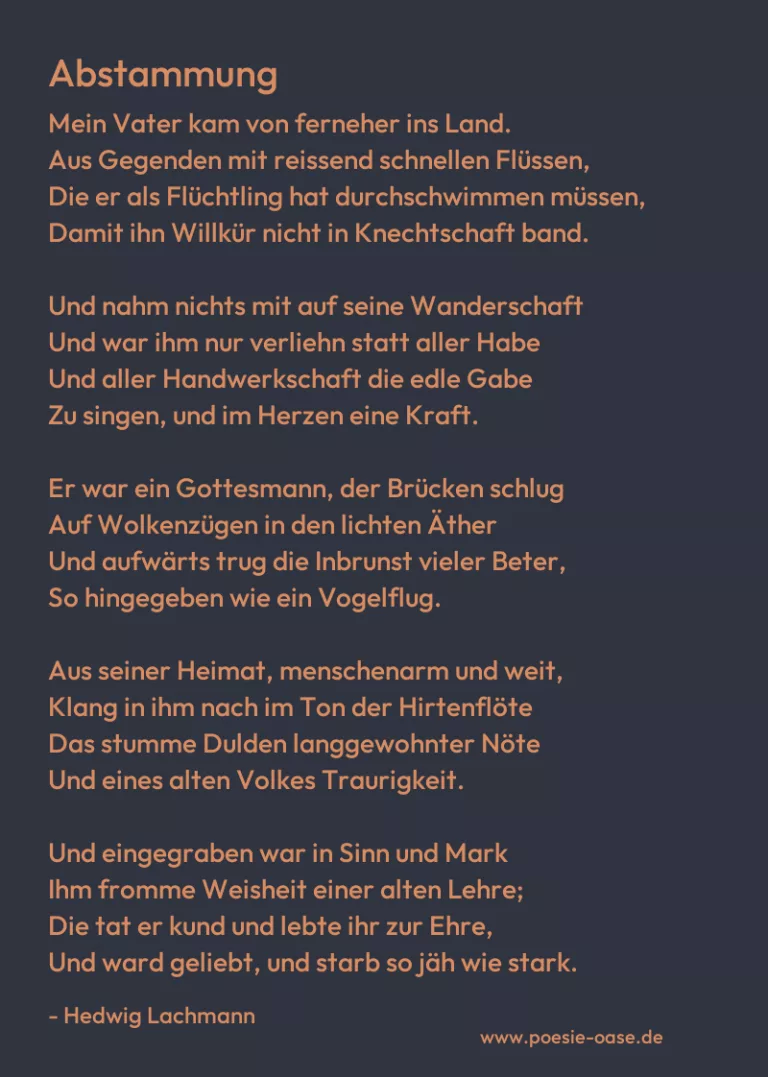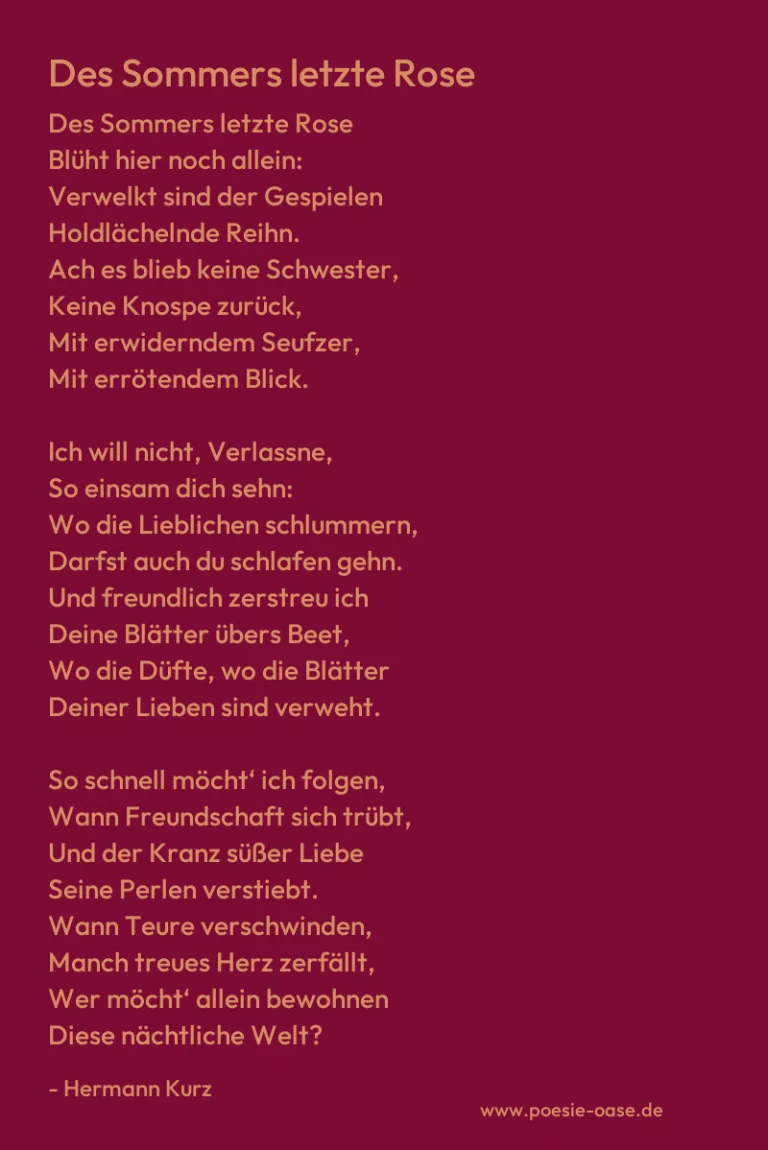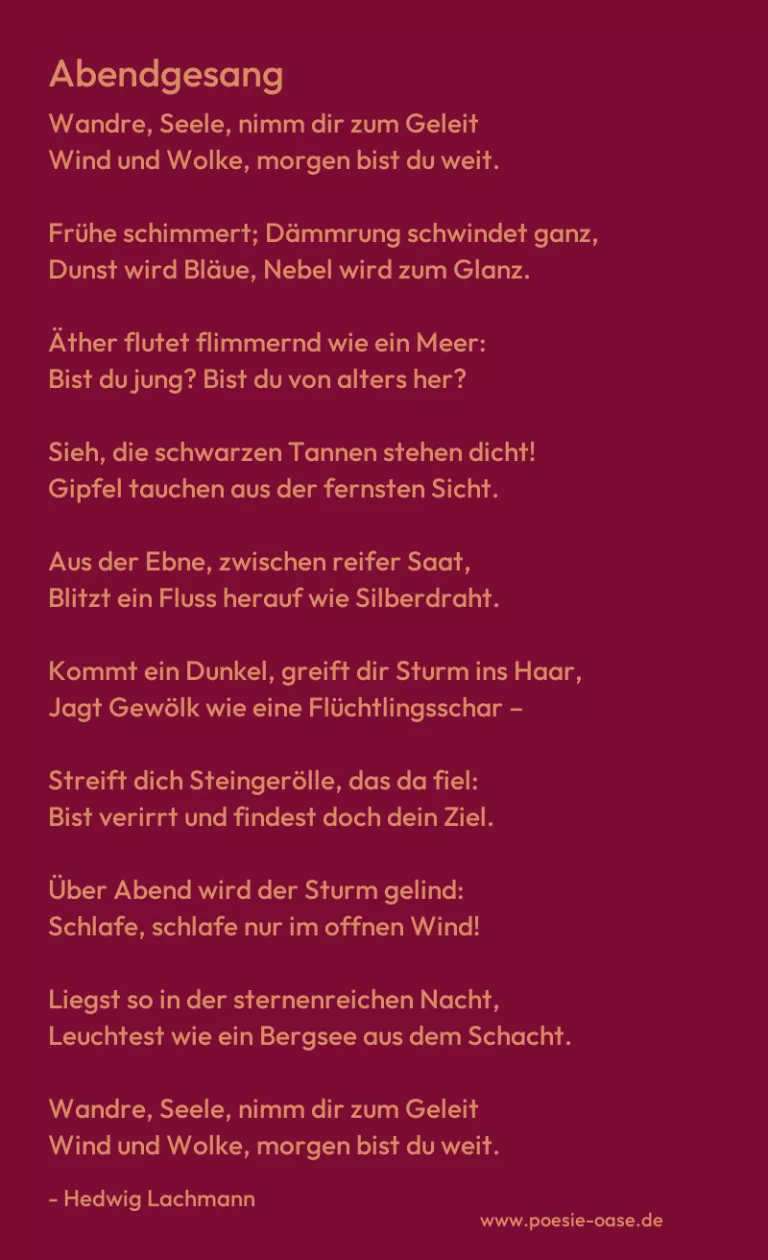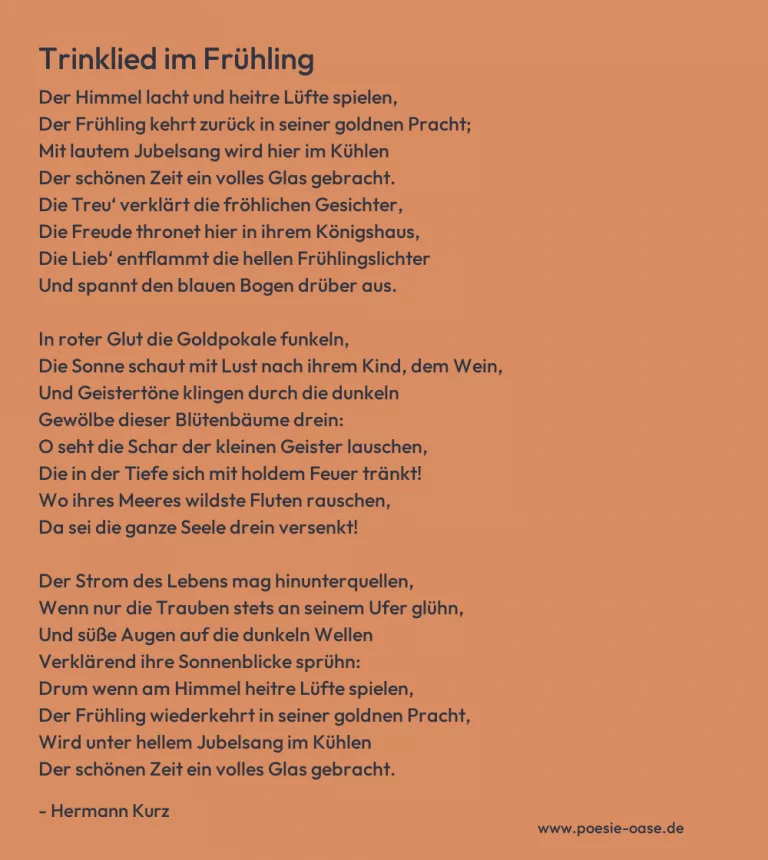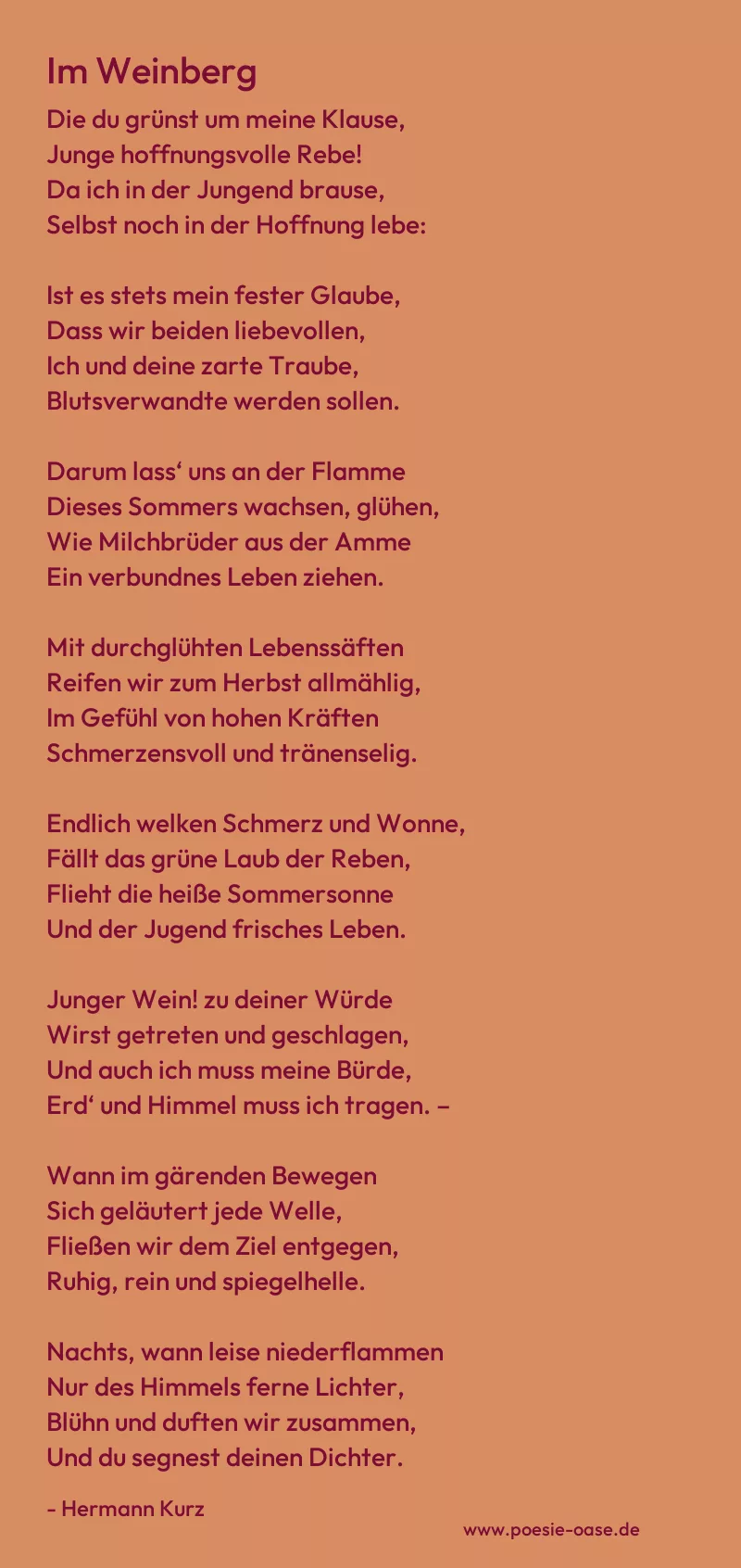Abenteuer & Reisen, Alltag, Emotionen & Gefühle, Feiertage, Fortschritt, Gemeinfrei, Götter, Harmonie, Herbst, Jahreszeiten, Leidenschaft, Sommer
Im Weinberg
Die du grünst um meine Klause,
Junge hoffnungsvolle Rebe!
Da ich in der Jungend brause,
Selbst noch in der Hoffnung lebe:
Ist es stets mein fester Glaube,
Dass wir beiden liebevollen,
Ich und deine zarte Traube,
Blutsverwandte werden sollen.
Darum lass‘ uns an der Flamme
Dieses Sommers wachsen, glühen,
Wie Milchbrüder aus der Amme
Ein verbundnes Leben ziehen.
Mit durchglühten Lebenssäften
Reifen wir zum Herbst allmählig,
Im Gefühl von hohen Kräften
Schmerzensvoll und tränenselig.
Endlich welken Schmerz und Wonne,
Fällt das grüne Laub der Reben,
Flieht die heiße Sommersonne
Und der Jugend frisches Leben.
Junger Wein! zu deiner Würde
Wirst getreten und geschlagen,
Und auch ich muss meine Bürde,
Erd‘ und Himmel muss ich tragen. –
Wann im gärenden Bewegen
Sich geläutert jede Welle,
Fließen wir dem Ziel entgegen,
Ruhig, rein und spiegelhelle.
Nachts, wann leise niederflammen
Nur des Himmels ferne Lichter,
Blühn und duften wir zusammen,
Und du segnest deinen Dichter.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
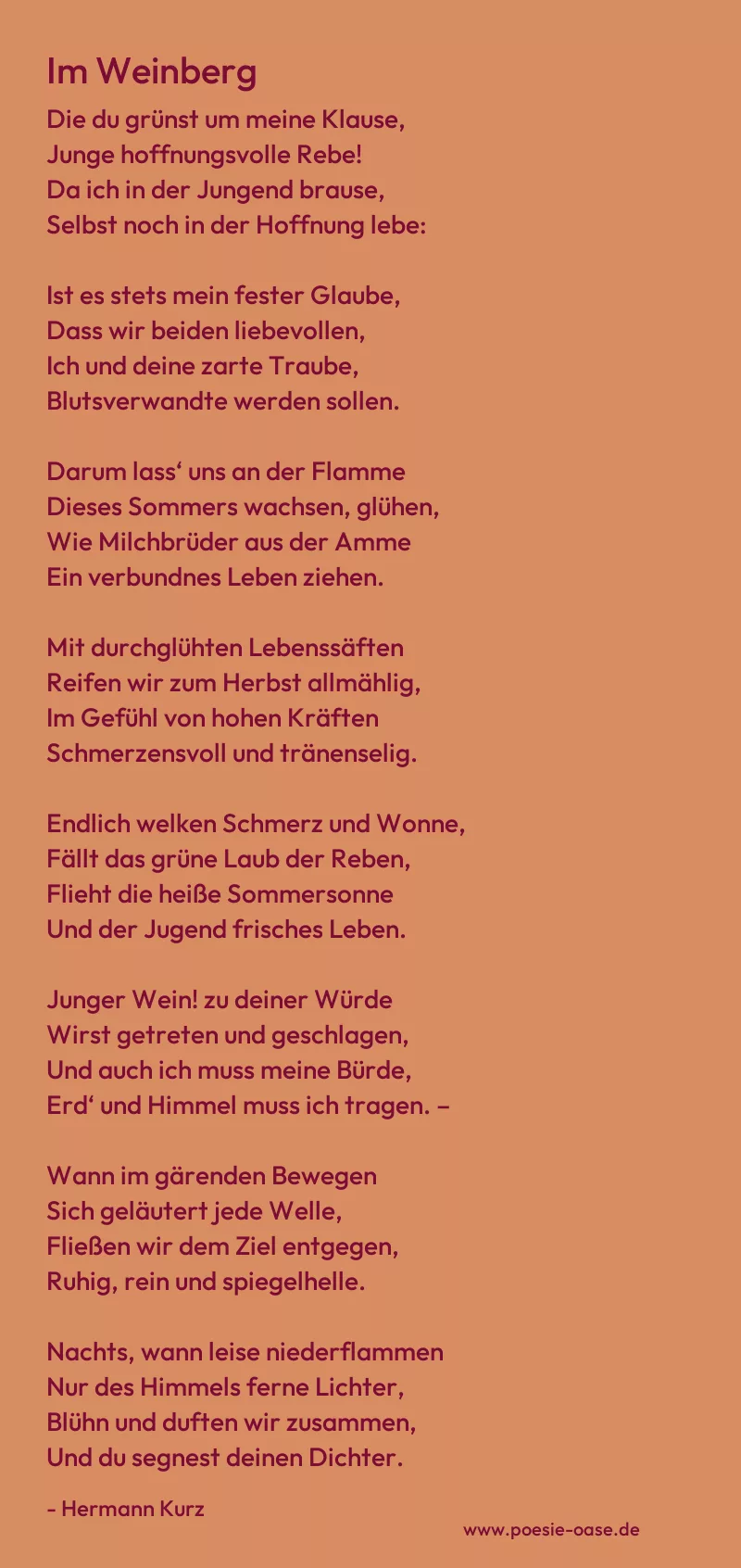
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Im Weinberg“ von Hermann Kurz stellt eine symbolische Darstellung des Lebens und seiner Prozesse dar, indem es die Entwicklung der Rebe und des Weins als Metapher für das menschliche Leben und die persönliche Entfaltung verwendet. Zu Beginn des Gedichts beschreibt der Sprecher eine junge Rebe, die um seine „Klause“ grünt, was auf ein Symbol der Hoffnung und des Wachstums hinweist. Die Rebe, die mit der Jugend und Hoffnung in Verbindung steht, ist ein Bild für die Erwartungen und Träume des Sprechers, der in seiner Jugend lebt und noch fest an eine positive Zukunft glaubt.
Die Vorstellung, dass der Sprecher und die Rebe „Blutsverwandte“ werden sollen, verstärkt den Gedanken einer tiefen, innigen Verbindung zwischen dem Individuum und der Natur. Der Glaube an eine solche Verbindung zeigt sich auch im Wunsch, dass die Rebe und der Sprecher gemeinsam wachsen und sich entfalten. Diese Metapher wird weiter ausgebaut, als der Sprecher vorschlägt, dass sie „an der Flamme dieses Sommers wachsen, glühen“, was auf die Energie und Leidenschaft des Lebens in seiner besten Form hinweist, aber auch die Entbehrungen und Prüfungen, die damit einhergehen.
Im weiteren Verlauf des Gedichts tritt eine Wendung ein, als die Rebe und der Sprecher erkennen, dass der Reifeprozess auch mit Schmerzen und Schwierigkeiten verbunden ist. „Schmerzensvoll und tränenselig“ reifen die Trauben im „Herbst“, was den natürlichen Zyklus des Lebens widerspiegelt – der Übergang von der Jugend zu einer reiferen, schmerzhafteren Existenz. Der Herbst steht hier symbolisch für das Ernten der Früchte des Lebens, wobei auch die negativen Aspekte des Lebens nicht zu umgehen sind.
Das Bild des „jungen Weins“, der „getreten und geschlagen“ wird, um „zu seiner Würde“ zu gelangen, verdeutlicht den Kampf und die Anstrengung, die notwendig sind, um im Leben „reif“ zu werden. Es ist eine Erinnerung daran, dass auch der Prozess der Läuterung und der persönlichen Entwicklung nicht ohne Herausforderungen und Opfer auskommt. Die Metapher des Weins, der durch den Gärungsprozess „geläutert“ wird, spricht von der Transformation und der inneren Klarheit, die am Ende der Reise erreicht wird.
Das Gedicht endet mit einer friedlichen Vision, in der der Sprecher und die Rebe „zusammen blühen und duften“ und der Wein schließlich zu einem Symbol der Weisheit und des Friedens wird. Der Dichter, als Teil dieses Prozesses, erfährt eine Art spirituelle Segnung, indem er die Reife des Lebens und der Kunst in einer reinen und harmonischen Form erkennt. Es ist eine Reflexion über das Leben, das sowohl Herausforderungen als auch Schönheit und Erlösung in sich trägt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.