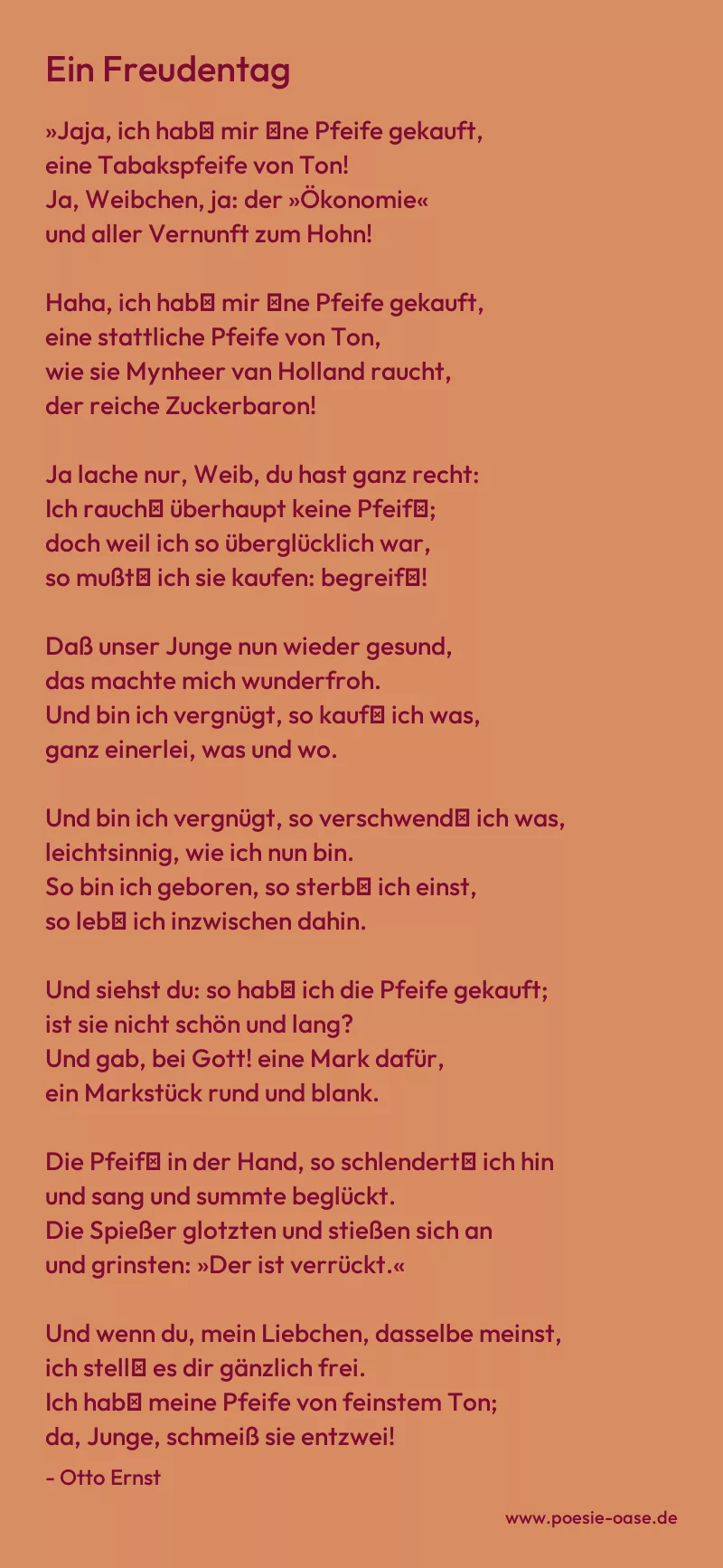»Jaja, ich hab′ mir ′ne Pfeife gekauft,
eine Tabakspfeife von Ton!
Ja, Weibchen, ja: der »Ökonomie«
und aller Vernunft zum Hohn!
Haha, ich hab′ mir ′ne Pfeife gekauft,
eine stattliche Pfeife von Ton,
wie sie Mynheer van Holland raucht,
der reiche Zuckerbaron!
Ja lache nur, Weib, du hast ganz recht:
Ich rauch′ überhaupt keine Pfeif′;
doch weil ich so überglücklich war,
so mußt′ ich sie kaufen: begreif′!
Daß unser Junge nun wieder gesund,
das machte mich wunderfroh.
Und bin ich vergnügt, so kauf′ ich was,
ganz einerlei, was und wo.
Und bin ich vergnügt, so verschwend′ ich was,
leichtsinnig, wie ich nun bin.
So bin ich geboren, so sterb′ ich einst,
so leb′ ich inzwischen dahin.
Und siehst du: so hab′ ich die Pfeife gekauft;
ist sie nicht schön und lang?
Und gab, bei Gott! eine Mark dafür,
ein Markstück rund und blank.
Die Pfeif′ in der Hand, so schlendert′ ich hin
und sang und summte beglückt.
Die Spießer glotzten und stießen sich an
und grinsten: »Der ist verrückt.«
Und wenn du, mein Liebchen, dasselbe meinst,
ich stell′ es dir gänzlich frei.
Ich hab′ meine Pfeife von feinstem Ton;
da, Junge, schmeiß sie entzwei!