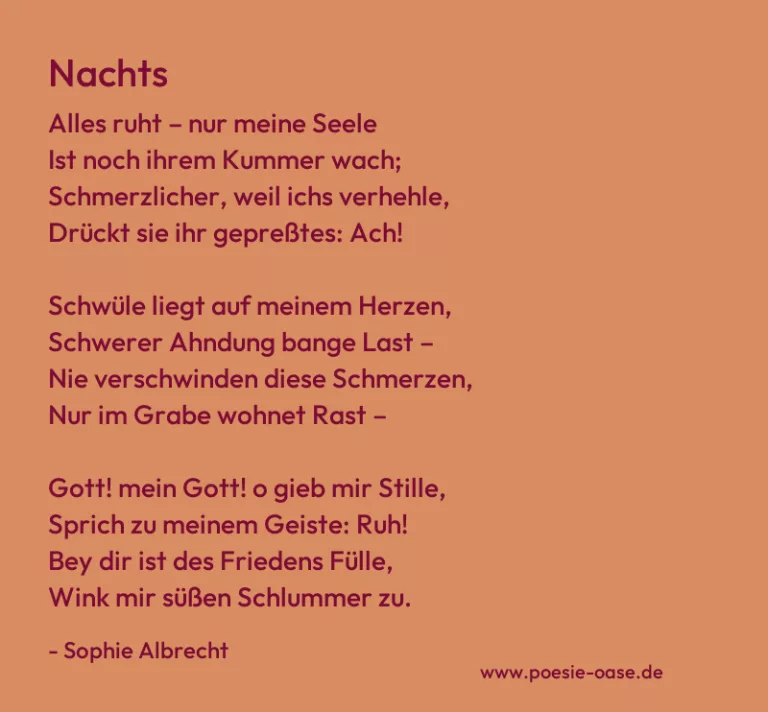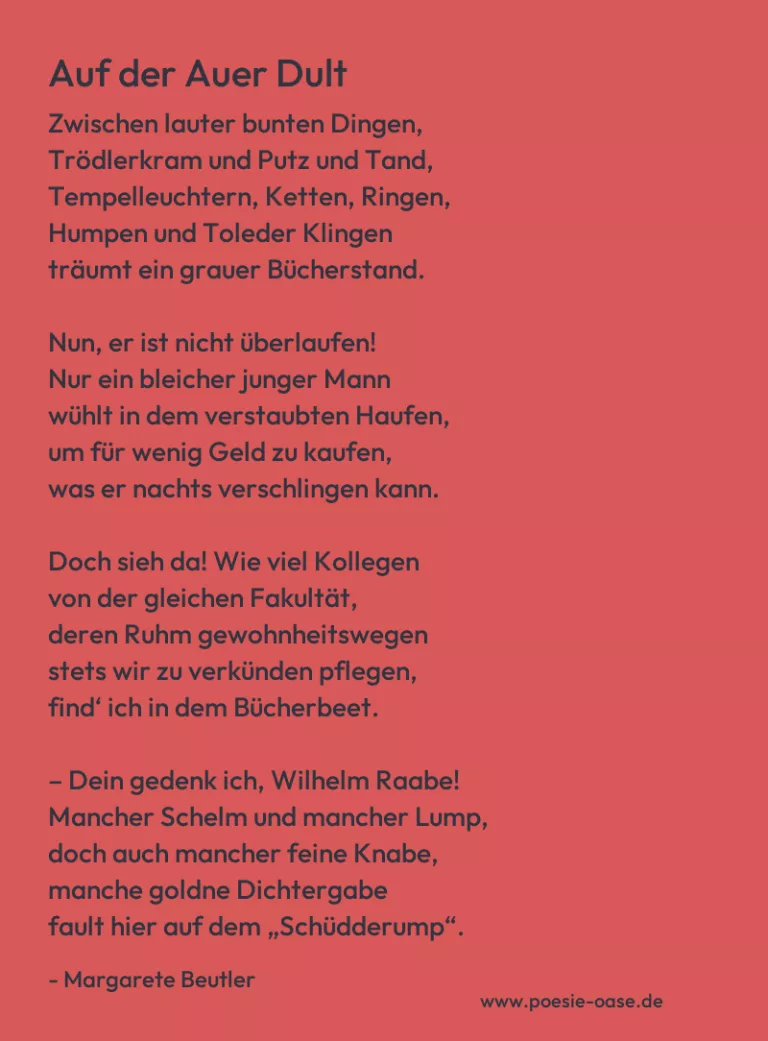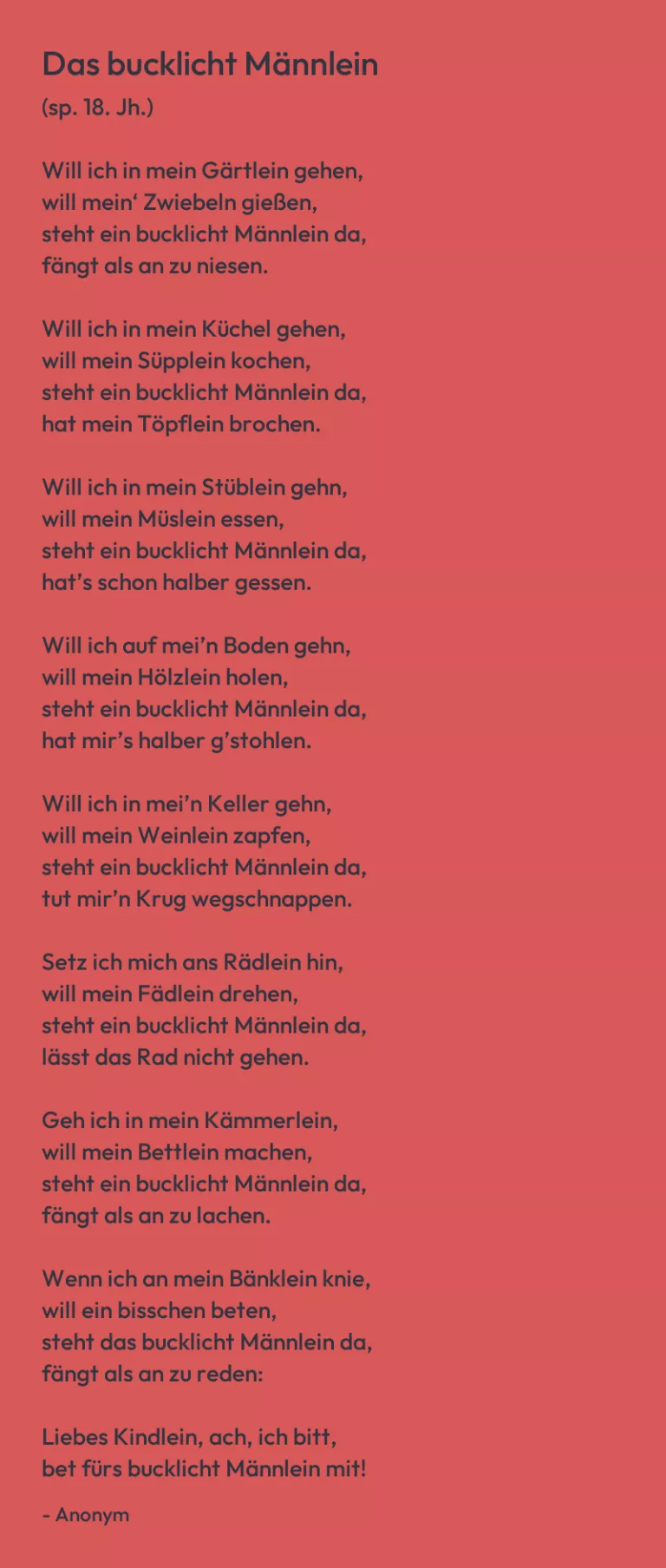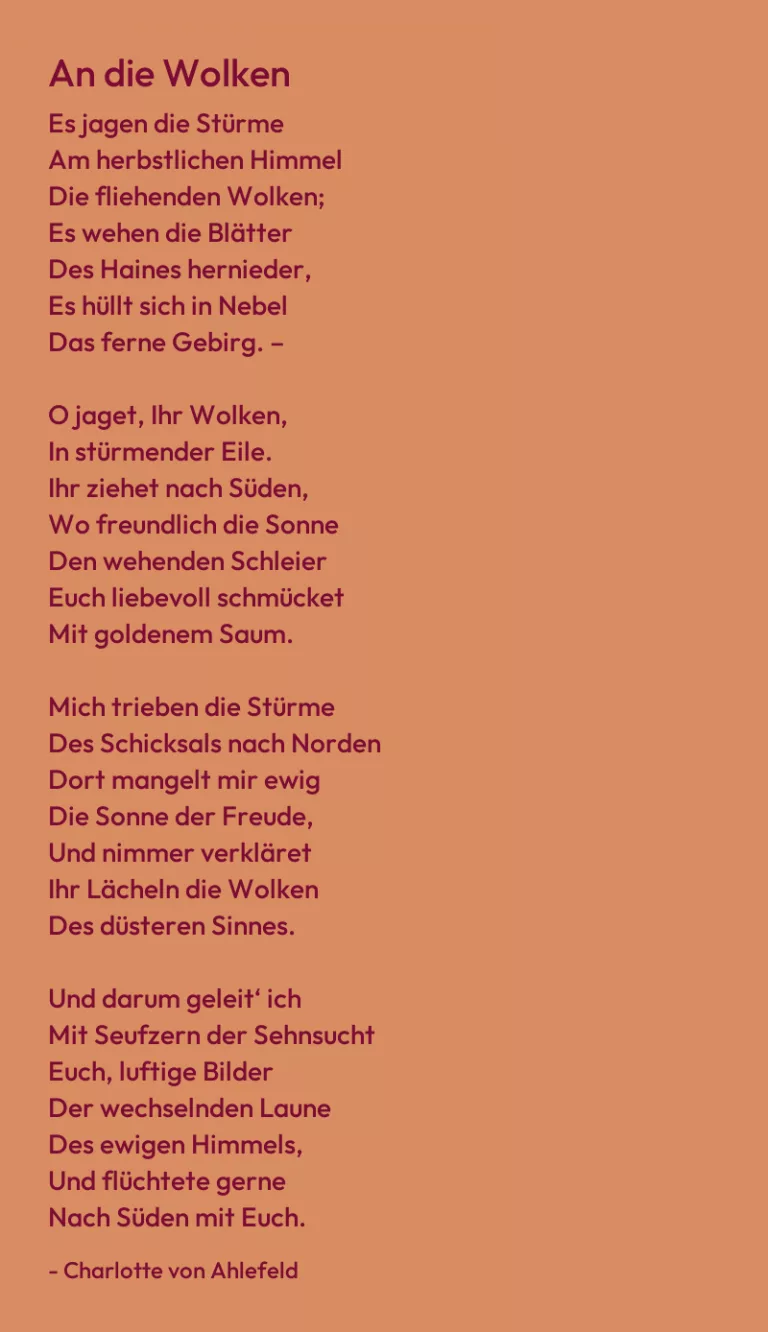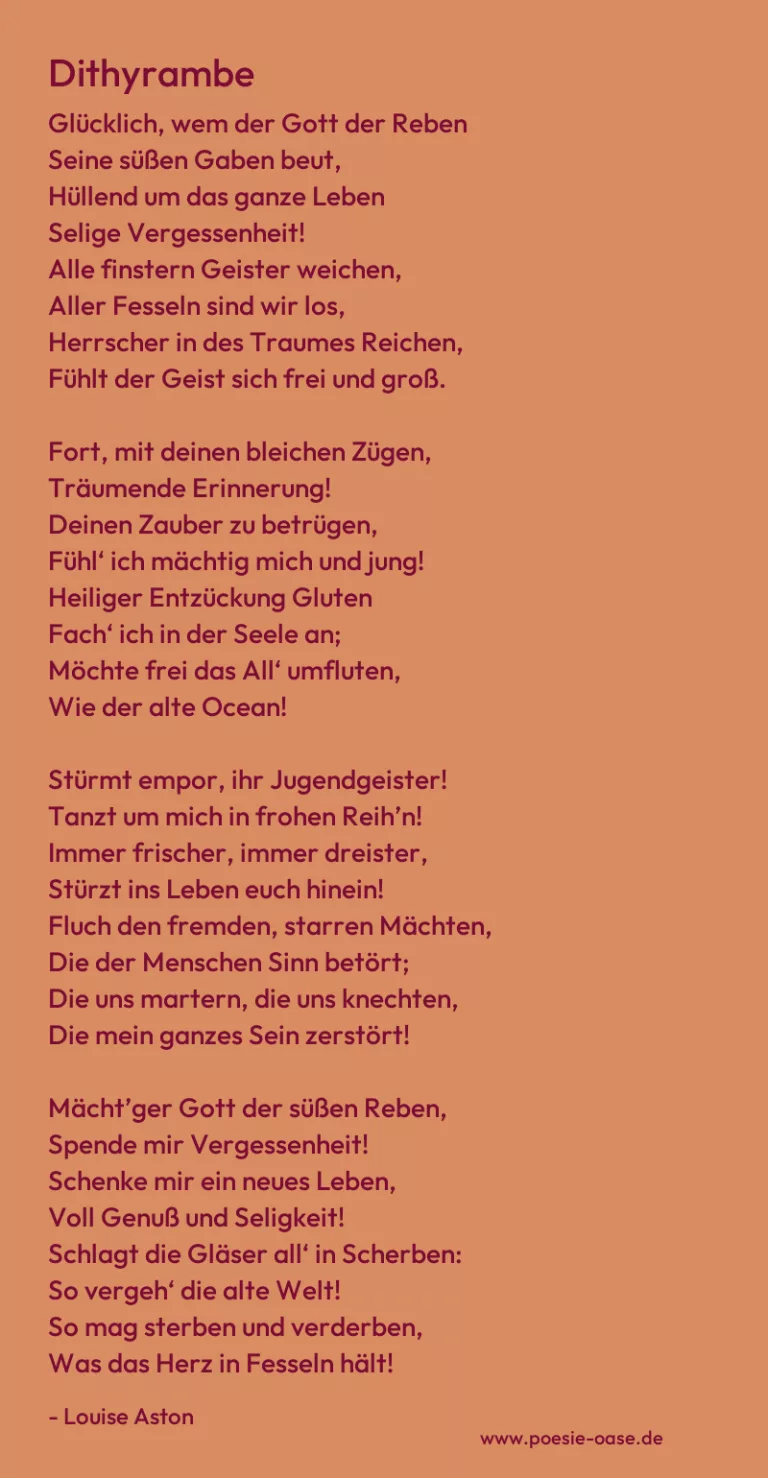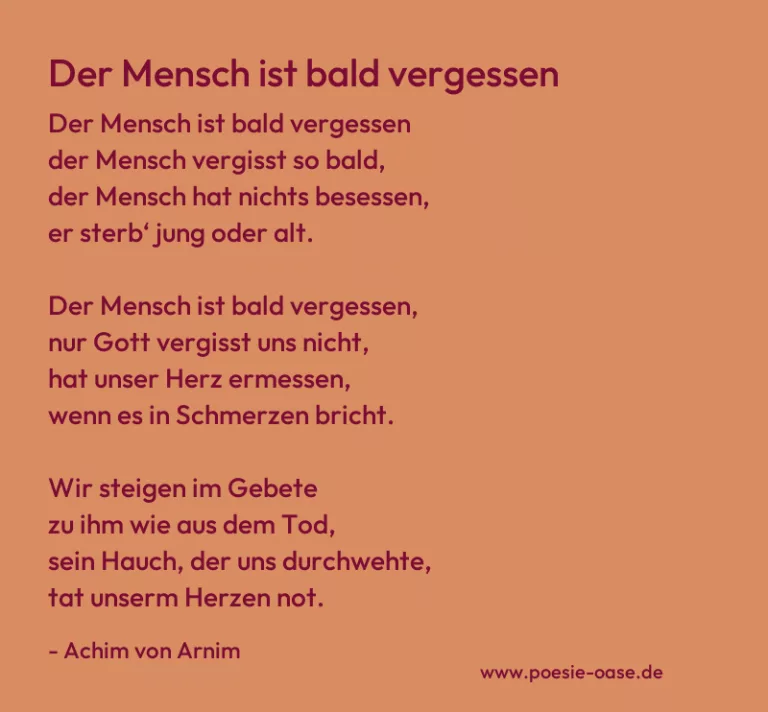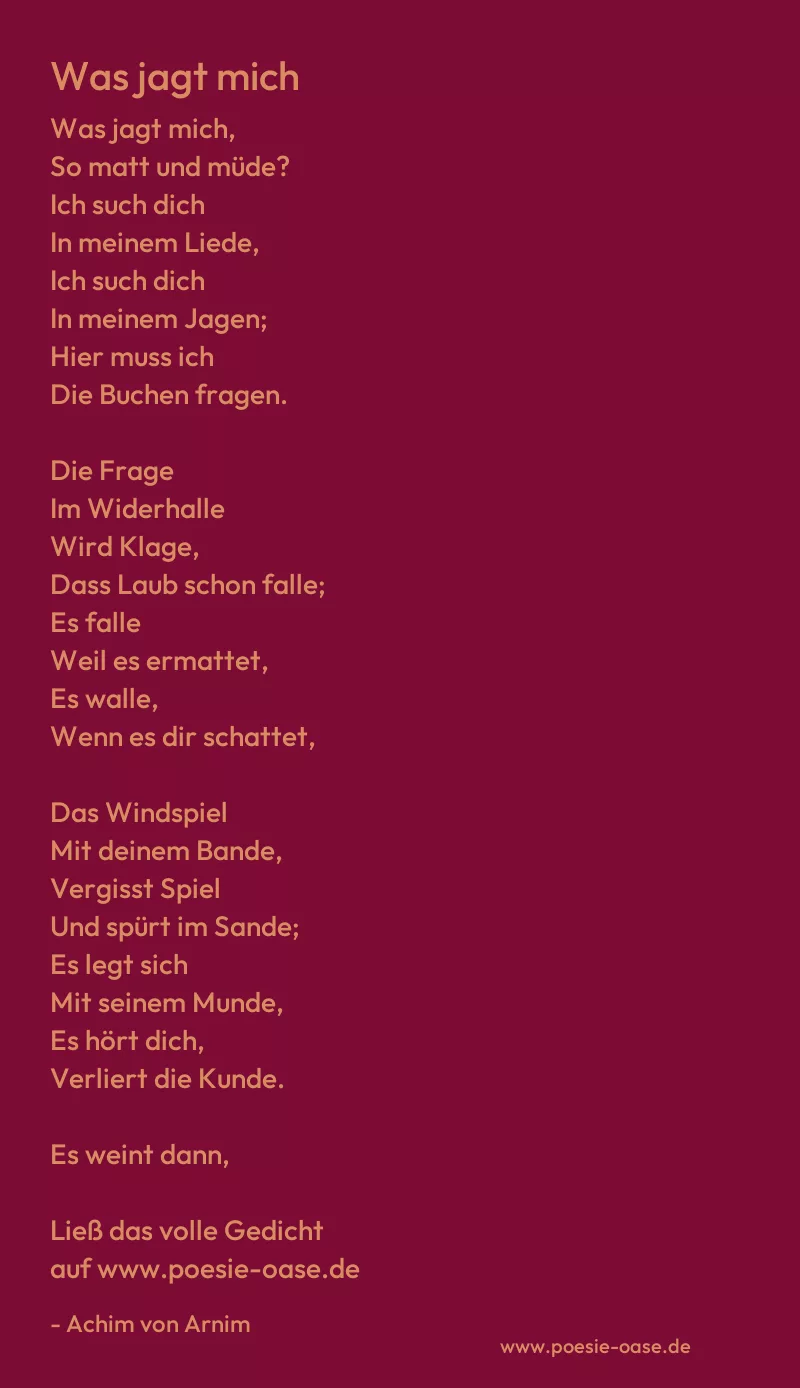Was jagt mich
Was jagt mich,
So matt und müde?
Ich such dich
In meinem Liede,
Ich such dich
In meinem Jagen;
Hier muss ich
Die Buchen fragen.
Die Frage
Im Widerhalle
Wird Klage,
Dass Laub schon falle;
Es falle
Weil es ermattet,
Es walle,
Wenn es dir schattet,
Das Windspiel
Mit deinem Bande,
Vergisst Spiel
Und spürt im Sande;
Es legt sich
Mit seinem Munde,
Es hört dich,
Verliert die Kunde.
Es weint dann,
Wie Kinder weinen,
Und gräbt dann
Mit seinen Beinen;
Begräbt sich
Im tiefen Sande,
Begrabt mich
Im Heldenlande,
In weichen Armen
In stillem Kuss,
Zu lang mir Armen
Fehlt der Genuss.
Begrab mich
Und meine Lieder,
Bald komm ich
Und hol dich wieder.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
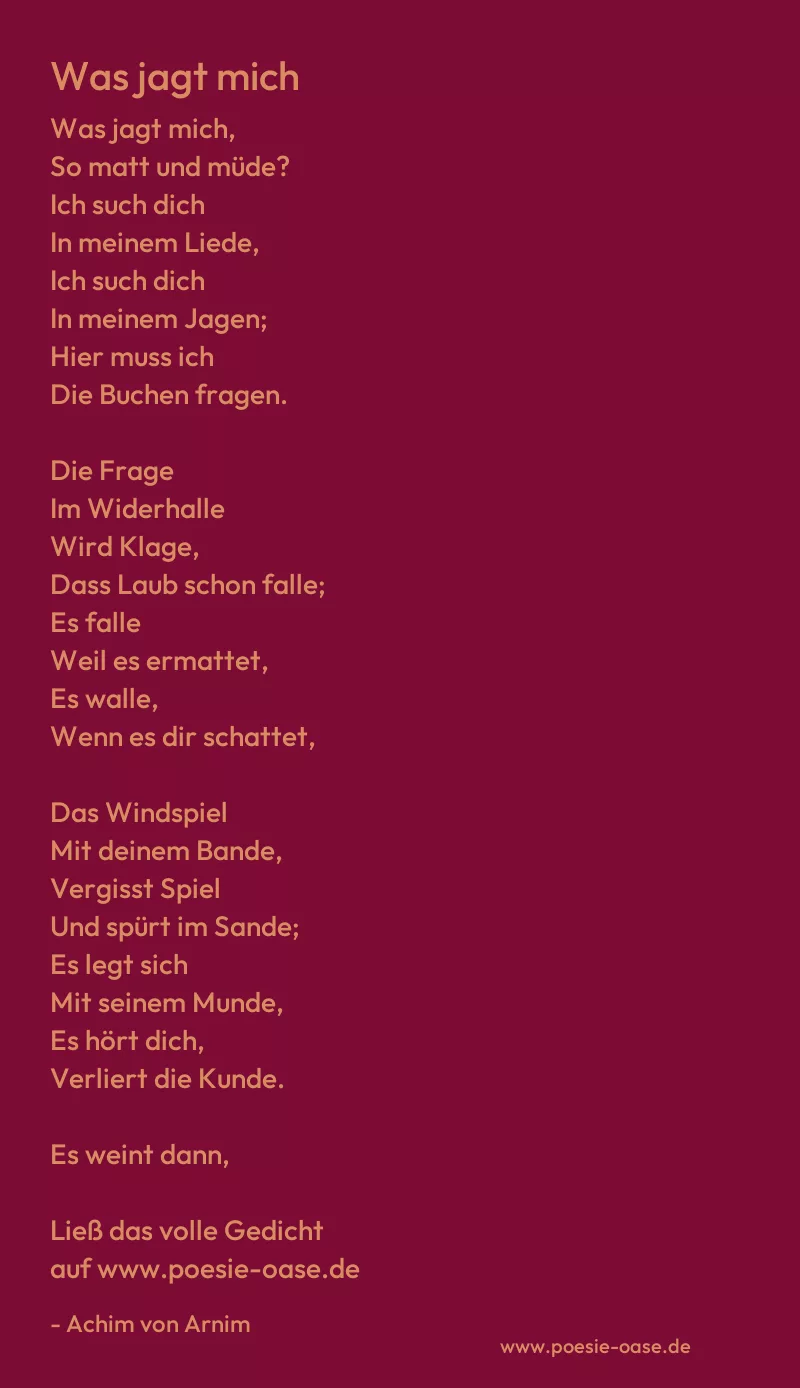
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Was jagt mich“ von Achim von Arnim thematisiert eine sehnsuchtsvolle Suche nach einer geliebten Person, die unerreichbar scheint. Das lyrische Ich ist von innerer Unruhe und Erschöpfung geprägt – eine Müdigkeit, die nicht körperlicher, sondern seelischer Natur ist. Die Jagd ist hier kein äußeres Streben, sondern eine metaphorische Suche nach Nähe, Trost und Erfüllung, die im Lied, in der Natur und sogar im Tier symbolisch fortgeführt wird.
Die erste Strophe zeigt diese Suche in Form eines inneren Dialogs mit der Natur. Der Sprecher projiziert seine Sehnsucht in das Umfeld – die Buchen werden zu Gesprächspartnern, als könne die Natur Auskunft über die Geliebte geben. Auch die folgende Klangwelt (Frage, Widerhall, Klage) spiegelt das Echo des Verlorenseins. Die fallenden Blätter stehen symbolisch für Vergänglichkeit und seelische Ermattung, während das Bild des Schattens auf eine Verbindung zwischen dem Verblassen der Natur und der Abwesenheit der Geliebten hindeutet.
Mit dem Bild des Windspiels wird die Sehnsucht auf ein Tier übertragen, das die Spur verliert und seine Lebendigkeit einbüßt. Auch dieses „vergisst Spiel“ – ein deutlicher Ausdruck dafür, dass selbst unschuldige Freude durch den Verlust der Geliebten getrübt ist. Die letzte Bewegung des Windspiels – das Sichbegraben im Sand – wird dann zur Vorwegnahme des eigenen Wunsches des lyrischen Ichs, selbst „begraben“ zu werden, wobei das „Heldenland“ sowohl als Ort des Todes als auch als romantisch-verklärter Ort der Wiedervereinigung gedeutet werden kann.
In den letzten Versen verdichtet sich das Motiv der Todessehnsucht: Der Wunsch nach einem „stillen Kuss“ und „weichen Armen“ wird zur idealisierten Vorstellung eines ewigen Zusammenseins nach dem Tod. Die Lieder, Ausdruck des inneren Erlebens, sollen mit dem Sprecher begraben werden. Doch der letzte Satz bricht diese Endgültigkeit: „Bald komm ich / Und hol dich wieder“ – ein paradoxes Versprechen, das sowohl auf ein Wiedersehen nach dem Tod als auch auf eine tiefe innere Bindung hindeutet, die selbst durch den Tod nicht aufgelöst wird.
Insgesamt zeichnet das Gedicht ein Bild romantischer Sehnsucht, in der Natur, Musik und Tod ineinandergreifen. Es ist geprägt von der Melancholie des Verlusts, aber auch von einer tiefen, fast mystischen Hoffnung auf Wiedervereinigung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.