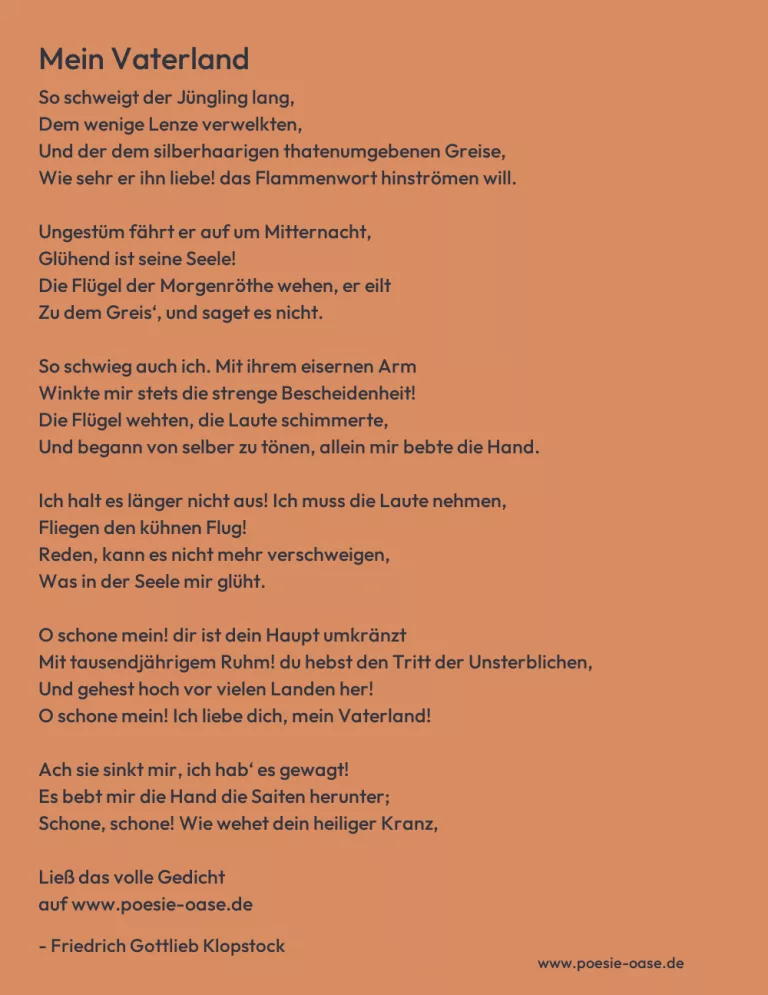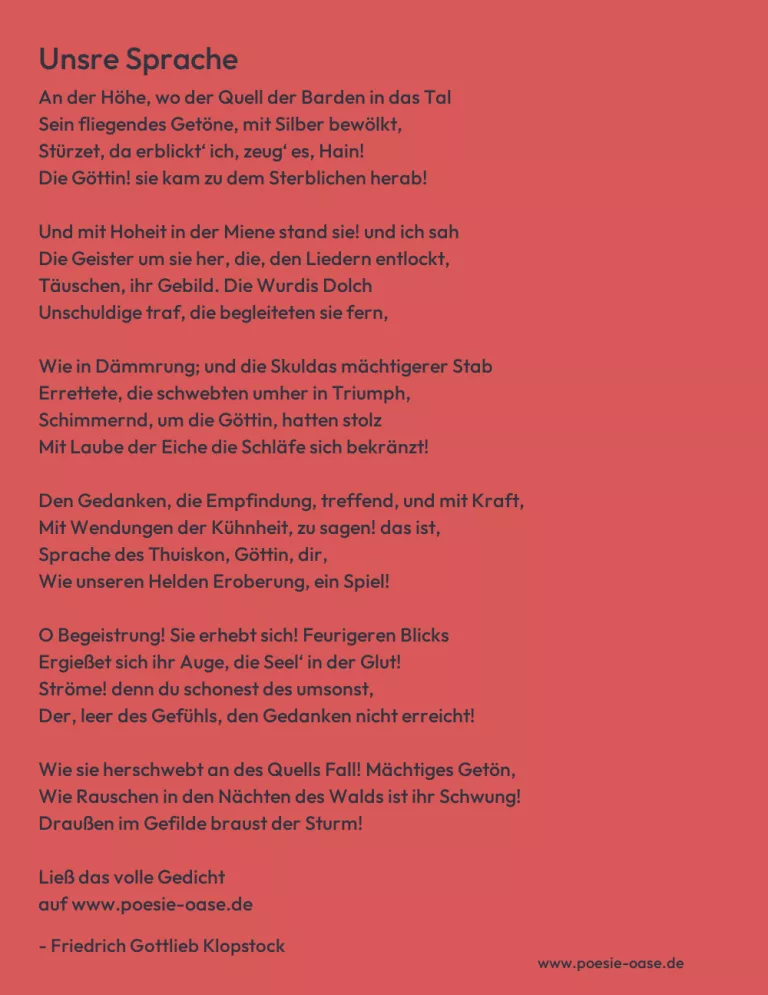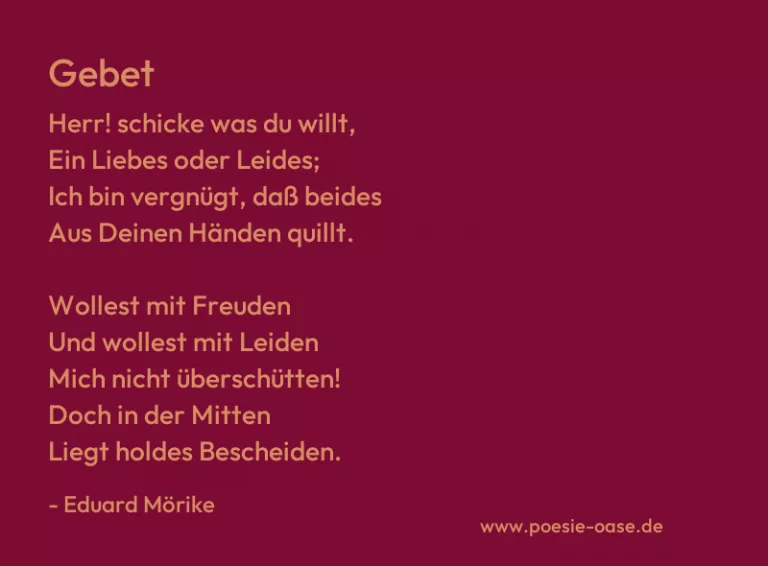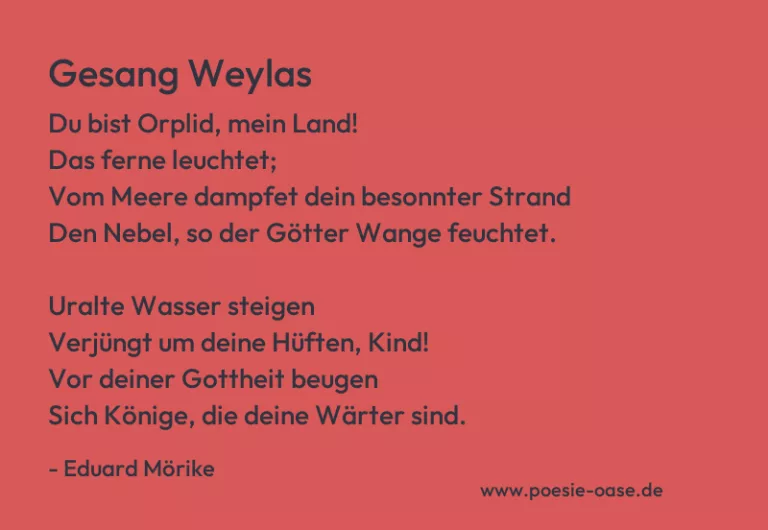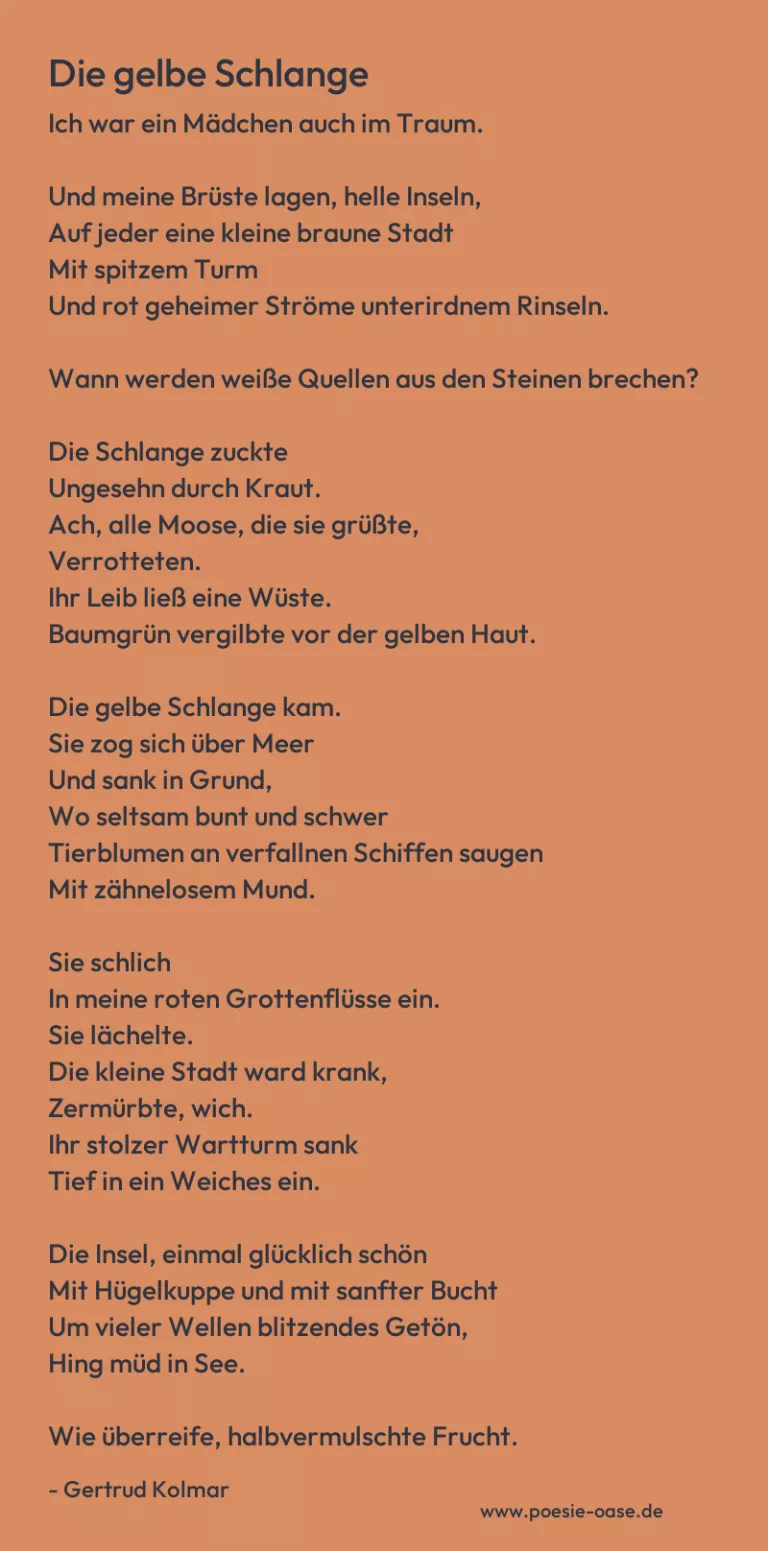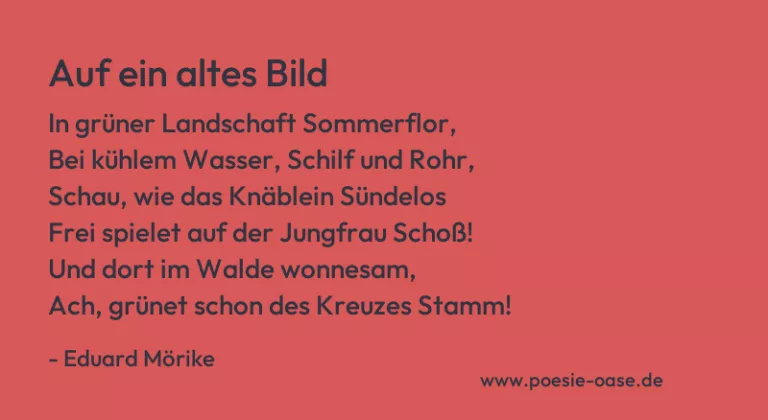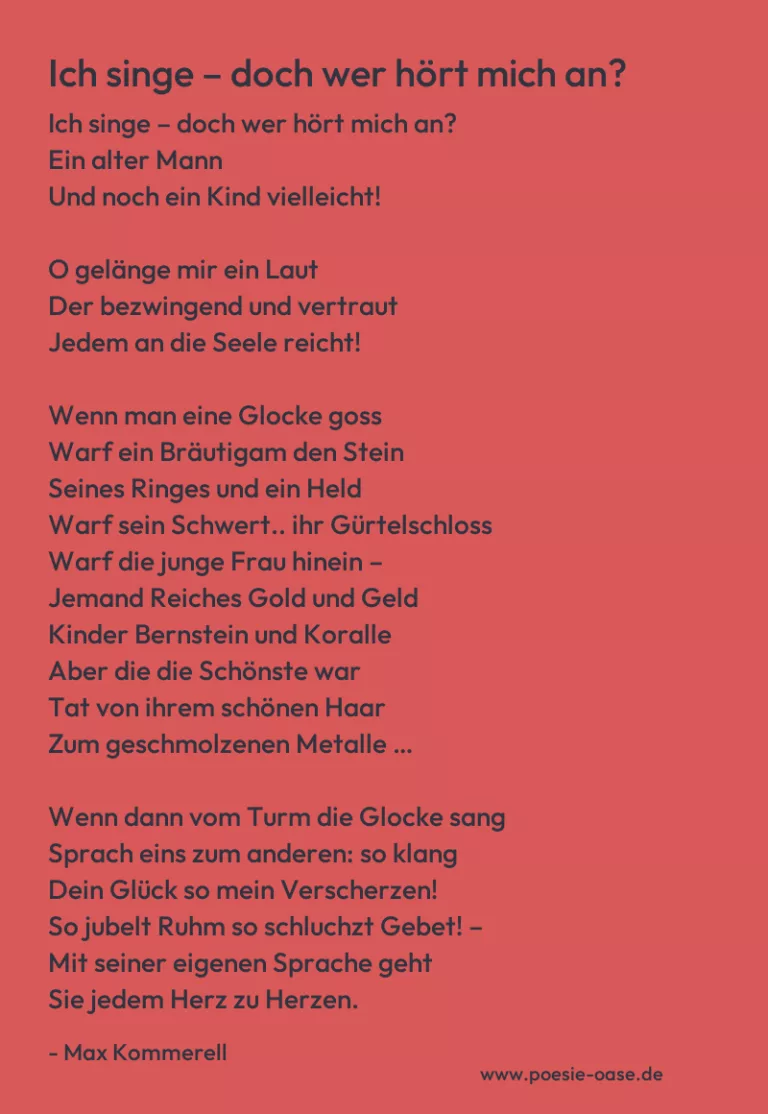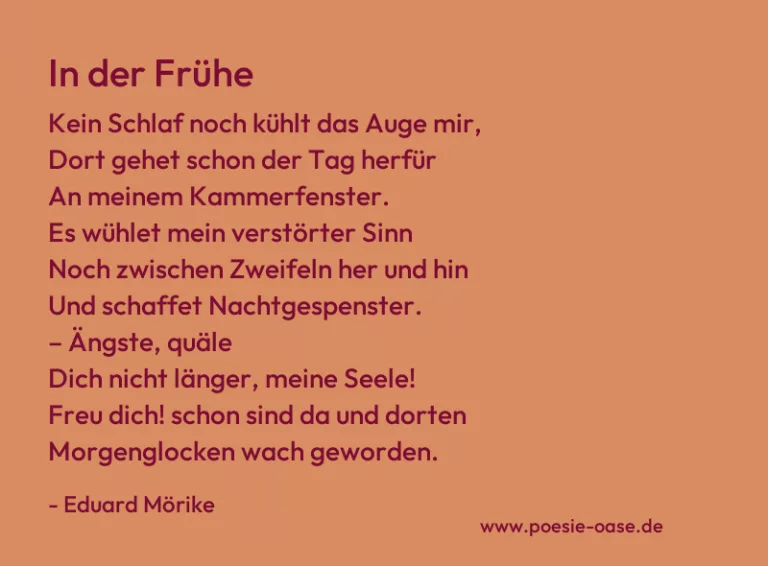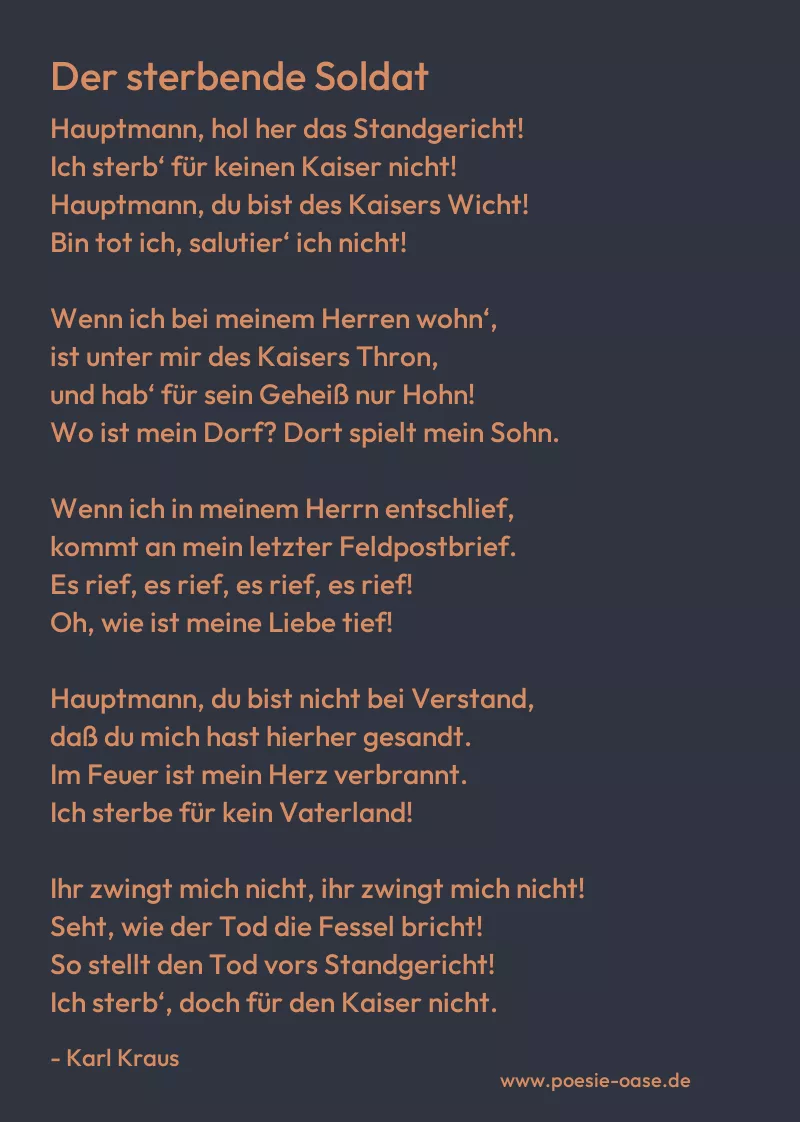Der sterbende Soldat
Hauptmann, hol her das Standgericht!
Ich sterb‘ für keinen Kaiser nicht!
Hauptmann, du bist des Kaisers Wicht!
Bin tot ich, salutier‘ ich nicht!
Wenn ich bei meinem Herren wohn‘,
ist unter mir des Kaisers Thron,
und hab‘ für sein Geheiß nur Hohn!
Wo ist mein Dorf? Dort spielt mein Sohn.
Wenn ich in meinem Herrn entschlief,
kommt an mein letzter Feldpostbrief.
Es rief, es rief, es rief, es rief!
Oh, wie ist meine Liebe tief!
Hauptmann, du bist nicht bei Verstand,
daß du mich hast hierher gesandt.
Im Feuer ist mein Herz verbrannt.
Ich sterbe für kein Vaterland!
Ihr zwingt mich nicht, ihr zwingt mich nicht!
Seht, wie der Tod die Fessel bricht!
So stellt den Tod vors Standgericht!
Ich sterb‘, doch für den Kaiser nicht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
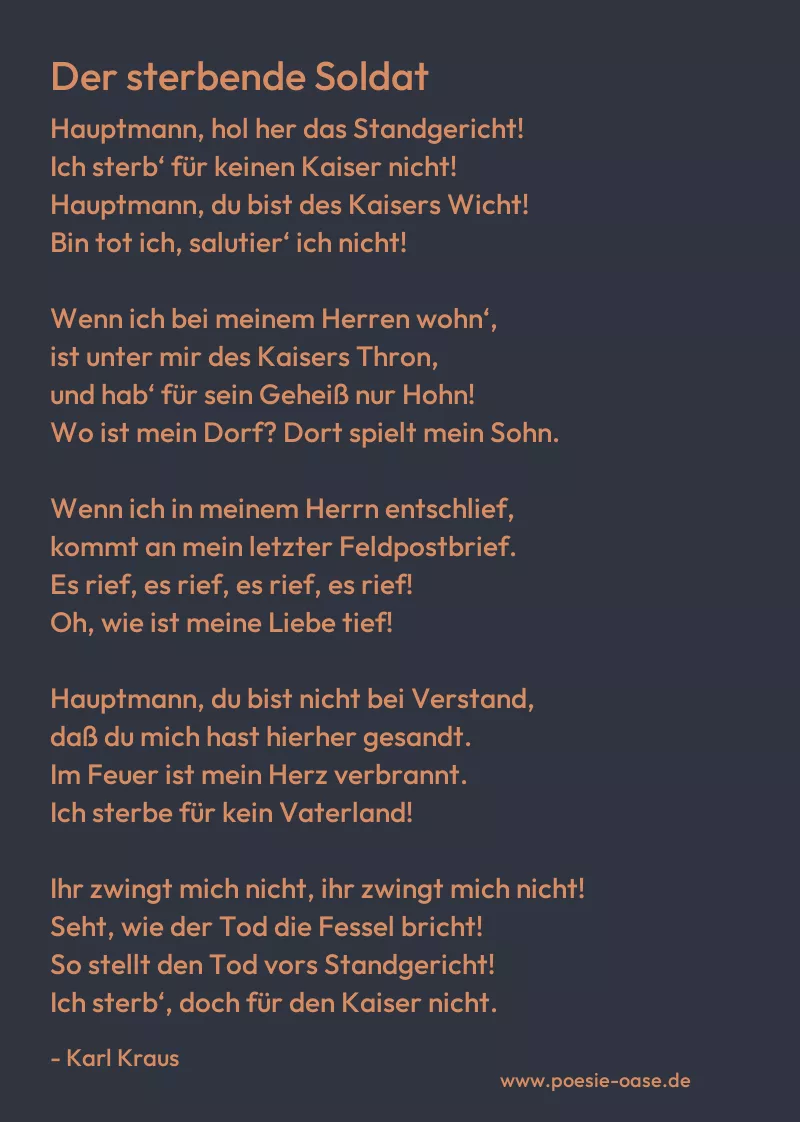
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der sterbende Soldat“ von Karl Kraus ist ein kraftvolles und emotional aufgeladenes Werk, das die Verzweiflung und den Widerstand eines Soldaten gegen die autoritäre Struktur und die Kriegsmaschinerie seiner Zeit zum Ausdruck bringt. Der Soldat, der sich im Sterben befindet, spricht direkt zum „Hauptmann“ und lehnt den Kaiser und das Vaterland ab, für das er kämpfen soll. Durch die Worte „Ich sterb‘ für keinen Kaiser nicht!“ macht der Soldat unmissverständlich klar, dass er seine Loyalität nicht dem Kaiser und der nationalen Macht schuldet, sondern vielmehr einem persönlichen, inneren Empfinden von Gerechtigkeit und Würde.
In der zweiten Strophe wird die Entfremdung des Soldaten von der politischen Autorität noch weiter betont. Der Soldat erkennt die Hierarchie und den Machtanspruch des Kaisers als hohl und verachtenswert. Die Vorstellung, dass unter ihm der „Thron des Kaisers“ ist, wird zu einem ironischen Bild, das den Kaiser und seine Macht als etwas Groteskes darstellt, das der Soldat nicht anerkennen kann. Der Gedanke an das eigene „Dorf“, an den „Sohn“, den er dort zurücklässt, kontrastiert stark mit der kalten und abstrakten Autorität des Krieges und des Kaisers. Der Soldat ist in seinen letzten Gedanken und Worten von der Liebe zu seiner Familie und seiner Heimat durchzogen, was seine Ablehnung des Krieges und der militärischen Ordnung noch deutlicher macht.
Der dritte Abschnitt vertieft den inneren Konflikt des Soldaten, der von der militärischen Autorität nicht nur körperlich, sondern auch geistig und emotional gefangen gehalten wird. „Im Feuer ist mein Herz verbrannt“ deutet auf die quälende Erfahrung des Soldaten im Krieg hin, der durch den Schmerz des Feuers – sowohl im physischen als auch im metaphorischen Sinne – gebrochen wurde. Der Soldat ist von seinem eigenen Gefühl der Entfremdung und dem Verlust des persönlichen Sinns seines Handelns geplagt. „Ich sterbe für kein Vaterland!“ ist der endgültige Ausdruck seines Widerstands und seines Unwillens, für eine Sache zu sterben, die er als ungerecht und sinnlos empfindet.
In der letzten Strophe ruft der Soldat, dass er „nicht gezwungen“ wird, was seine Überzeugung unterstreicht, dass der Tod ihm letztlich die Freiheit gibt. „Der Tod die Fessel bricht“ ist eine kraftvolle Metapher, die den Tod als Erlösung und Befreiung von den Ketten der militärischen Disziplin und dem blinden Gehorsam gegenüber der autoritären Macht darstellt. Der Soldat fordert das „Standgericht“ auf, ihn zu richten, weil er für seine Überzeugungen gestorben ist, nicht jedoch für den Kaiser oder das Vaterland. Der Tod wird hier als ein Akt der Selbstbestimmung und des Widerstands gegen die ungerechte Ordnung verstanden.
Das Gedicht spricht die Verzweiflung, den Widerstand und die Sehnsucht nach Freiheit in einem Kriegszusammenhang an. Kraus stellt den Soldaten als Individuum dar, dessen Tod nicht der Kriegsmaschinerie geopfert wird, sondern als eine letzte Geste des Widerstands gegen die erdrückende Machtstruktur, die ihn dazu zwingt, für eine Sache zu kämpfen, die er nicht als gerecht ansieht. Es ist eine scharfe Kritik an den Kriegsherren und eine Klage über die Entfremdung des Menschen in Zeiten des Krieges.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.