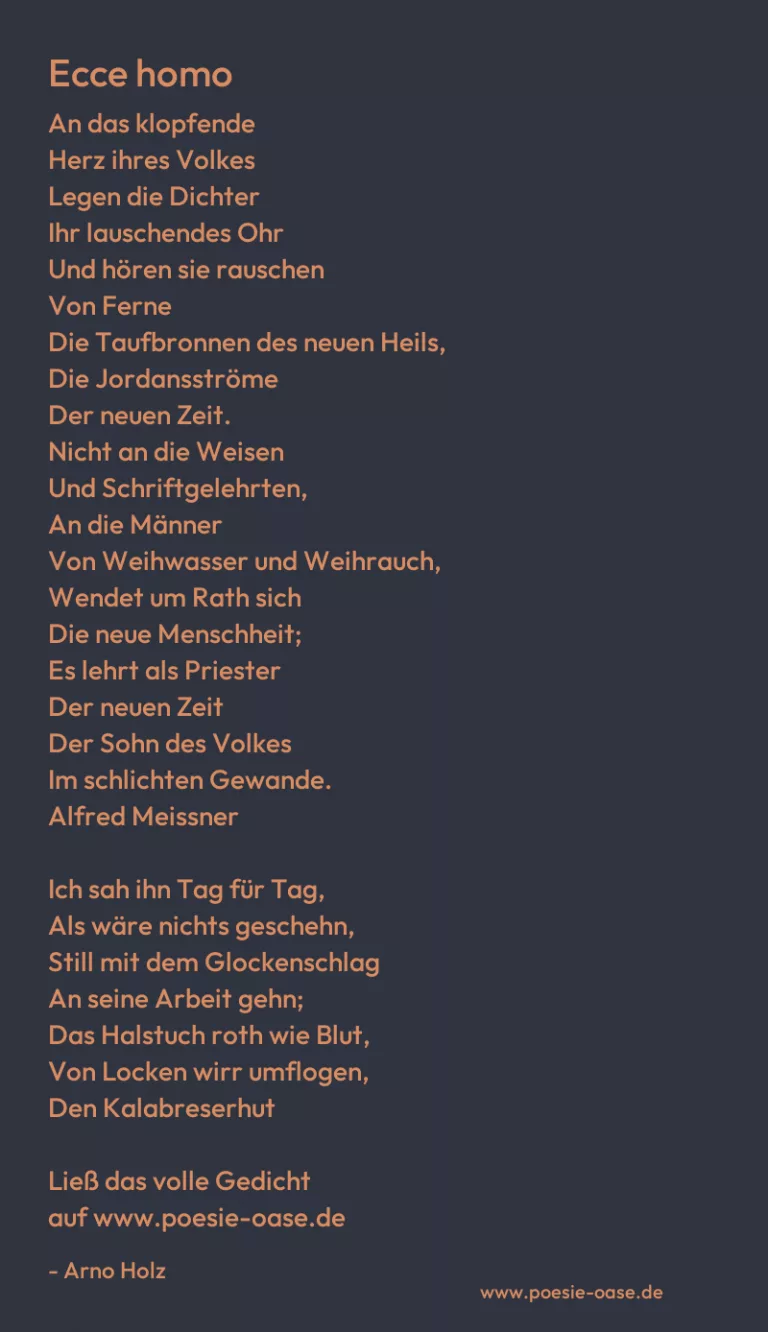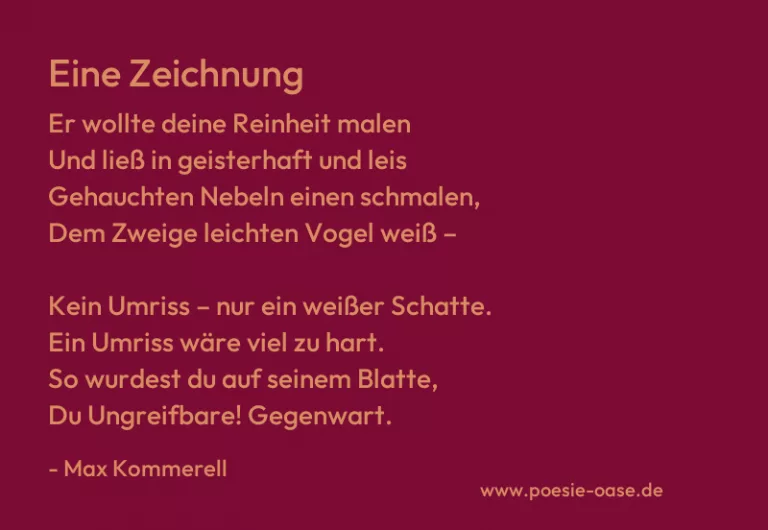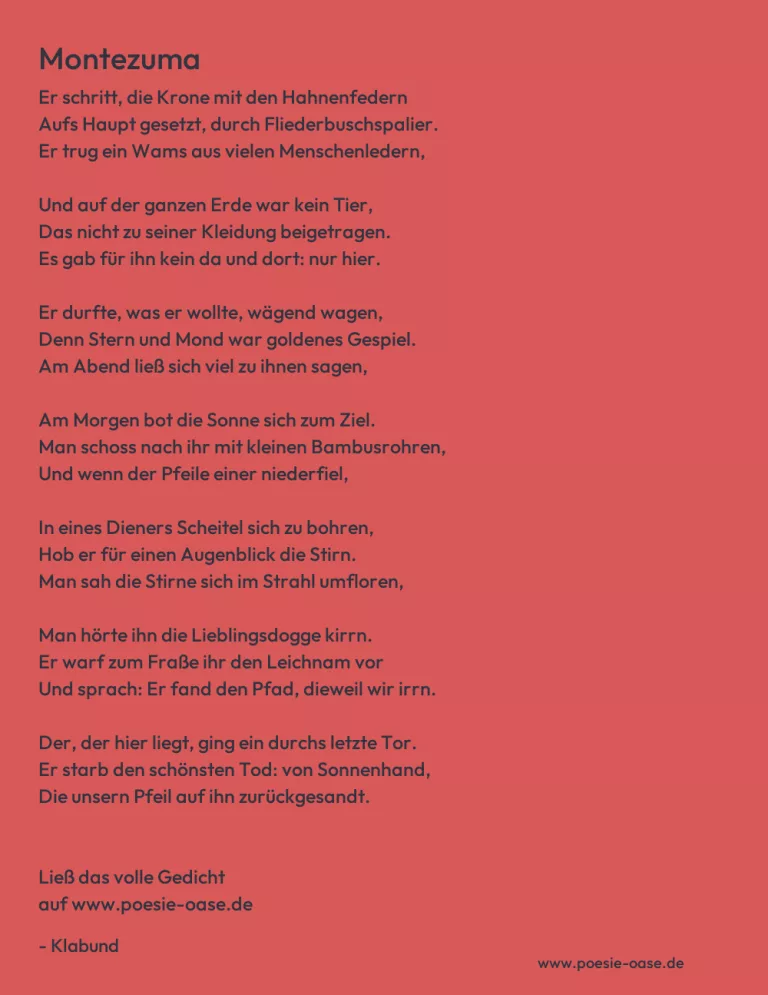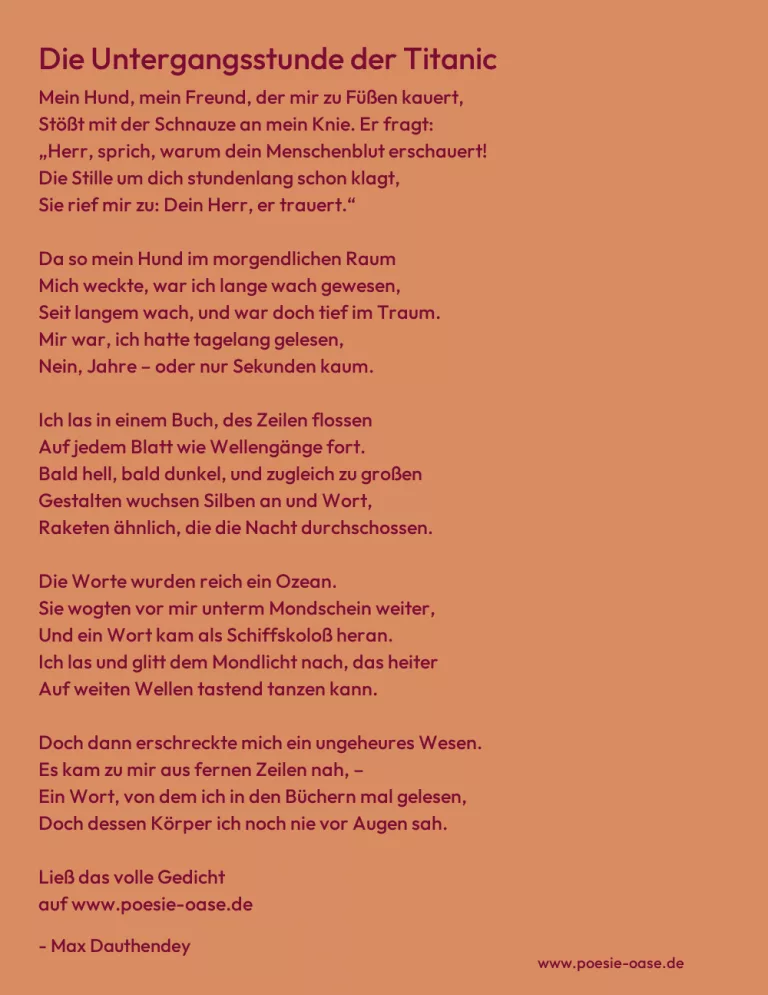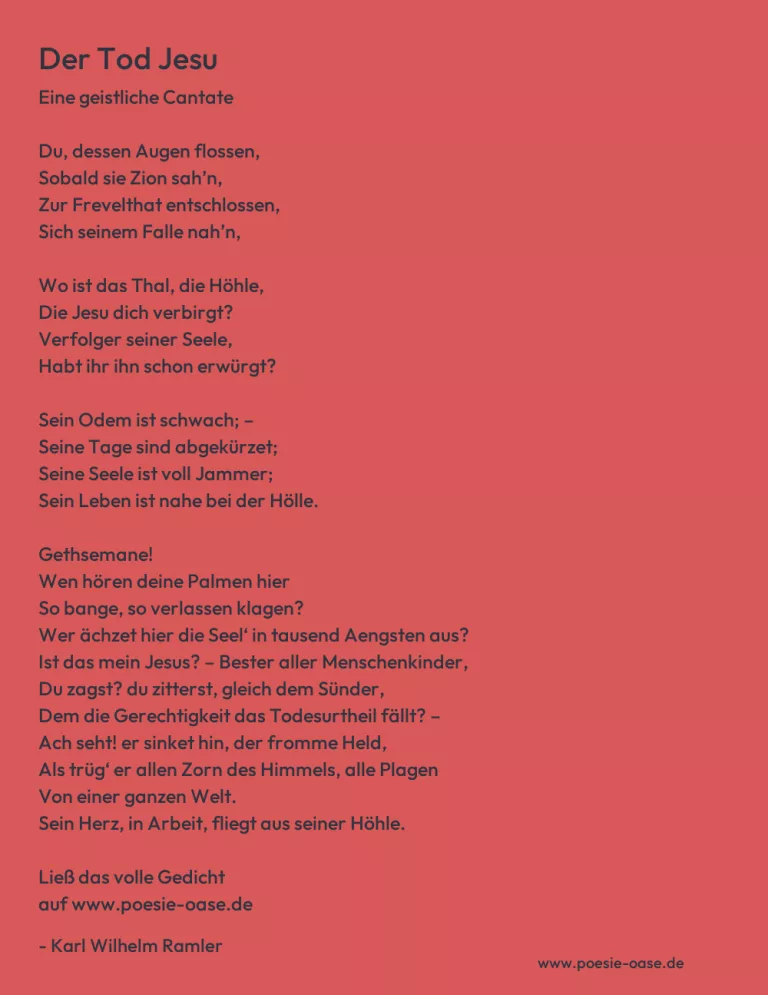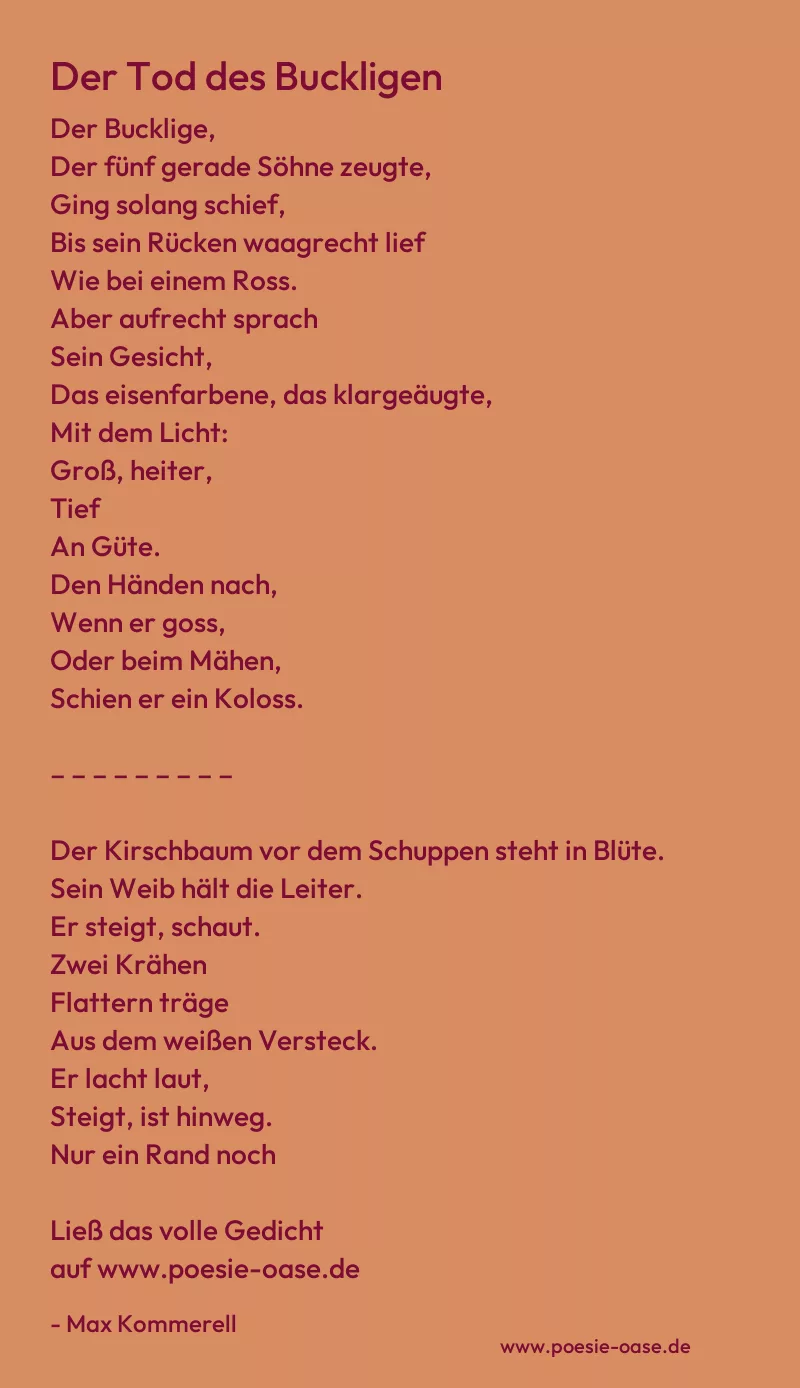Der Tod des Buckligen
Der Bucklige,
Der fünf gerade Söhne zeugte,
Ging solang schief,
Bis sein Rücken waagrecht lief
Wie bei einem Ross.
Aber aufrecht sprach
Sein Gesicht,
Das eisenfarbene, das klargeäugte,
Mit dem Licht:
Groß, heiter,
Tief
An Güte.
Den Händen nach,
Wenn er goss,
Oder beim Mähen,
Schien er ein Koloss.
– – – – – – – – –
Der Kirschbaum vor dem Schuppen steht in Blüte.
Sein Weib hält die Leiter.
Er steigt, schaut.
Zwei Krähen
Flattern träge
Aus dem weißen Versteck.
Er lacht laut,
Steigt, ist hinweg.
Nur ein Rand noch
Vom Holzschuh, nur die Hand noch
Mit der Säge.
Er ist blind
Vor Weißem.
Blüten, mehr Blüten neigen
Sich über ihn im Takt
Wehenden Geruchs
Und mit dem Hauch
Von etwas Schnellem, Heißem,
Küssen ihn, haben
Nie genug.
Er ist ein Knabe, schön, nackt.
Andere, auch schöne, auch nackte Knaben
Werfen sich im Flug
(Er sieht das zwischen Zweigen)
Aus blauem Wind in blauen Wind.
„Siehe, so!
Versuch’s!“
„Jetzt – Ich – Auch –
Oh!…“
Sie denkt: „Spricht er eigen!“
Sie ruft. Ein Fall. Im Liegen
Lächelt er,
Als würf‘ er eine Last ab.
„Keine Leiter mehr!
Ich kann fliegen.
Säge wer
Anderes den Ast ab!“
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
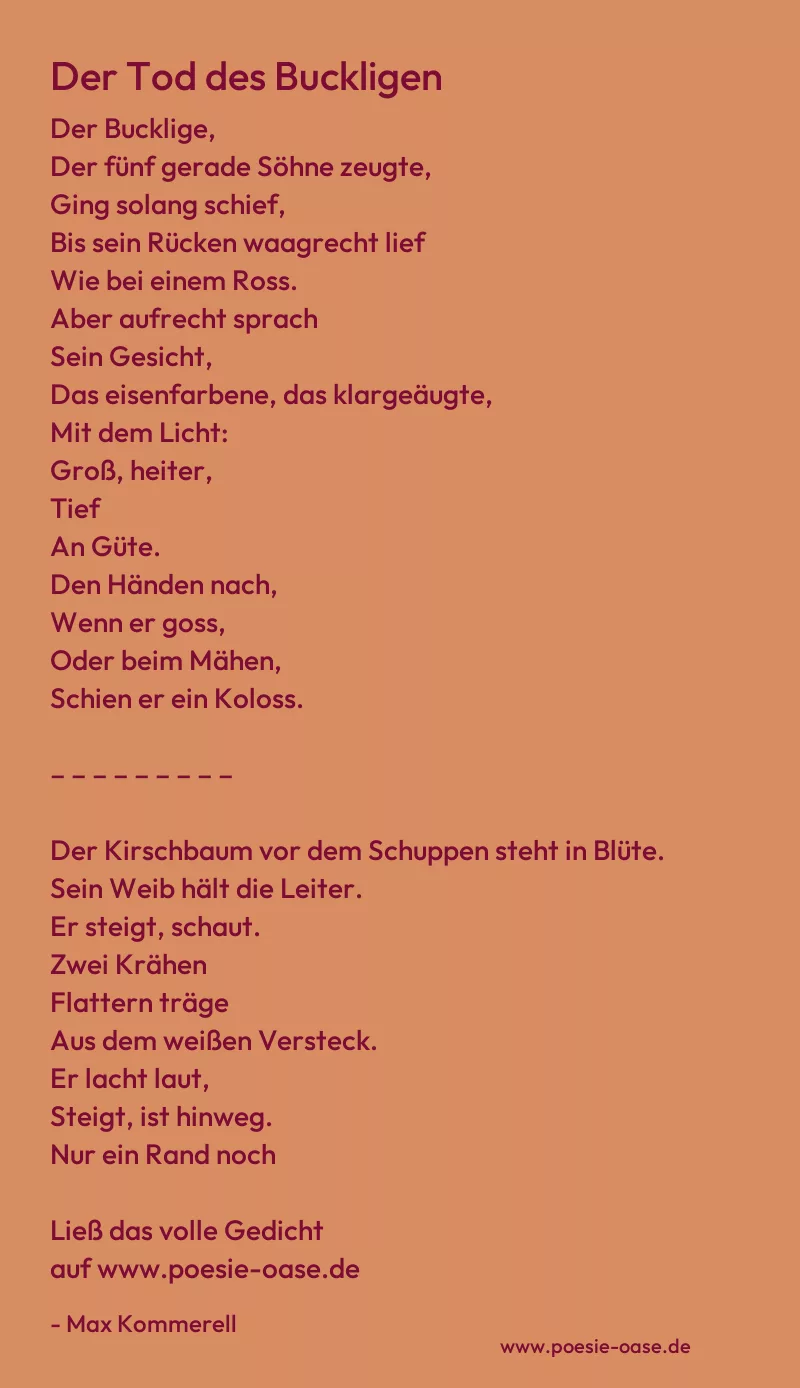
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Tod des Buckligen“ von Max Kommerell beschreibt in zwei kontrastierenden Teilen das Leben und Sterben eines körperlich gezeichneten Mannes, dessen Inneres jedoch von Kraft, Güte und Schönheit geprägt ist. In einer poetisch verdichteten Bildsprache wird ein scheinbar gewöhnlicher Mensch zur mythisch aufgeladenen Figur, dessen Tod zugleich als Verklärung, Erlösung und Transformation erscheint.
Im ersten Teil wird der Bucklige in seiner irdischen Gestalt gezeigt: körperlich deformiert, aber stark, lebensfähig und von großer innerer Schönheit. Trotz seines „waagrechten“ Rückens, der an ein Arbeitstier erinnert, strahlt sein „eisenfarbenes, klargeäugtes“ Gesicht Würde, Güte und Heiterkeit aus. Diese Diskrepanz zwischen äußerer Erscheinung und innerem Wesen wird betont durch die Darstellung seiner körperlichen Arbeit – etwa beim Gießen oder Mähen –, in der er wie ein „Koloss“ erscheint. Der Bucklige wird zum Sinnbild einer stillen, fast heroischen Lebensleistung.
Der zweite Teil des Gedichts setzt abrupt ein mit dem Bild des Frühlings: ein blühender Kirschbaum, helles Licht, Natur in Aufbruch. Diese Szene bildet den Rahmen für den Tod des Buckligen, der fast märchenhaft verklärt wird. Beim Schneiden eines Astes verliert er den Halt und stürzt. Doch der Sturz wird nicht als tragisches Ende, sondern als Übergang in eine andere Daseinsform inszeniert. In einem ekstatischen Moment wird er selbst zum „Knaben, schön, nackt“, sieht andere Knaben fliegen, badet in Licht und Duft. Der Tod erscheint hier als eine Befreiung – vom Körper, von der Last des Irdischen.
Besonders eindrücklich ist die Verbindung zwischen Natur und Transzendenz. Die Blüten umhüllen den Buckligen wie eine liebevolle Macht, fast erotisch, fast mystisch. Der Tod wird nicht als dunkles Ende gefasst, sondern als Rückkehr zu einem ursprünglichen, reinen Zustand. Die letzten Worte des Mannes – „Ich kann fliegen“ – stellen eine triumphale Selbstbehauptung dar. Die Leiter, die für die Begrenzung der Welt steht, wird überflüssig, ebenso wie das Werkzeug der Trennung – die Säge.
Kommerell gelingt mit diesem Gedicht ein vielschichtiges Bild vom Tod als Moment der Verklärung. Der Bucklige, der im Leben durch seinen Körper gebunden war, findet im Sterben eine neue Freiheit. Sein letzter Blick ist nicht von Angst, sondern von Lächeln und Leichtigkeit geprägt. Das Gedicht verwebt Motive von Arbeit, Natur, Transzendenz und Schönheit zu einer elegischen Vision des Todes, in der das Irdische in das Überirdische übergeht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.