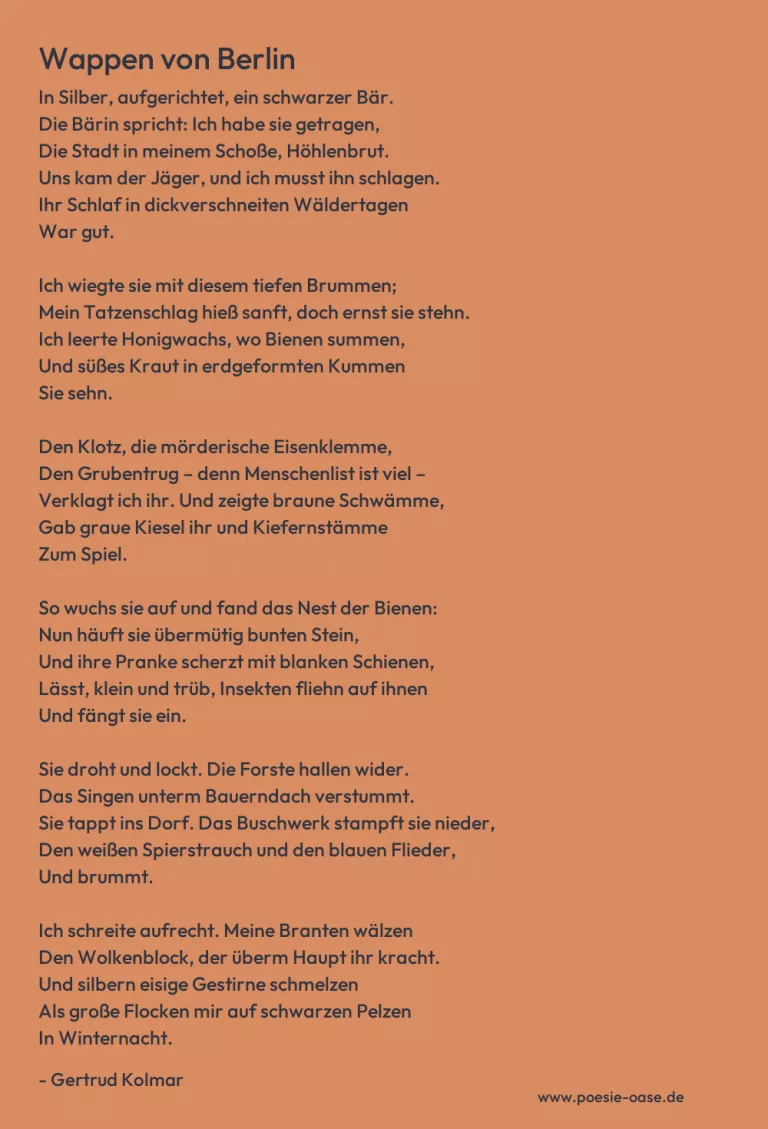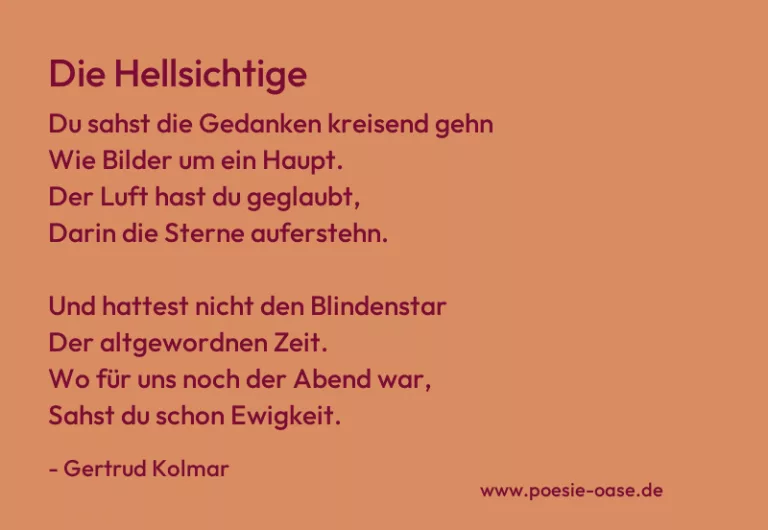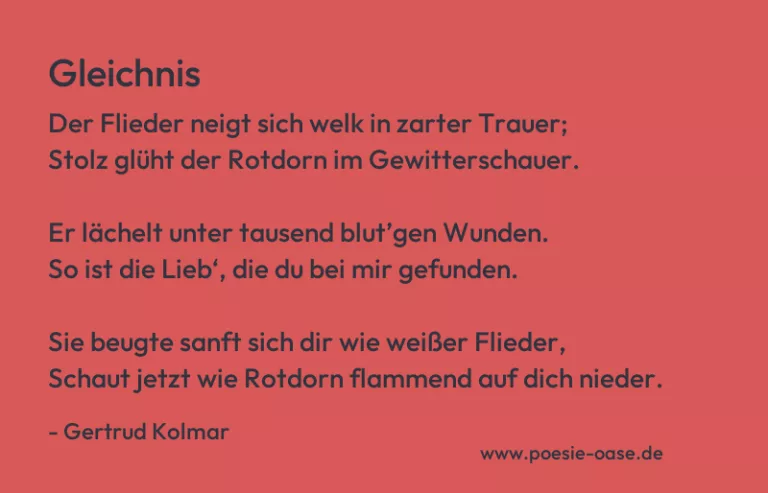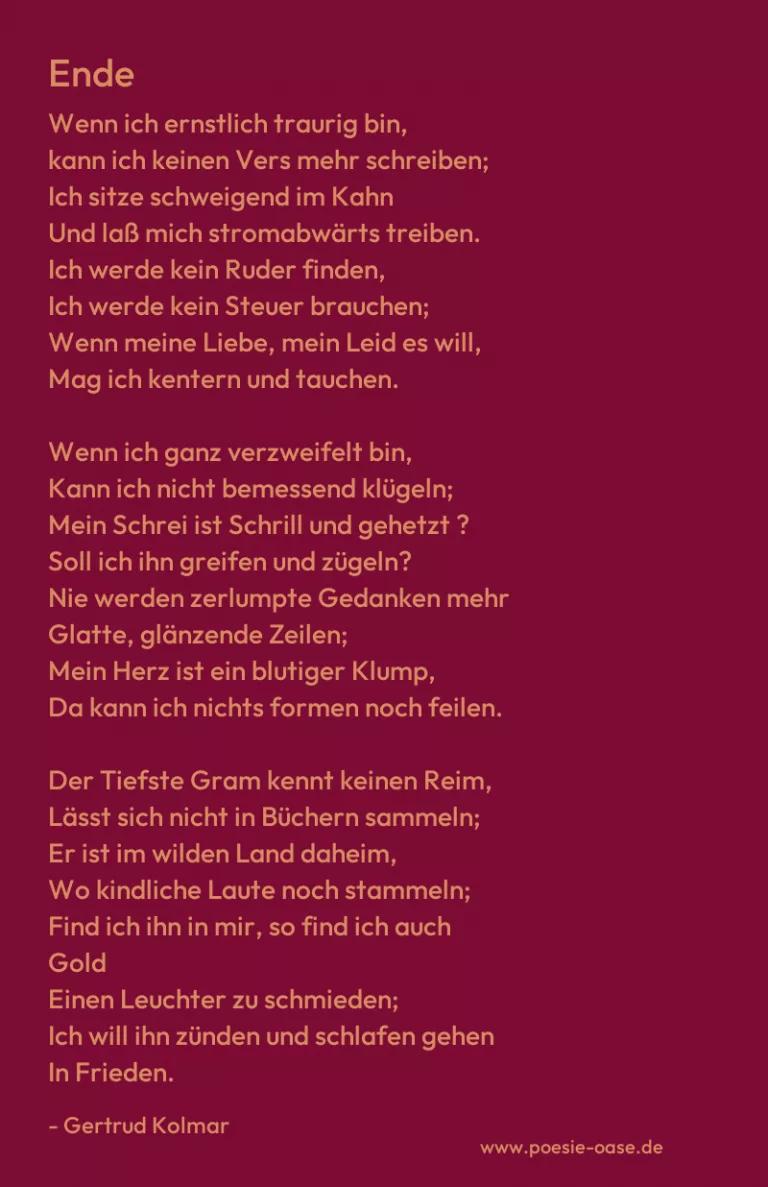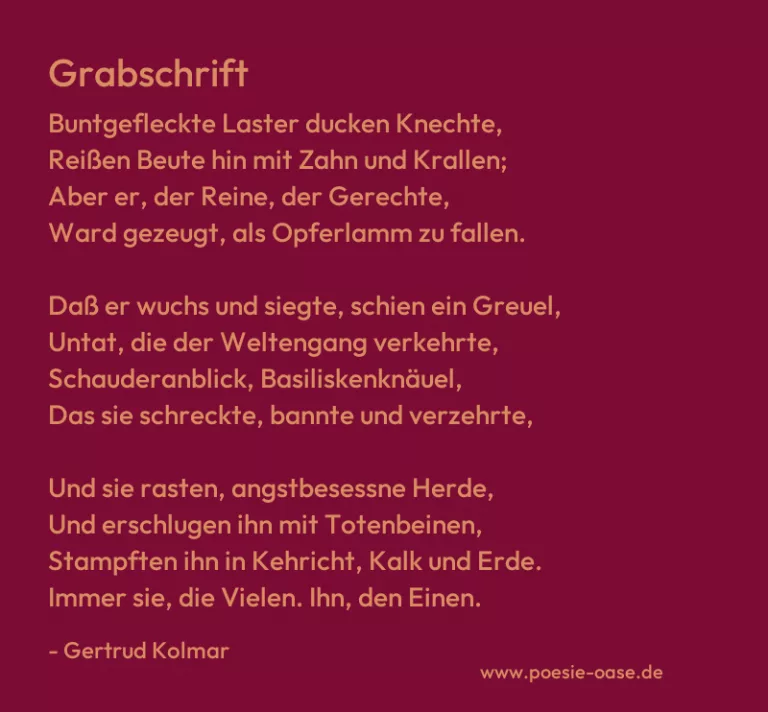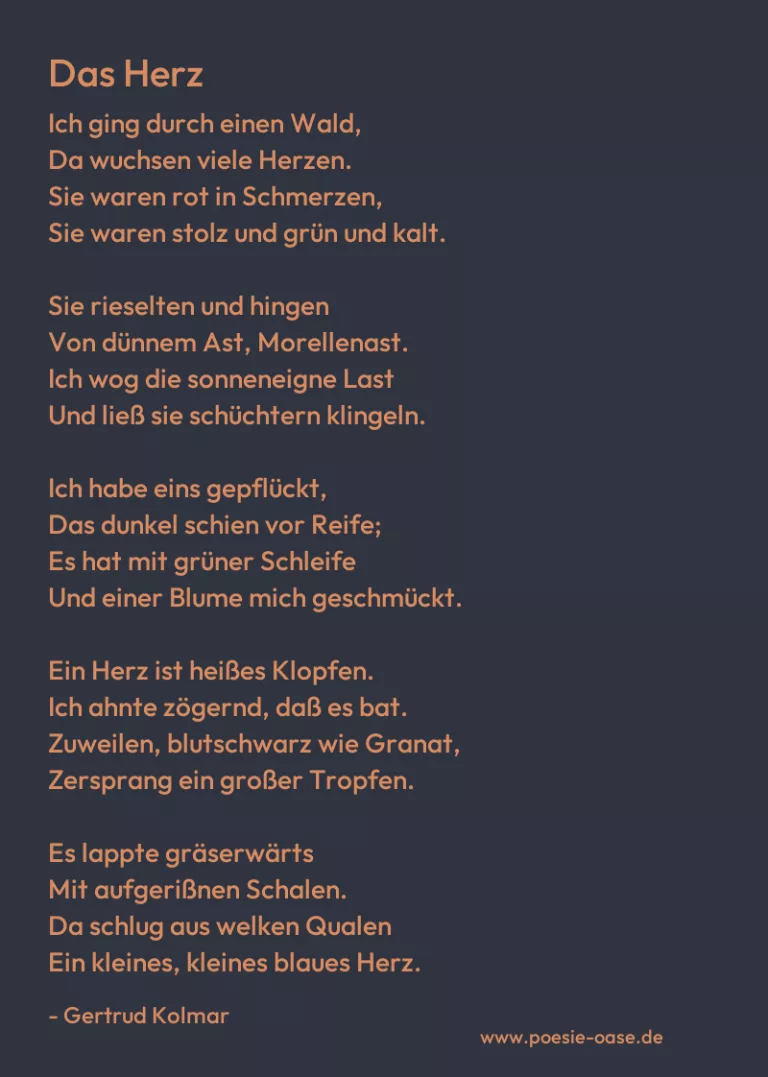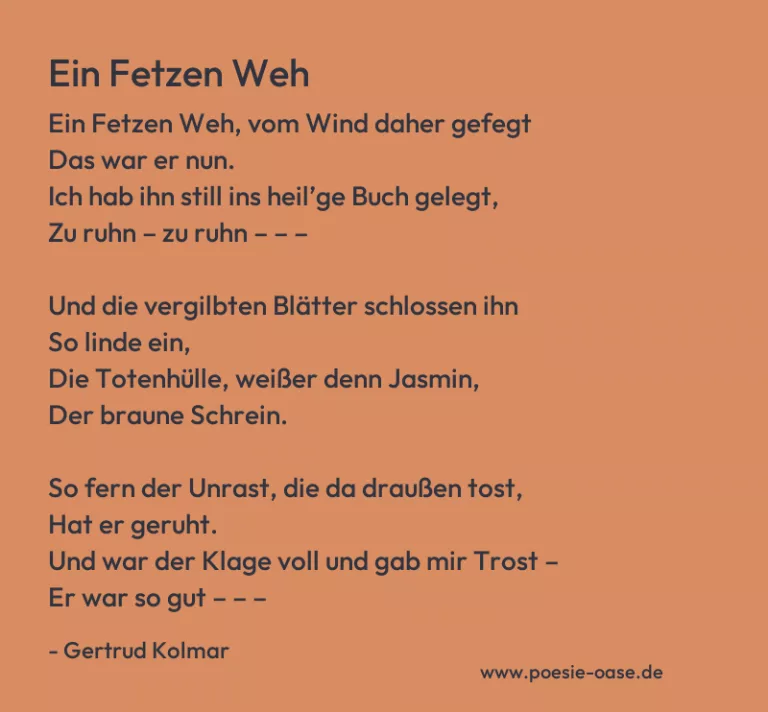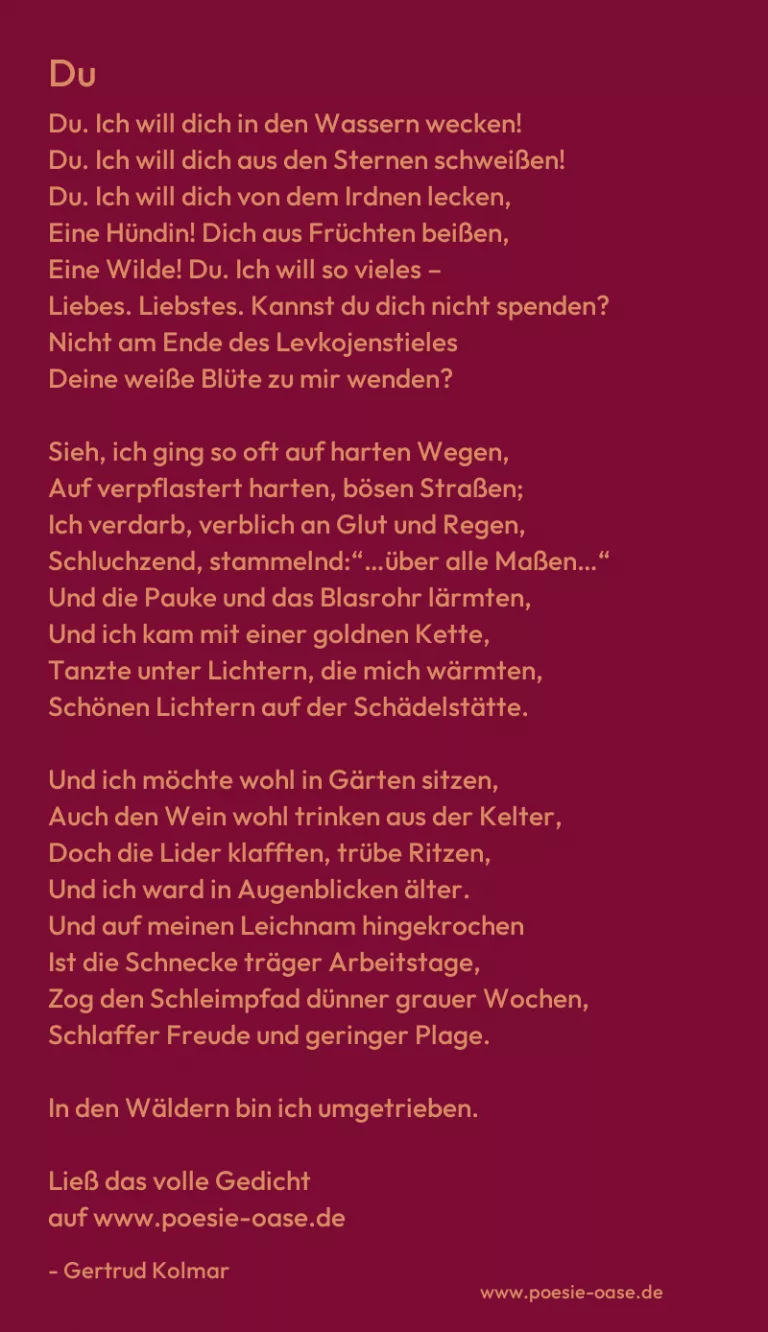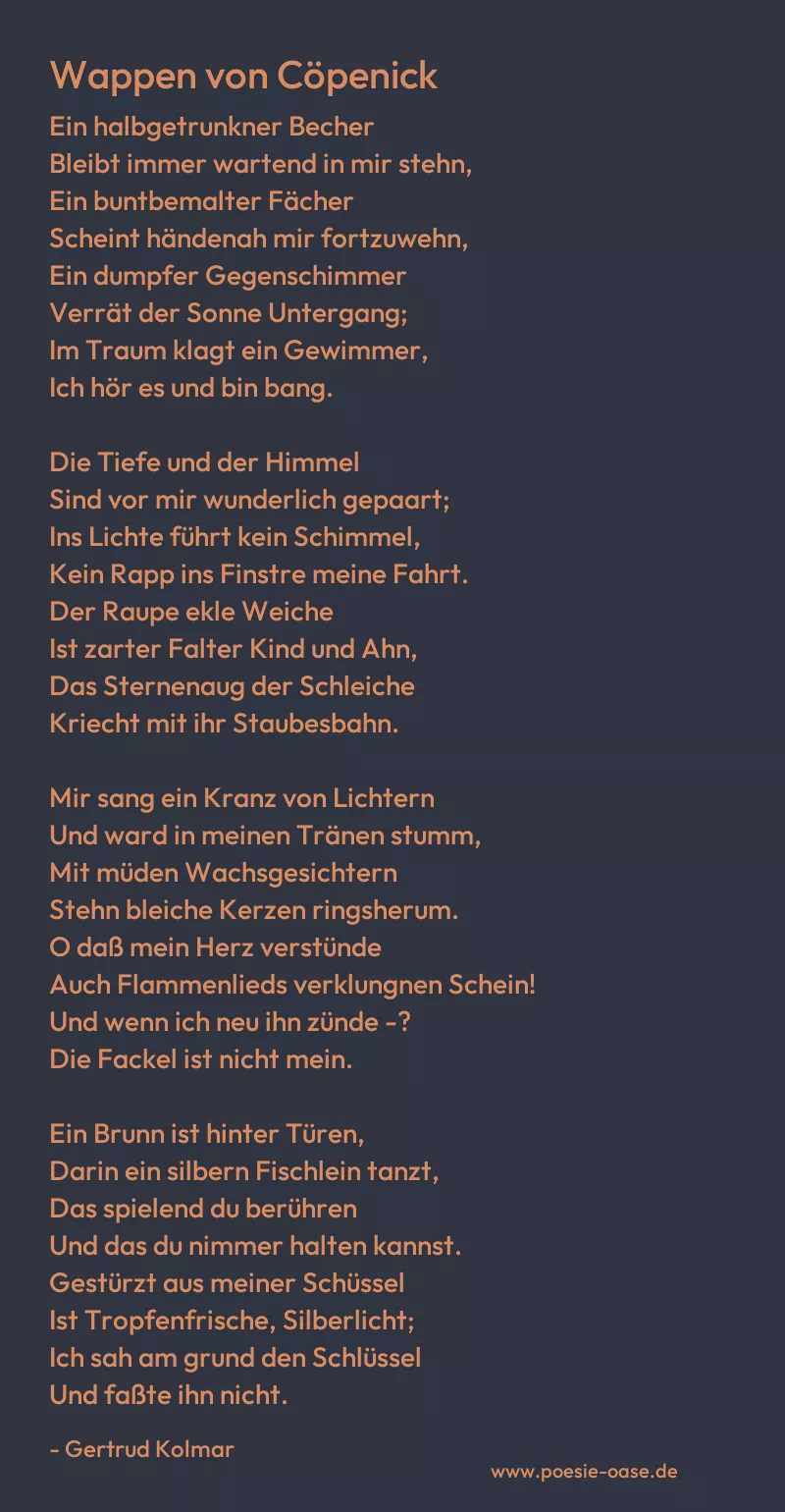Wappen von Cöpenick
Ein halbgetrunkner Becher
Bleibt immer wartend in mir stehn,
Ein buntbemalter Fächer
Scheint händenah mir fortzuwehn,
Ein dumpfer Gegenschimmer
Verrät der Sonne Untergang;
Im Traum klagt ein Gewimmer,
Ich hör es und bin bang.
Die Tiefe und der Himmel
Sind vor mir wunderlich gepaart;
Ins Lichte führt kein Schimmel,
Kein Rapp ins Finstre meine Fahrt.
Der Raupe ekle Weiche
Ist zarter Falter Kind und Ahn,
Das Sternenaug der Schleiche
Kriecht mit ihr Staubesbahn.
Mir sang ein Kranz von Lichtern
Und ward in meinen Tränen stumm,
Mit müden Wachsgesichtern
Stehn bleiche Kerzen ringsherum.
O daß mein Herz verstünde
Auch Flammenlieds verklungnen Schein!
Und wenn ich neu ihn zünde -?
Die Fackel ist nicht mein.
Ein Brunn ist hinter Türen,
Darin ein silbern Fischlein tanzt,
Das spielend du berühren
Und das du nimmer halten kannst.
Gestürzt aus meiner Schüssel
Ist Tropfenfrische, Silberlicht;
Ich sah am grund den Schlüssel
Und faßte ihn nicht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
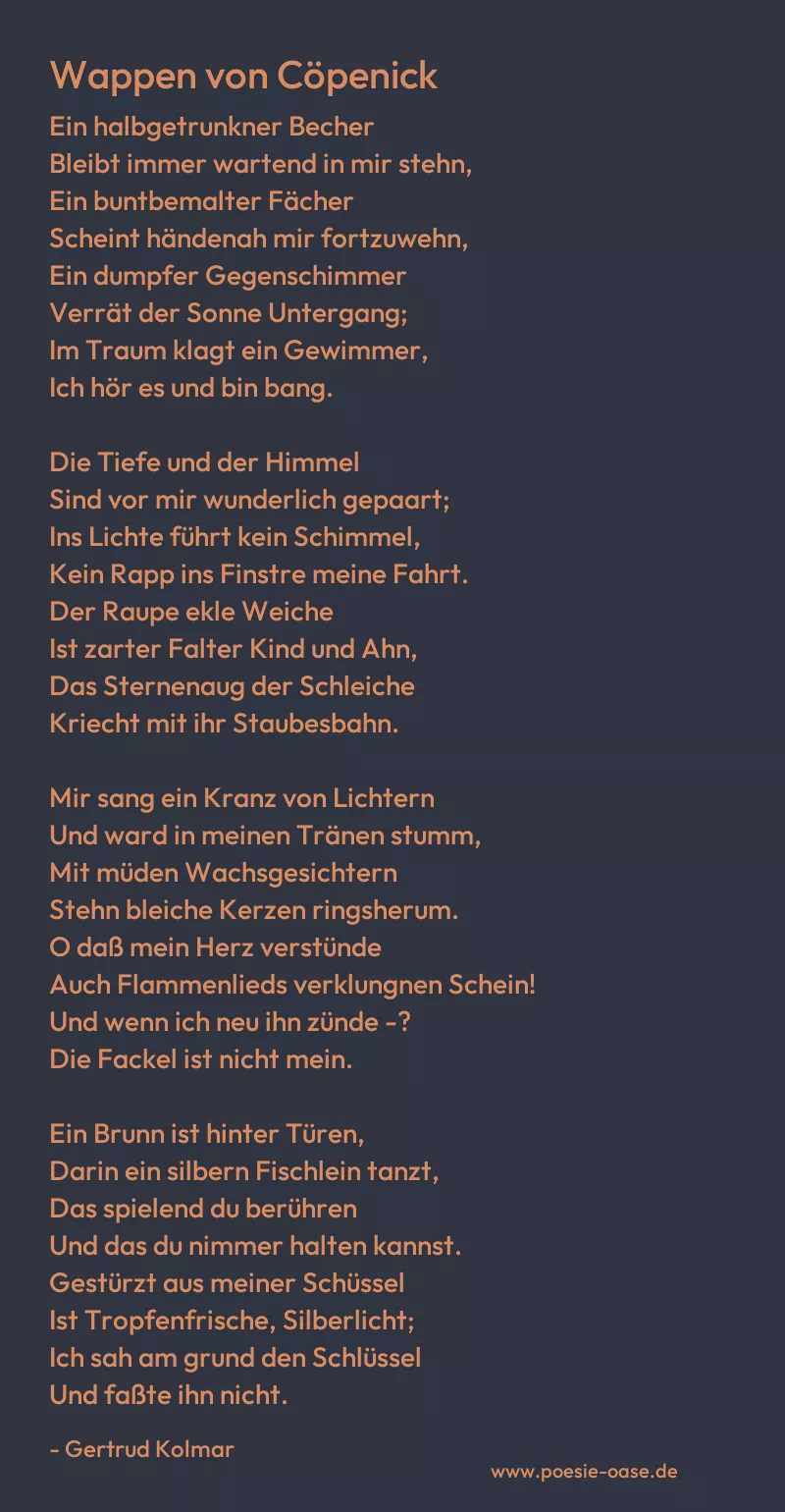
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Wappen von Cöpenick“ von Gertrud Kolmar wirkt wie eine surreale und symbolische Reflexion über unerreichbare Wünsche, das Scheitern und die ständige Suche nach etwas, das nie ganz erlangt werden kann. Die erste Strophe beschreibt ein Bild von unerfüllter Sehnsucht, in dem ein „halbgetrunkner Becher“ immer „wartend in mir stehn“ bleibt. Dieser Becher könnte als Symbol für unerreichte Ziele oder verpasste Chancen verstanden werden. Der „buntbemalte Fächer“, der „händigenah“ fortzuwindet, verstärkt das Gefühl der Vergänglichkeit und der Flüchtigkeit, während der „dumpfe Gegenschimmer“ den bevorstehenden „Untergang“ der Sonne beschreibt, was eine düstere, fast melancholische Stimmung erzeugt.
In der zweiten Strophe tauchen weitere widersprüchliche Bilder auf: Die „Tiefe und der Himmel“ sind in ihrer Kombination „wunderlich gepaart“, was auf die Spannung zwischen Gegensätzen hinweist. Der „Schimmel“, der ins Licht führen soll, und der „Rapp“, der ins Dunkle zieht, verdeutlichen die Unentschlossenheit und die Orientierungslosigkeit des lyrischen Subjekts. Das Bild der Raupe, die sich in einen „zarten Falter“ verwandelt, könnte auf die Unfähigkeit hinweisen, den Wandel oder die Transformation zu kontrollieren. Das „Sternenauge der Schleiche“, das mit der „Staubesbahn“ kriecht, verstärkt das Bild von etwas, das unaufhaltsam und doch nicht fassbar ist.
In der dritten Strophe gibt es einen dramatischen Wechsel zu einem Bild von Licht und Dunkelheit, das die Sehnsucht nach Erleuchtung und Erkenntnis widerspiegelt. Der „Kranz von Lichtern“, der den lyrischen Sprecher in seinen „Tränen“ stumm werden lässt, könnte für eine spirituelle oder emotionale Erkenntnis stehen, die jedoch nicht vollständig begreifbar ist. Die „müden Wachsgesichter“ und die „bleichen Kerzen“ symbolisieren eine erlösungslose Situation, in der der Sprecher sich in einer Art Passivität und Resignation befindet. Das „Flammenlied“, dessen „verklungnen Schein“ der Sprecher nicht versteht, könnte die Unfähigkeit darstellen, die volle Bedeutung oder das Potenzial eines Moments oder einer Erfahrung zu erfassen.
Die letzte Strophe verstärkt das Bild des Entkommens und der verwehrten Möglichkeiten. Der „Brunn“ hinter verschlossenen Türen, in dem das „silbern Fischlein tanzt“, ist ein Symbol für die Fließfähigkeit und Ungezwungenheit des Lebens, das jedoch für den Sprecher unerreichbar bleibt. Das „Spielend du berühren und das du nimmer halten kannst“ spricht von der Unmöglichkeit, das zu fassen, was gerade in den Blick geraten ist. Der „Tropfenfrische“ und das „Silberlicht“, das der Sprecher in seiner Schüssel sah, sind Symbole für verpasste Chancen oder für das Streben nach etwas, das immer nur einen Moment sichtbar ist und dann wieder entgleitet. Der „Schlüssel“ am Grund des Brunnens, den der Sprecher nicht fassen kann, verstärkt das Bild der Entfremdung und der Unmöglichkeit, die Lösung oder den Zugang zu einer tieferen Wahrheit zu erlangen.
Kolmar verwendet in „Wappen von Cöpenick“ eine Vielzahl von Symbolen, die sich um das Thema des Unerreichbaren und der unerfüllten Sehnsucht gruppieren. Das Gedicht spricht von einer tiefen inneren Zerrissenheit und dem Streben nach etwas Höherem oder Unerreichbarem, das sich stets entzieht. In seiner surrealen Bildsprache und den widersprüchlichen Motiven zeigt es die Komplexität des menschlichen Daseins, das zwischen dem Wunsch nach Erleuchtung und dem Bewusstsein von dessen Unerreichbarkeit schwankt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.