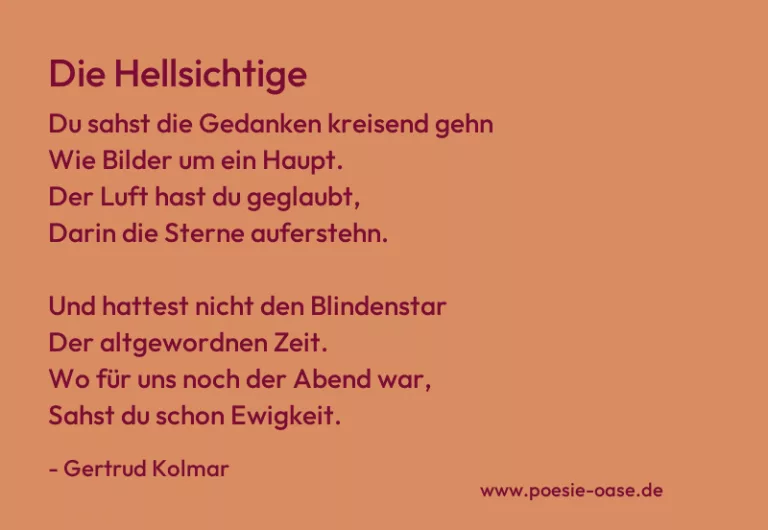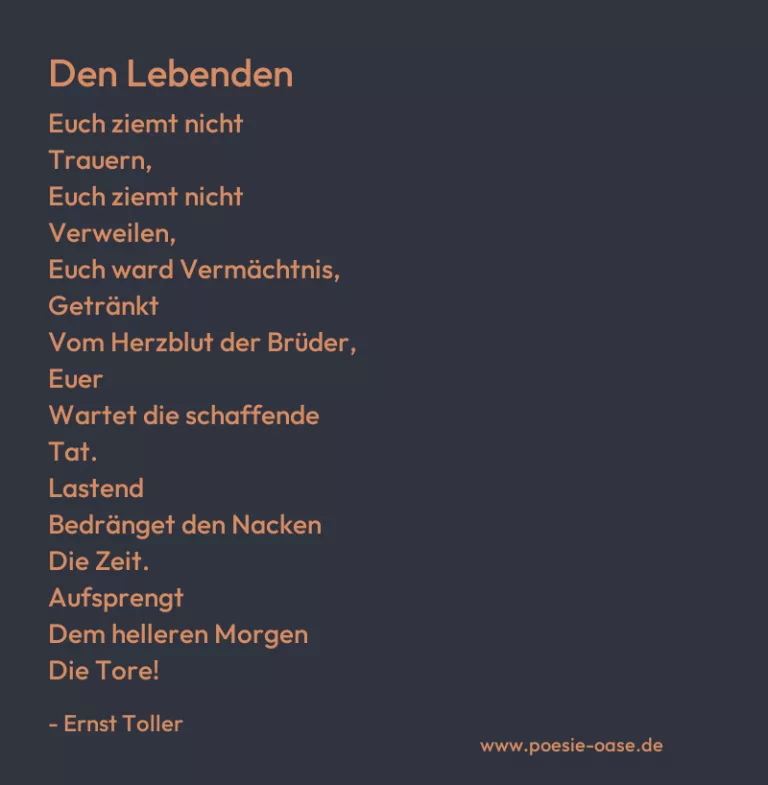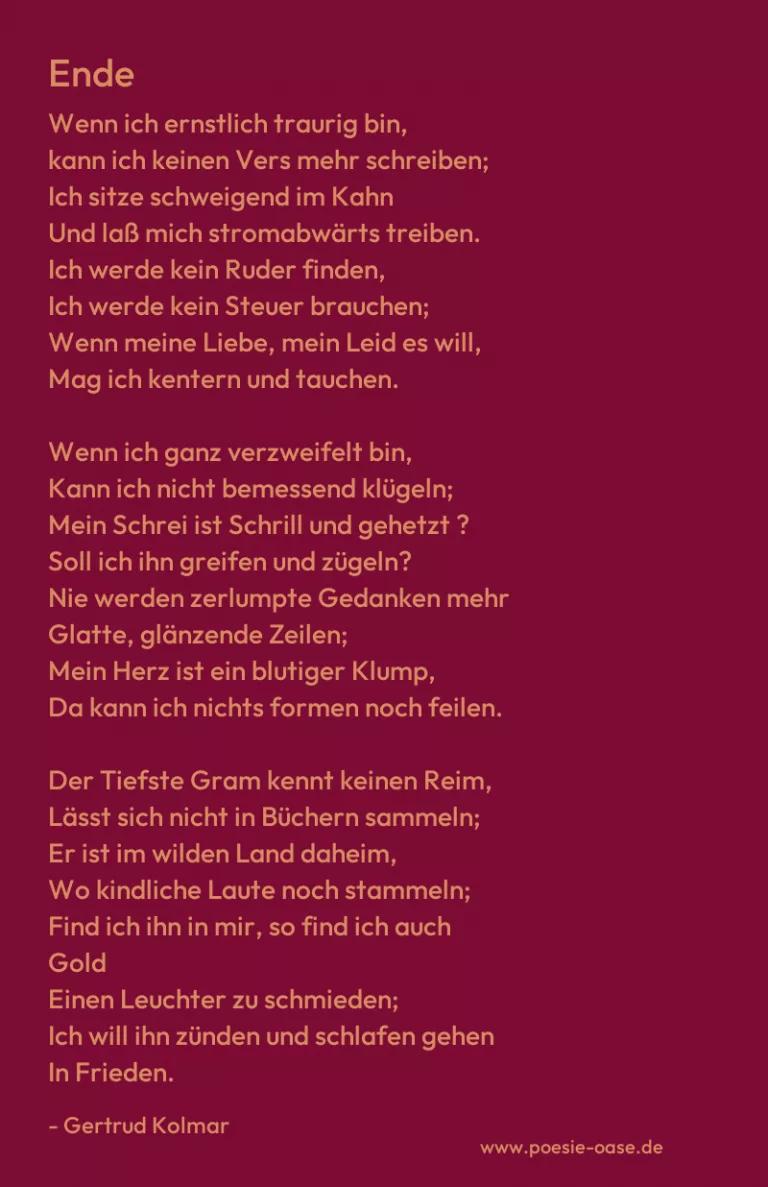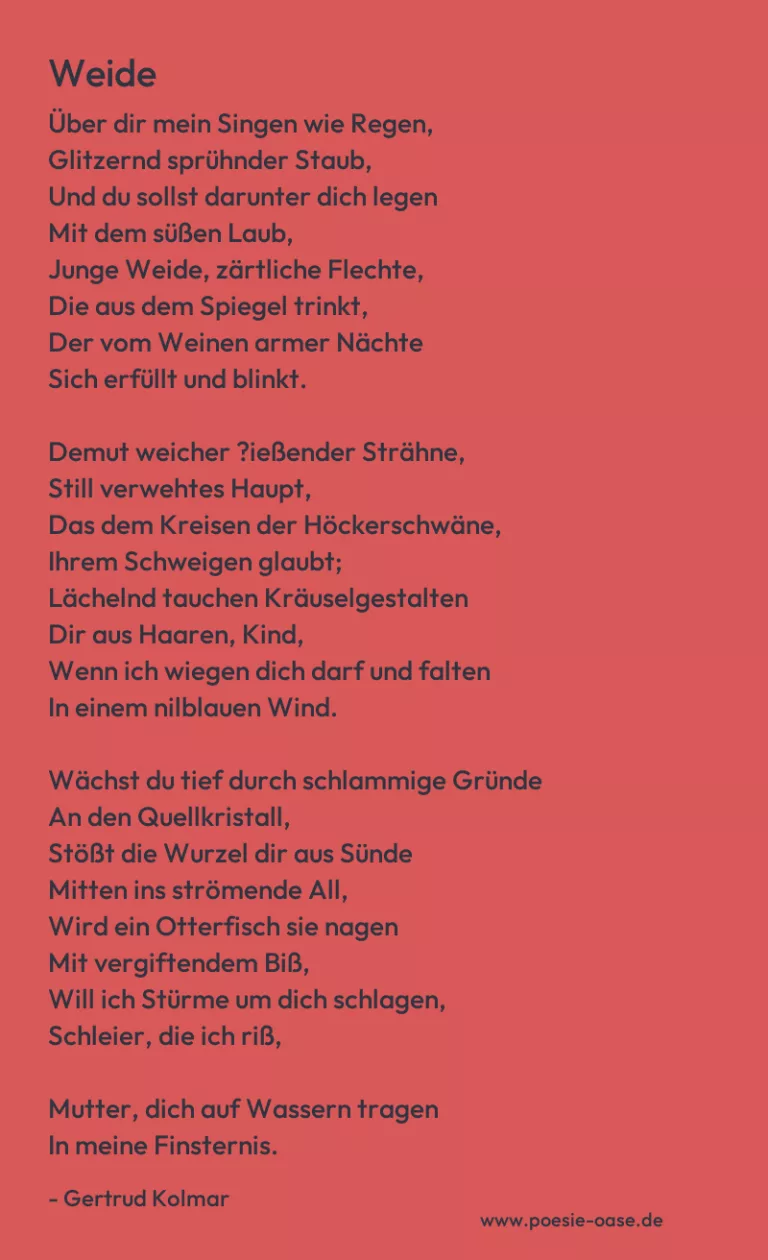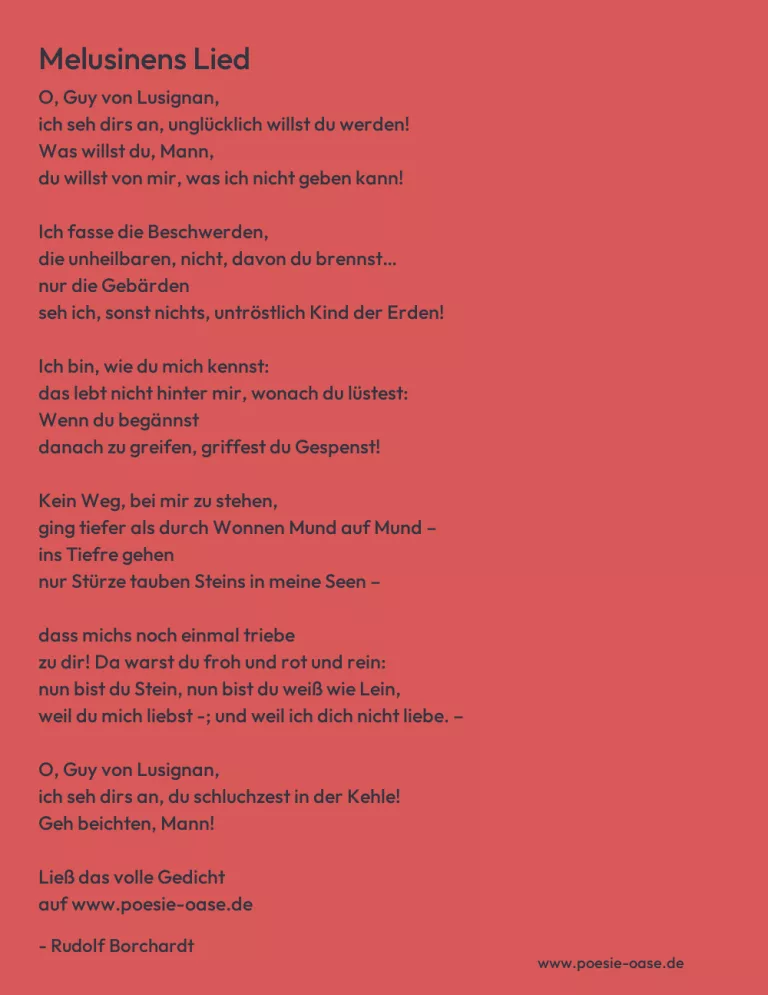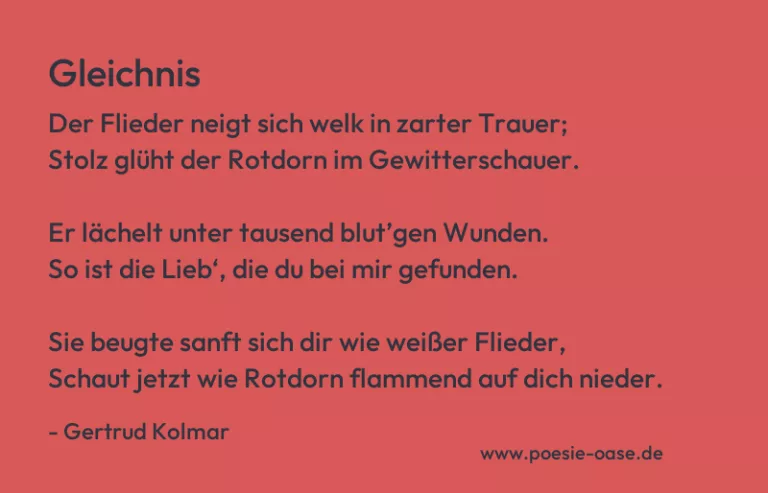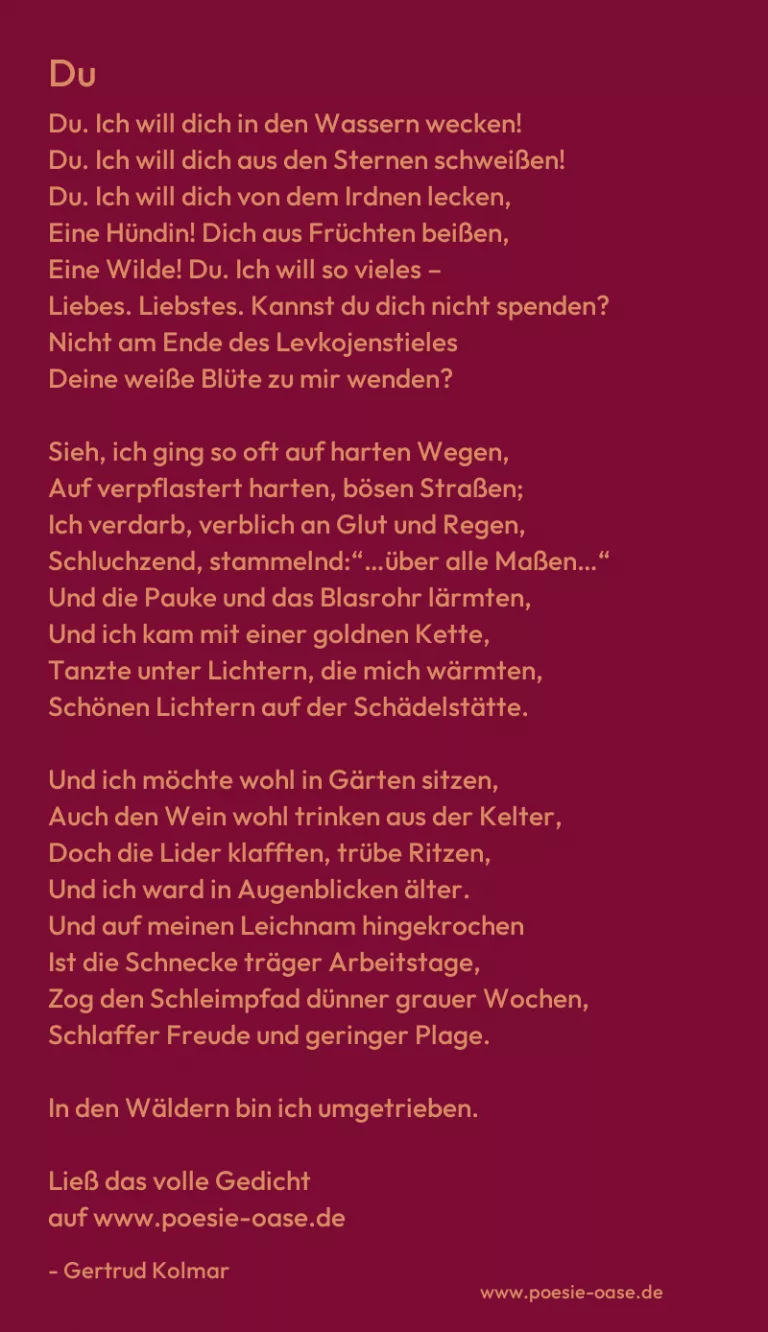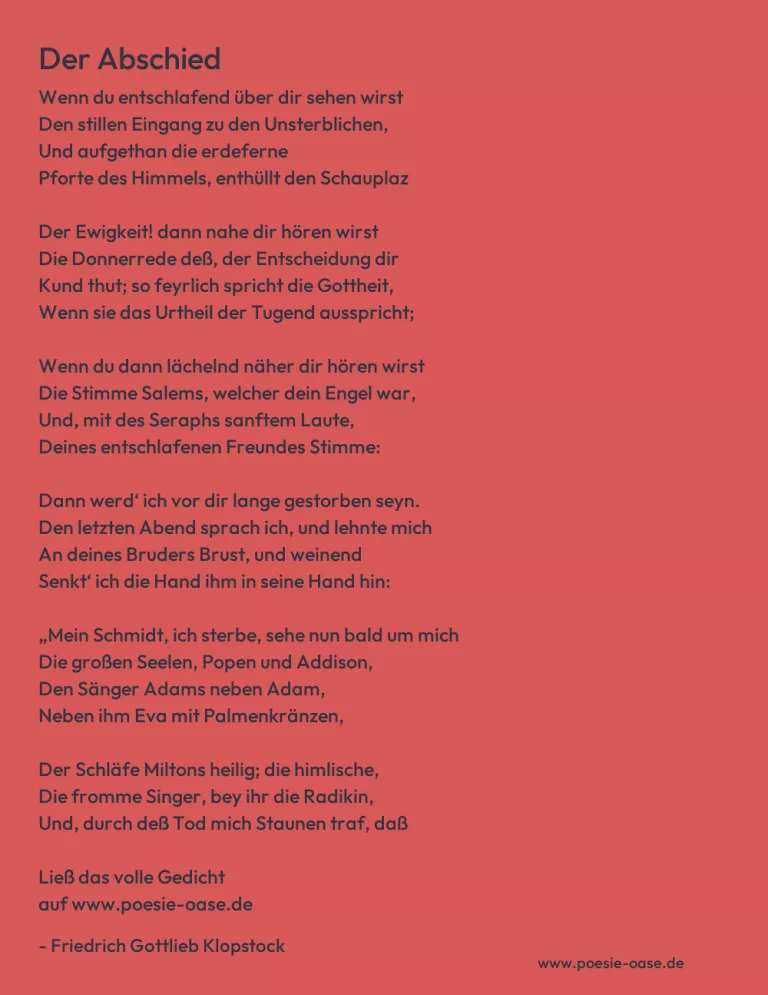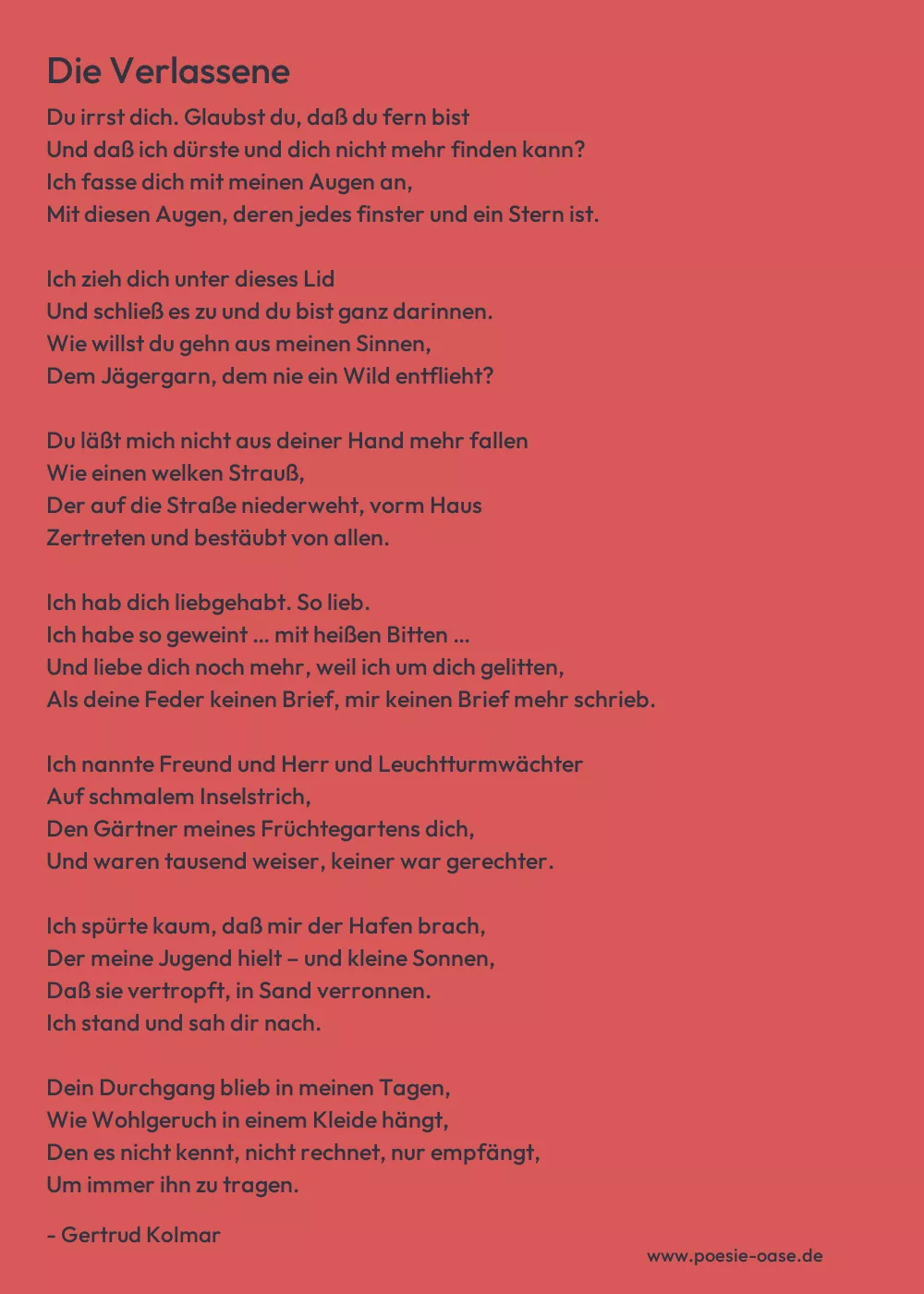Die Verlassene
Du irrst dich. Glaubst du, daß du fern bist
Und daß ich dürste und dich nicht mehr finden kann?
Ich fasse dich mit meinen Augen an,
Mit diesen Augen, deren jedes finster und ein Stern ist.
Ich zieh dich unter dieses Lid
Und schließ es zu und du bist ganz darinnen.
Wie willst du gehn aus meinen Sinnen,
Dem Jägergarn, dem nie ein Wild entflieht?
Du läßt mich nicht aus deiner Hand mehr fallen
Wie einen welken Strauß,
Der auf die Straße niederweht, vorm Haus
Zertreten und bestäubt von allen.
Ich hab dich liebgehabt. So lieb.
Ich habe so geweint … mit heißen Bitten …
Und liebe dich noch mehr, weil ich um dich gelitten,
Als deine Feder keinen Brief, mir keinen Brief mehr schrieb.
Ich nannte Freund und Herr und Leuchtturmwächter
Auf schmalem Inselstrich,
Den Gärtner meines Früchtegartens dich,
Und waren tausend weiser, keiner war gerechter.
Ich spürte kaum, daß mir der Hafen brach,
Der meine Jugend hielt – und kleine Sonnen,
Daß sie vertropft, in Sand verronnen.
Ich stand und sah dir nach.
Dein Durchgang blieb in meinen Tagen,
Wie Wohlgeruch in einem Kleide hängt,
Den es nicht kennt, nicht rechnet, nur empfängt,
Um immer ihn zu tragen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
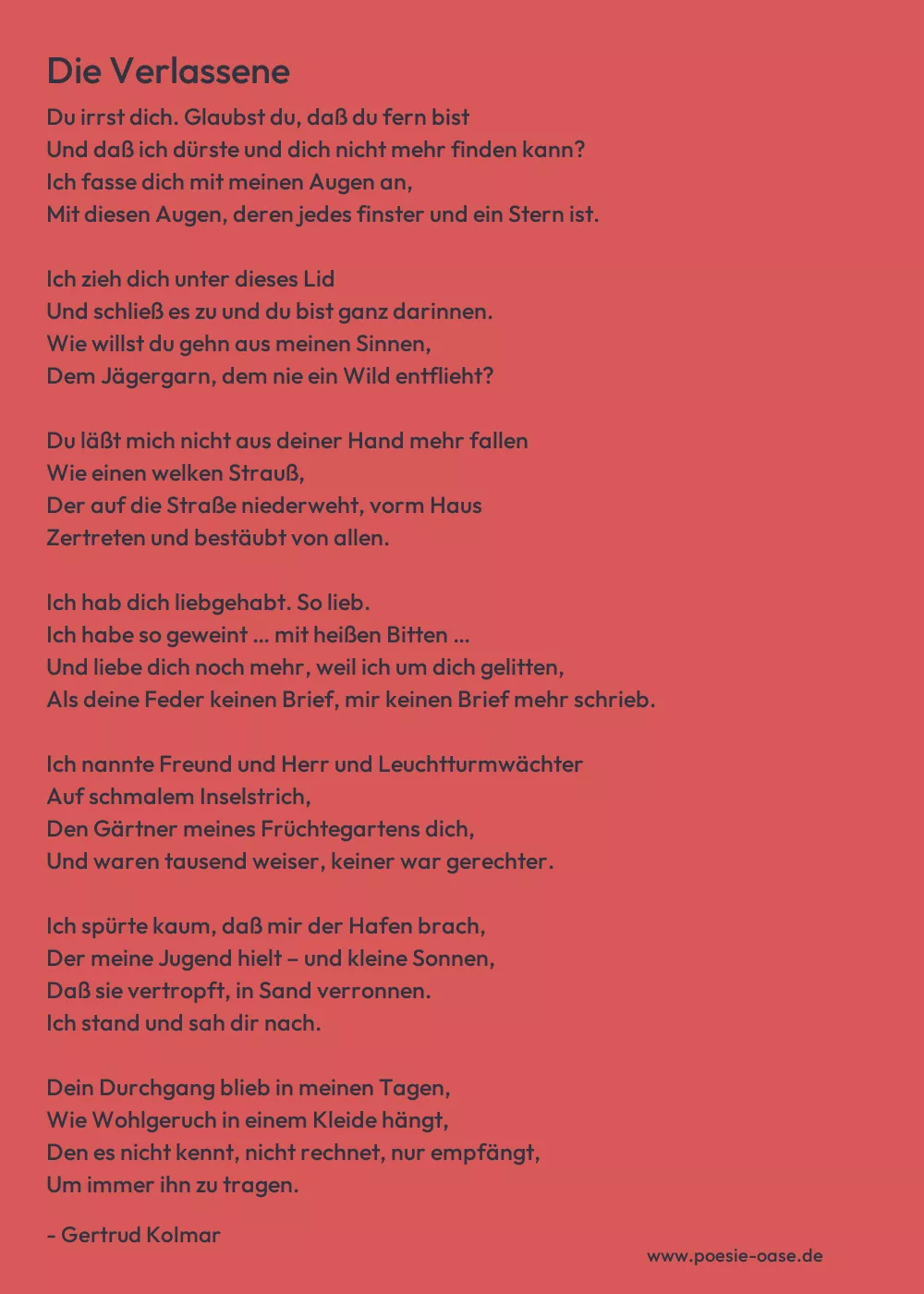
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Verlassene“ von Gertrud Kolmar ist ein eindrucksvolles poetisches Selbstgespräch, das in intensiver Bildsprache die ungebrochene Macht der Erinnerung und der Liebe angesichts eines Verlustes thematisiert. Das lyrische Ich spricht zu einem abwesenden Du, das offenbar eine Liebesbeziehung beendet oder sich entzogen hat. Doch die Sprecherin widersetzt sich dem Vergessen und behauptet kraftvoll: Die Liebe lebt weiter – in ihr, gegen alle äußere Trennung.
Schon in der ersten Strophe wird die zentrale Vorstellung etabliert: Die Trennung ist nur scheinbar. Die Augen der Sprecherin – „finster und ein Stern“ – sind sowohl Ausdruck von Dunkelheit als auch von innerer Leuchtkraft. Sie werden zu einem inneren Raum, in dem das Du bewahrt, ja gefangen wird. Die Vorstellung, das geliebte Gegenüber unter dem Augenlid „einzuschließen“, ist ein kraftvoller Ausdruck innerer Aneignung – der Geliebte entkommt nicht den Sinnen, nicht dem Gedächtnis.
Das Gedicht pendelt zwischen Ohnmacht und Selbstbehauptung. Die Verlassene ist nicht wehrlos, sondern bleibt selbstbestimmt in ihrer Erinnerung. Die Bilder wechseln zwischen Zärtlichkeit und Bitterkeit: Der Geliebte wird nicht losgelassen wie ein welker Strauß, der zertreten wird. Vielmehr wird seine Bedeutung durch das erlittene Leid noch verstärkt – „ich liebe dich noch mehr, weil ich um dich gelitten“. Diese paradoxe Umkehr betont die Tiefe der emotionalen Bindung, die durch Schmerz nicht zerstört, sondern intensiviert wird.
Die fünfte Strophe verklärt das Du mit liebevollen, fast mythischen Zuschreibungen: „Freund und Herr“, „Leuchtturmwächter“, „Gärtner meines Früchtegartens“. Diese Metaphern zeigen, wie sehr das lyrische Ich dem Geliebten eine zentrale, formende Rolle im eigenen Leben zuschreibt. Dass „keiner gerechter“ war, betont zugleich den Schmerz des Verlusts und die Unvergleichbarkeit dieser Beziehung.
Am Ende steht kein dramatischer Ausbruch, sondern eine leise, doch eindrucksvolle Erkenntnis: Die Liebe bleibt als Spur, als feiner „Wohlgeruch“, der unbemerkt am Leben haftet. Die Metapher des Duftes, der vom Kleid aufgenommen wird und bleibt, obwohl er nicht verstanden oder kontrolliert wird, bringt das zentrale Motiv des Gedichts auf den Punkt – die Liebe ist nicht auslöschbar. Sie lebt als Eindruck fort, subtil, unausweichlich, unaussprechlich.
„Die Verlassene“ ist ein intensives, ruhiges Gedicht über die Macht der Erinnerung, über die Würde einer tiefen inneren Bindung – und über den paradoxen Trost, der im Bleiben des Gefühls liegt, auch wenn der andere gegangen ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.