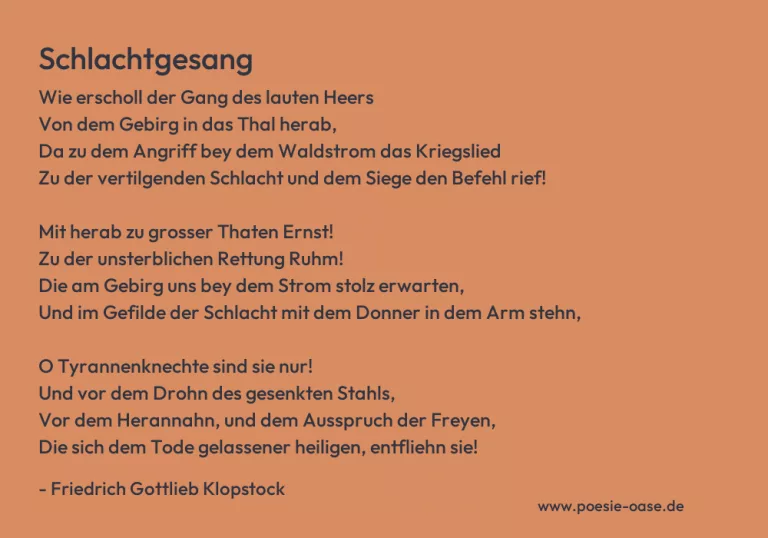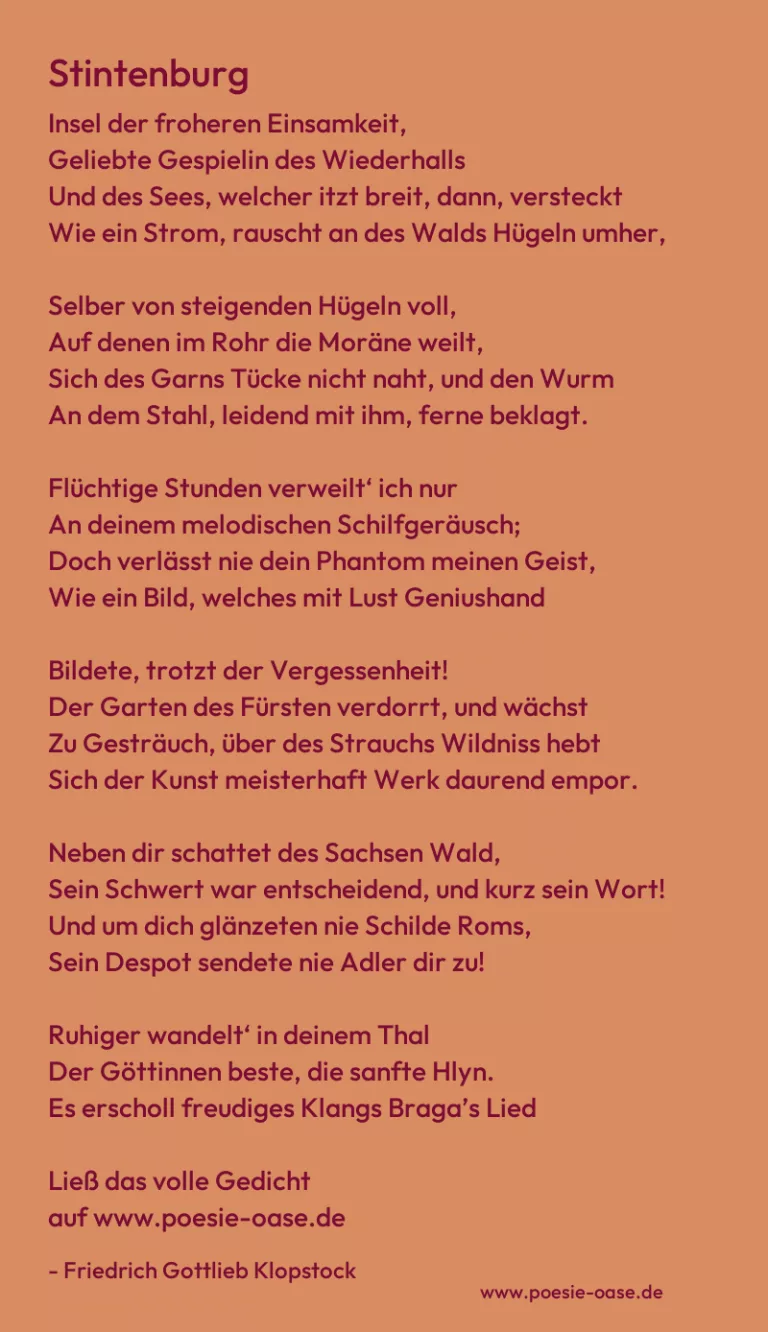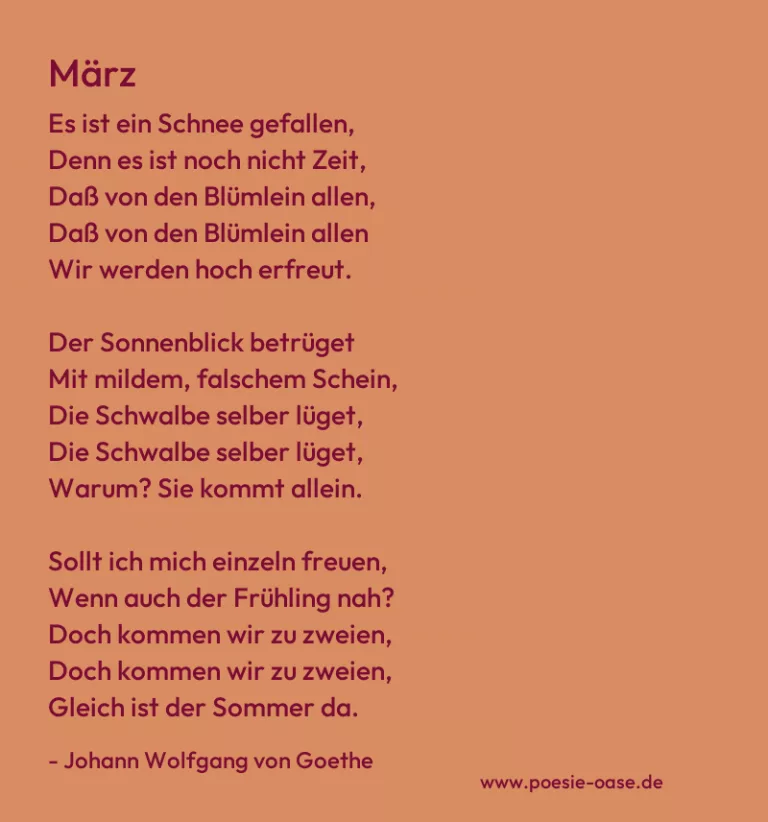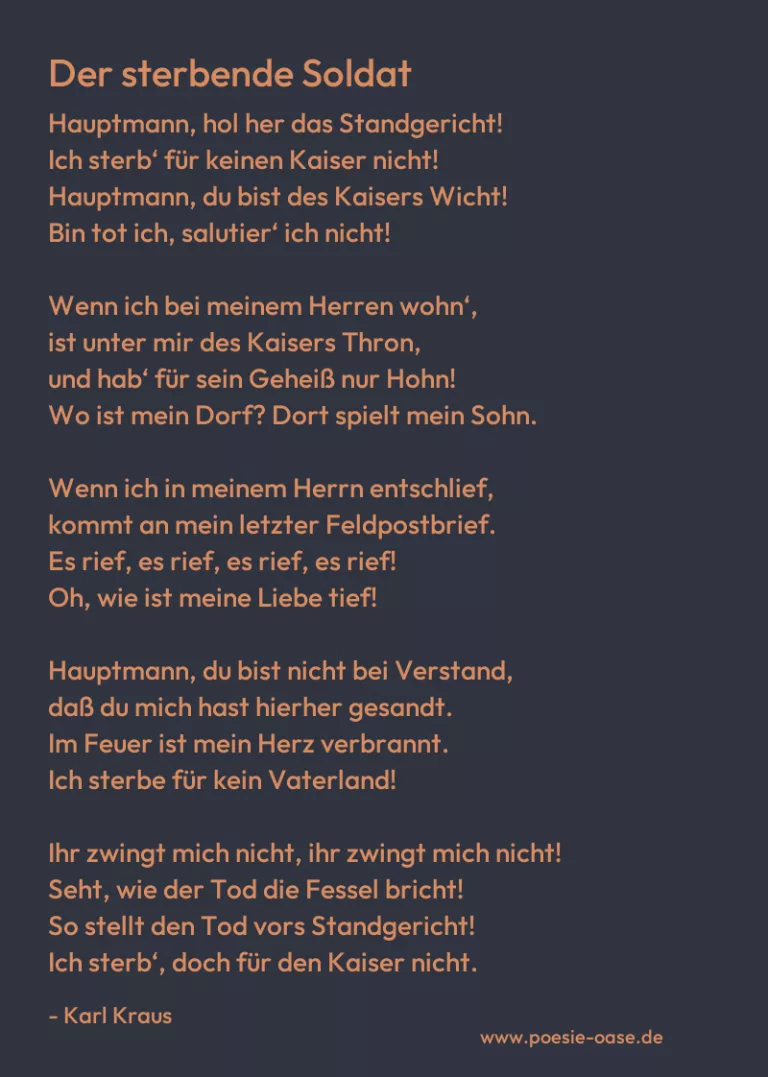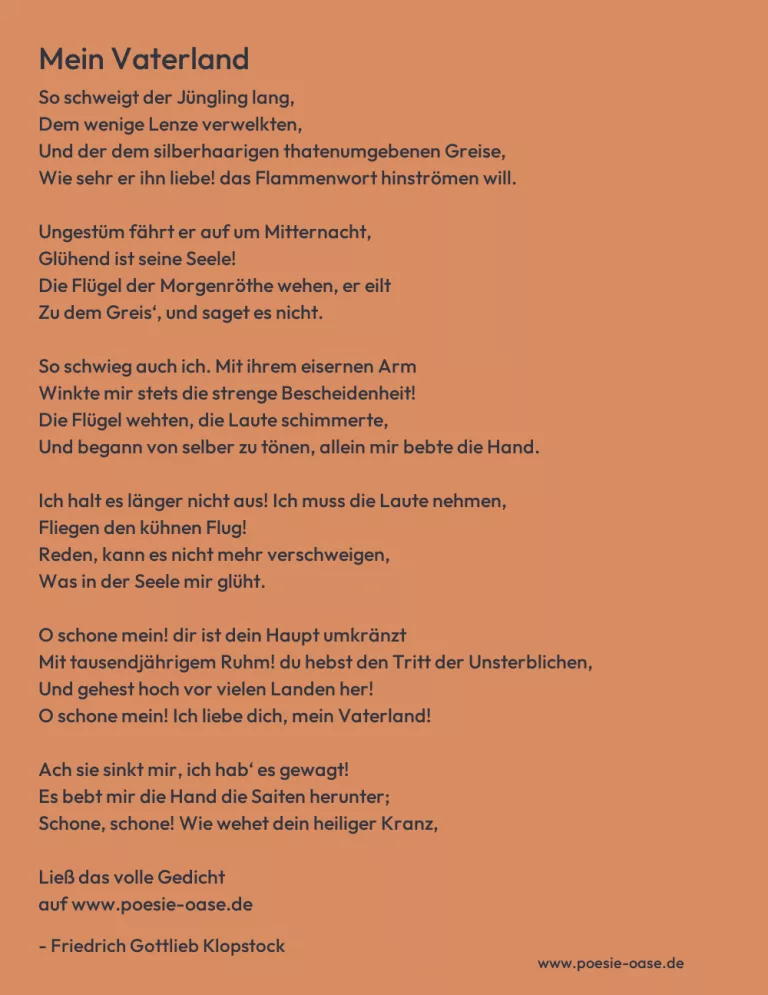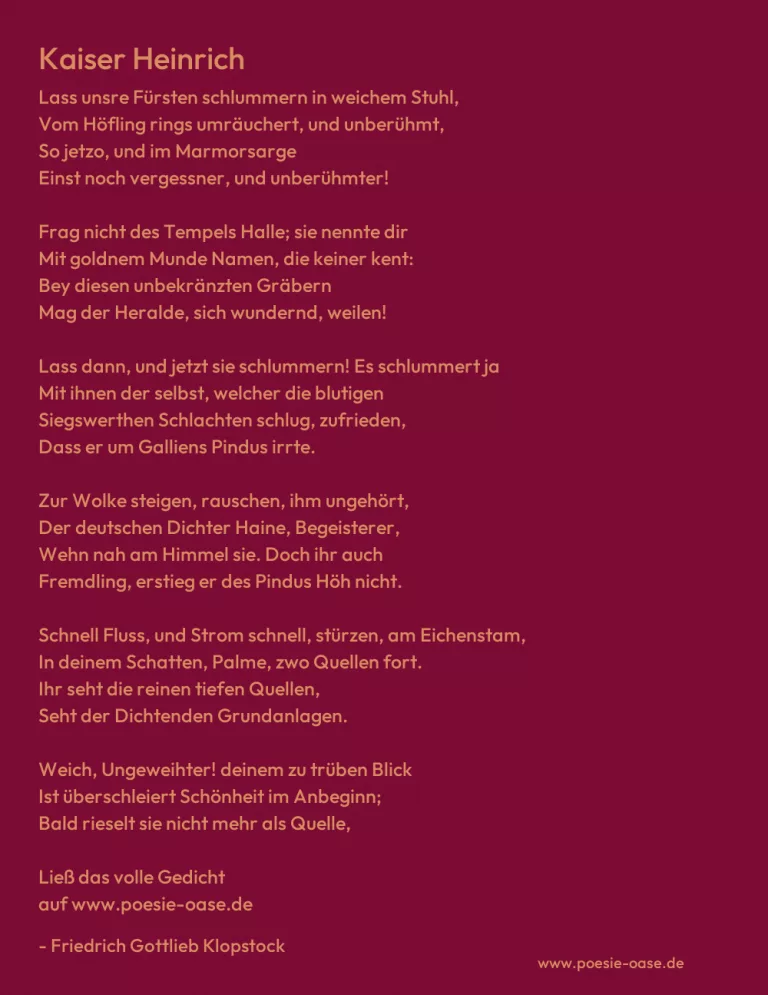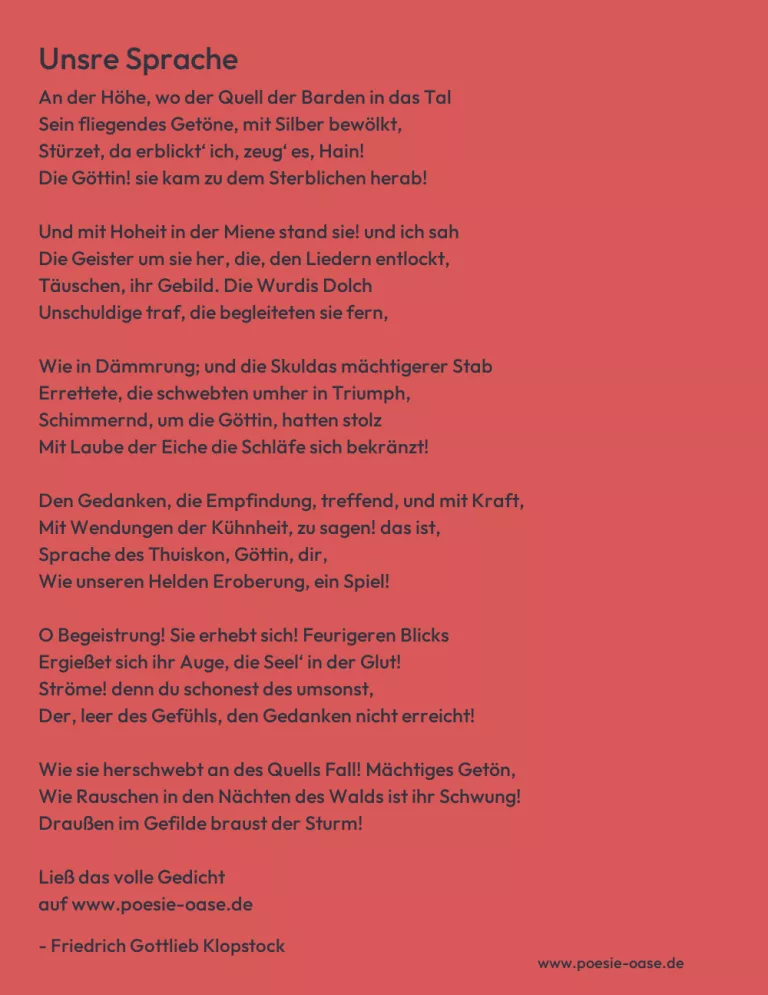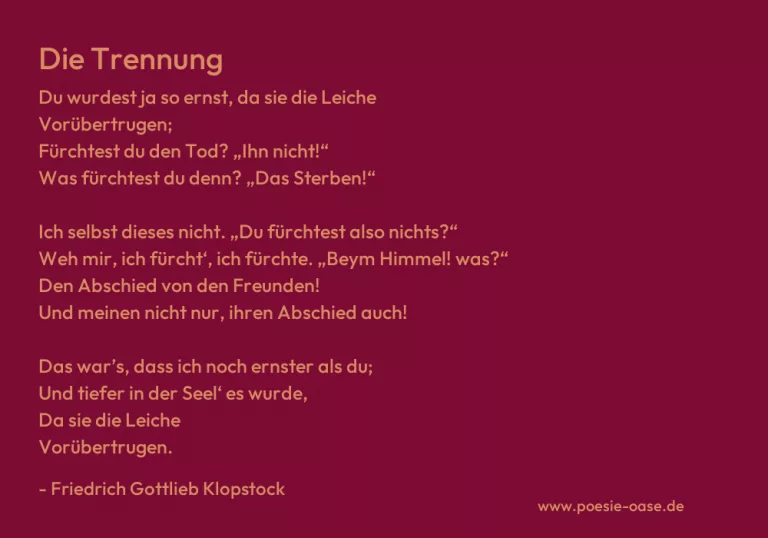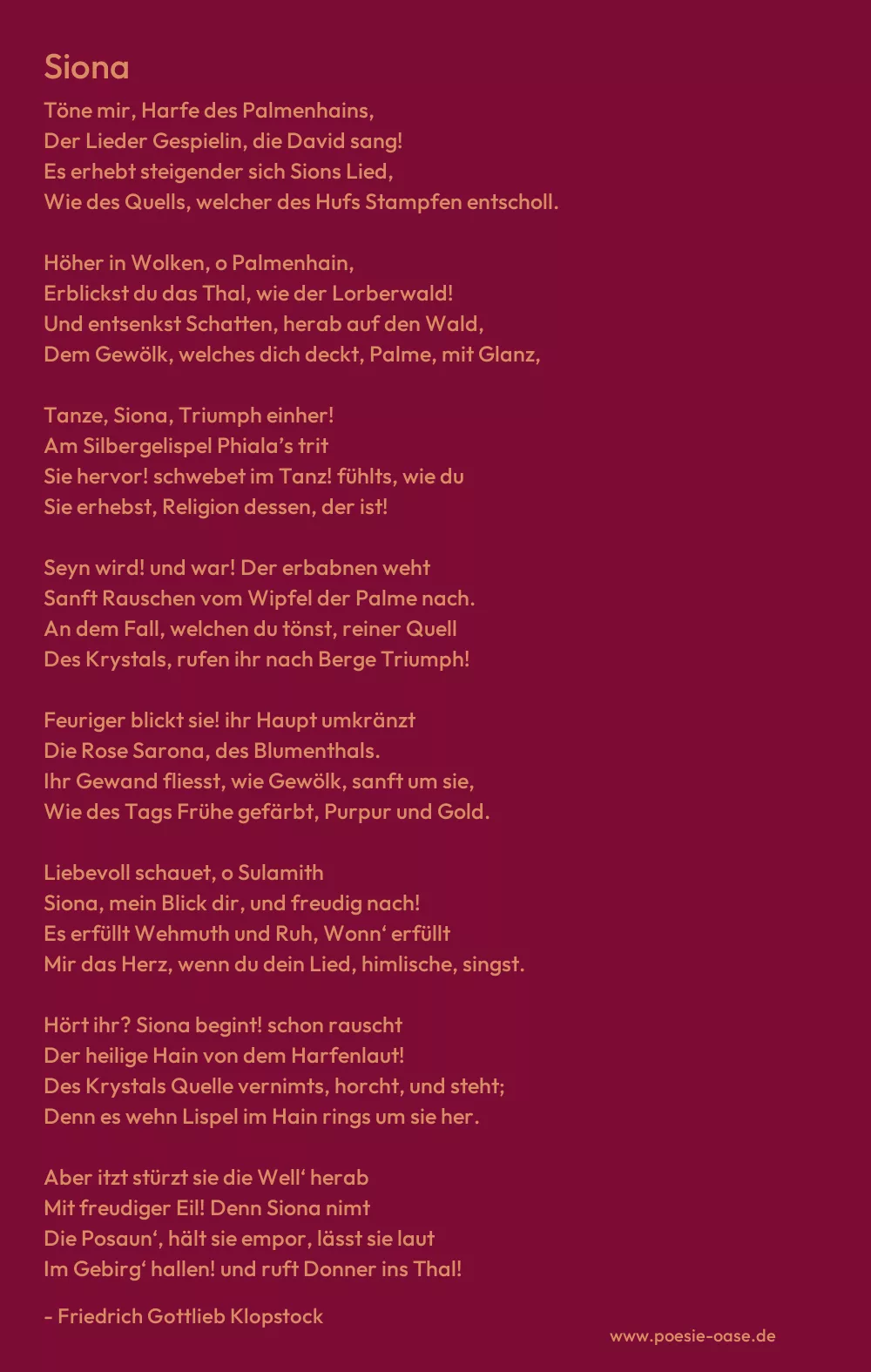Töne mir, Harfe des Palmenhains,
Der Lieder Gespielin, die David sang!
Es erhebt steigender sich Sions Lied,
Wie des Quells, welcher des Hufs Stampfen entscholl.
Höher in Wolken, o Palmenhain,
Erblickst du das Thal, wie der Lorberwald!
Und entsenkst Schatten, herab auf den Wald,
Dem Gewölk, welches dich deckt, Palme, mit Glanz,
Tanze, Siona, Triumph einher!
Am Silbergelispel Phiala’s trit
Sie hervor! schwebet im Tanz! fühlts, wie du
Sie erhebst, Religion dessen, der ist!
Seyn wird! und war! Der erbabnen weht
Sanft Rauschen vom Wipfel der Palme nach.
An dem Fall, welchen du tönst, reiner Quell
Des Krystals, rufen ihr nach Berge Triumph!
Feuriger blickt sie! ihr Haupt umkränzt
Die Rose Sarona, des Blumenthals.
Ihr Gewand fliesst, wie Gewölk, sanft um sie,
Wie des Tags Frühe gefärbt, Purpur und Gold.
Liebevoll schauet, o Sulamith
Siona, mein Blick dir, und freudig nach!
Es erfüllt Wehmuth und Ruh, Wonn‘ erfüllt
Mir das Herz, wenn du dein Lied, himlische, singst.
Hört ihr? Siona begint! schon rauscht
Der heilige Hain von dem Harfenlaut!
Des Krystals Quelle vernimts, horcht, und steht;
Denn es wehn Lispel im Hain rings um sie her.
Aber itzt stürzt sie die Well‘ herab
Mit freudiger Eil! Denn Siona nimt
Die Posaun‘, hält sie empor, lässt sie laut
Im Gebirg‘ hallen! und ruft Donner ins Thal!