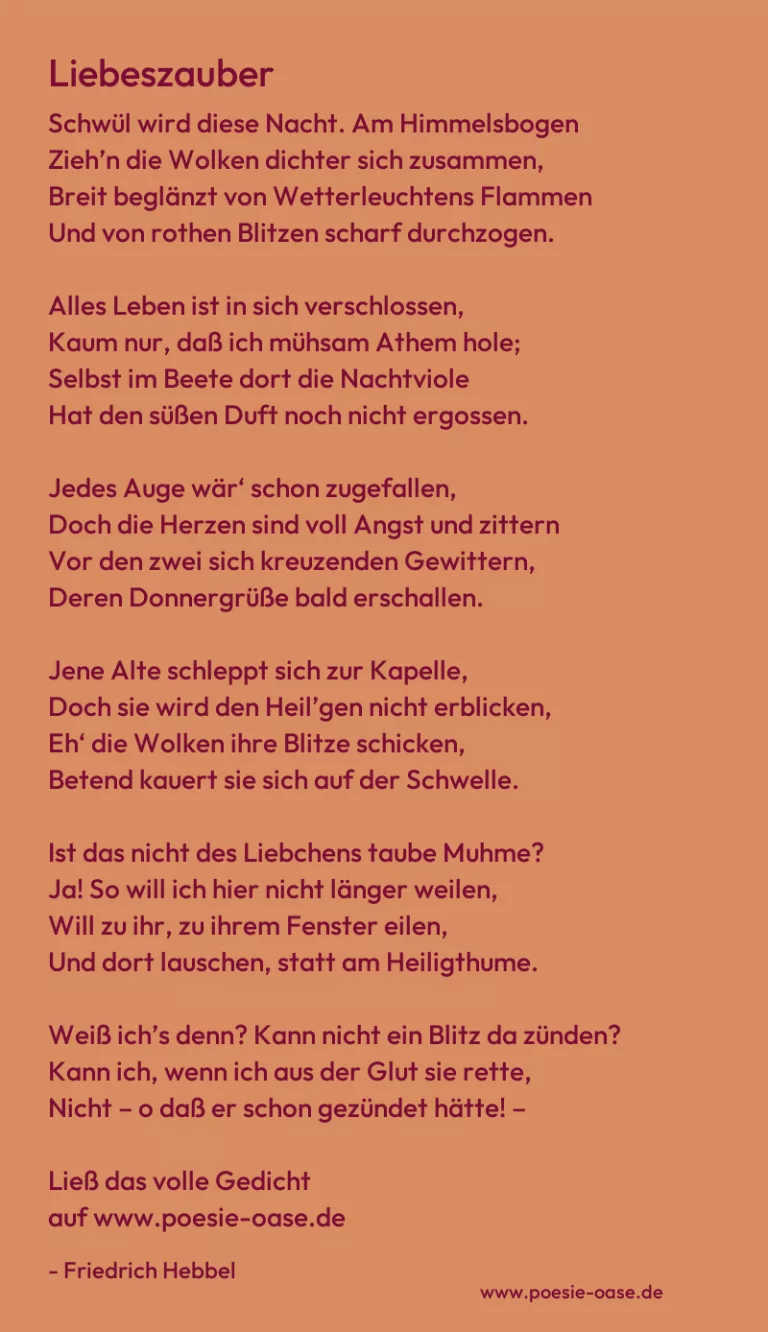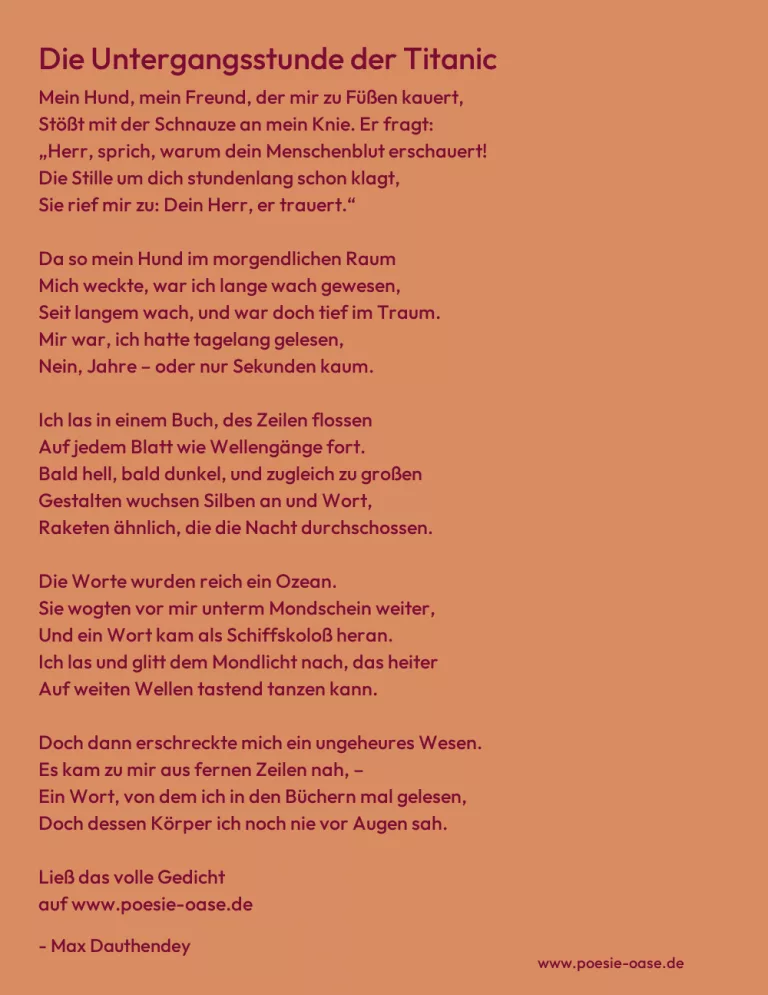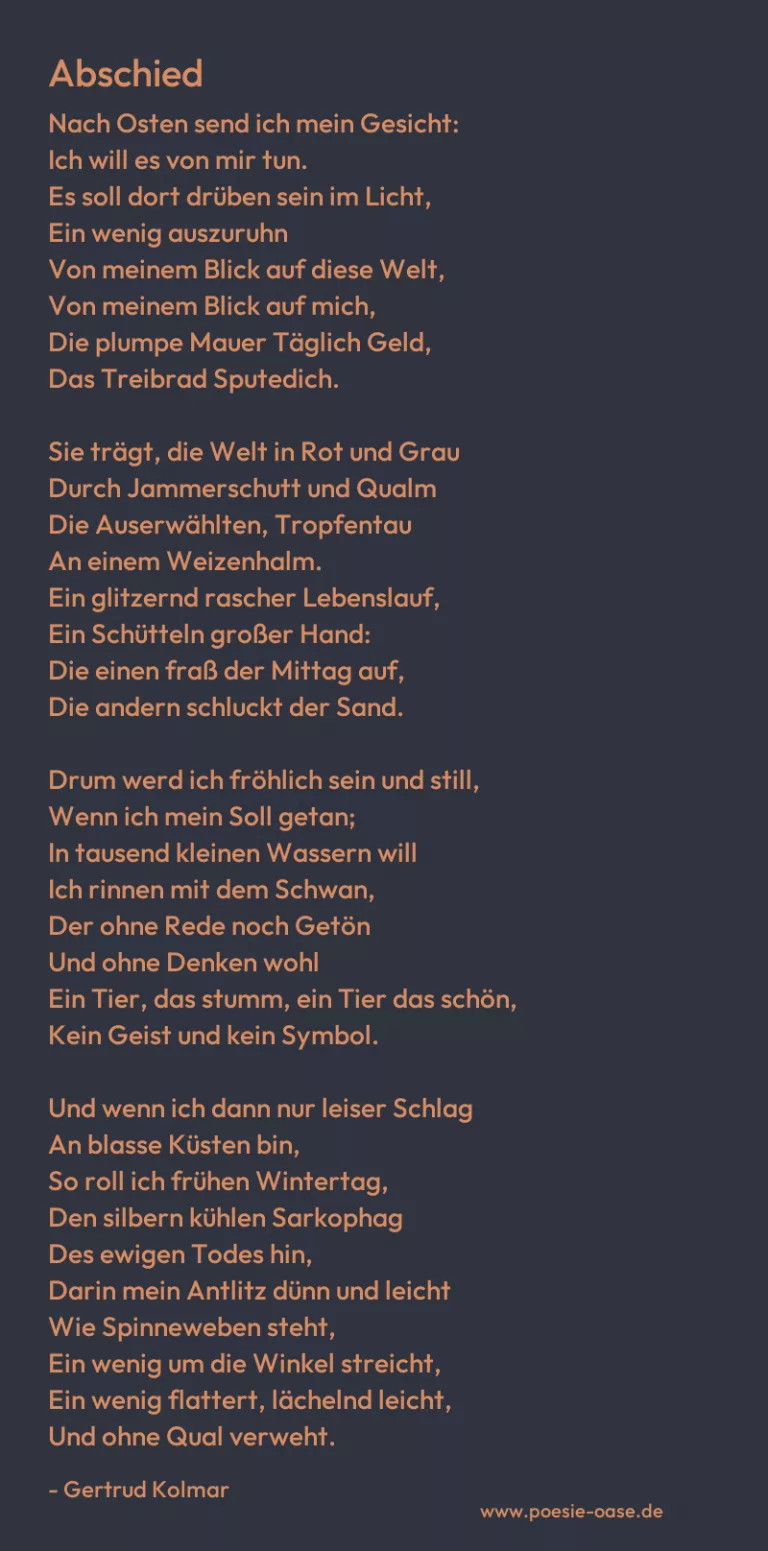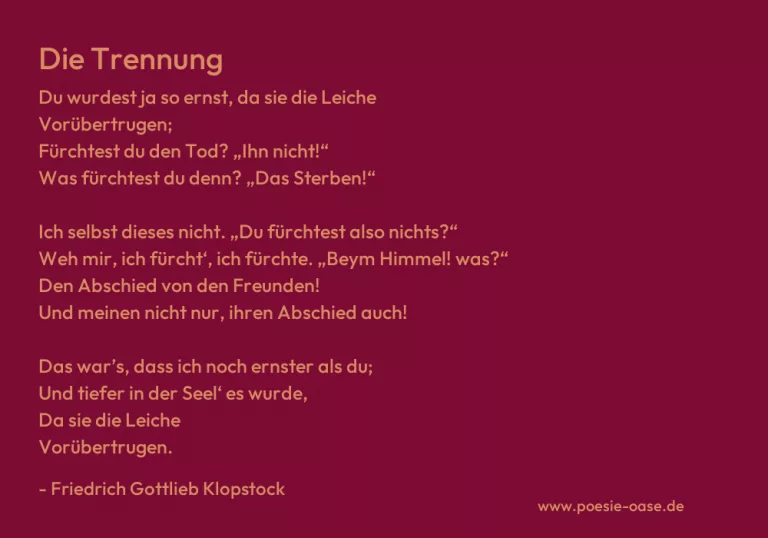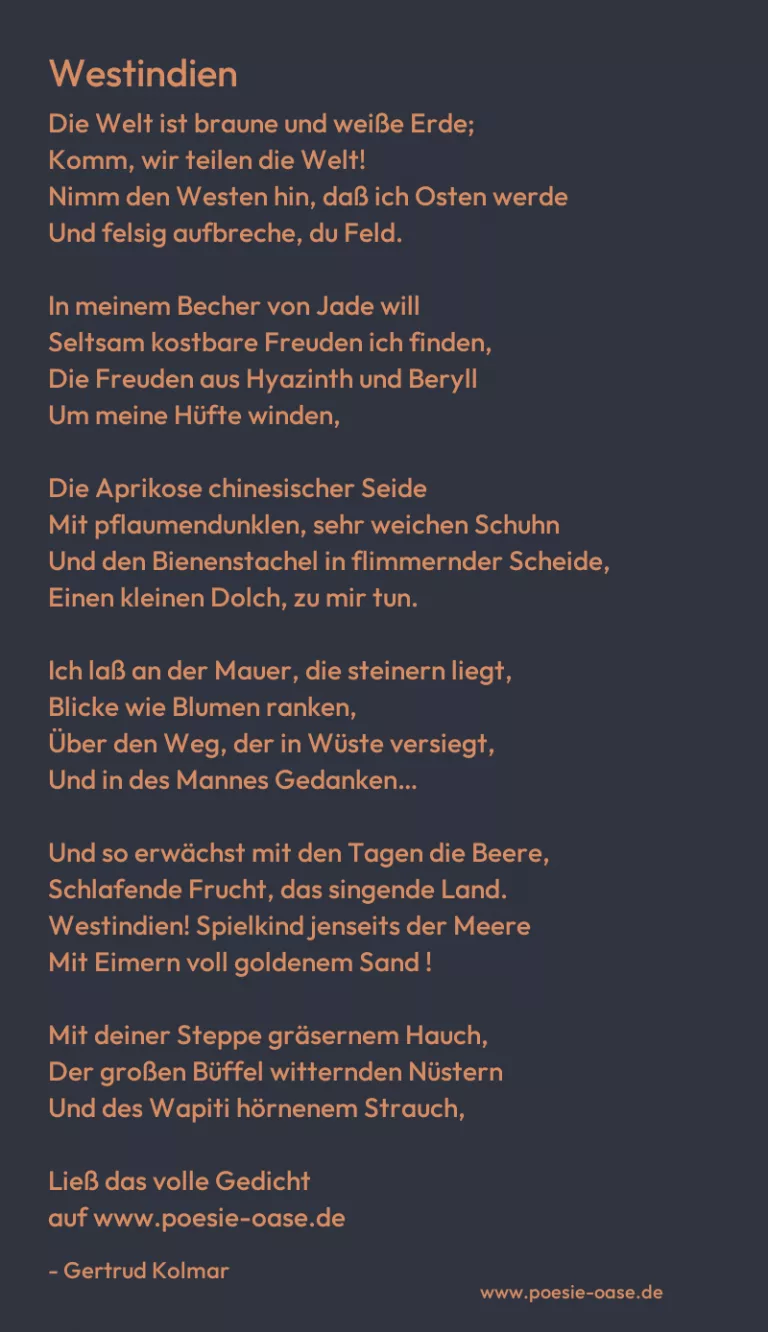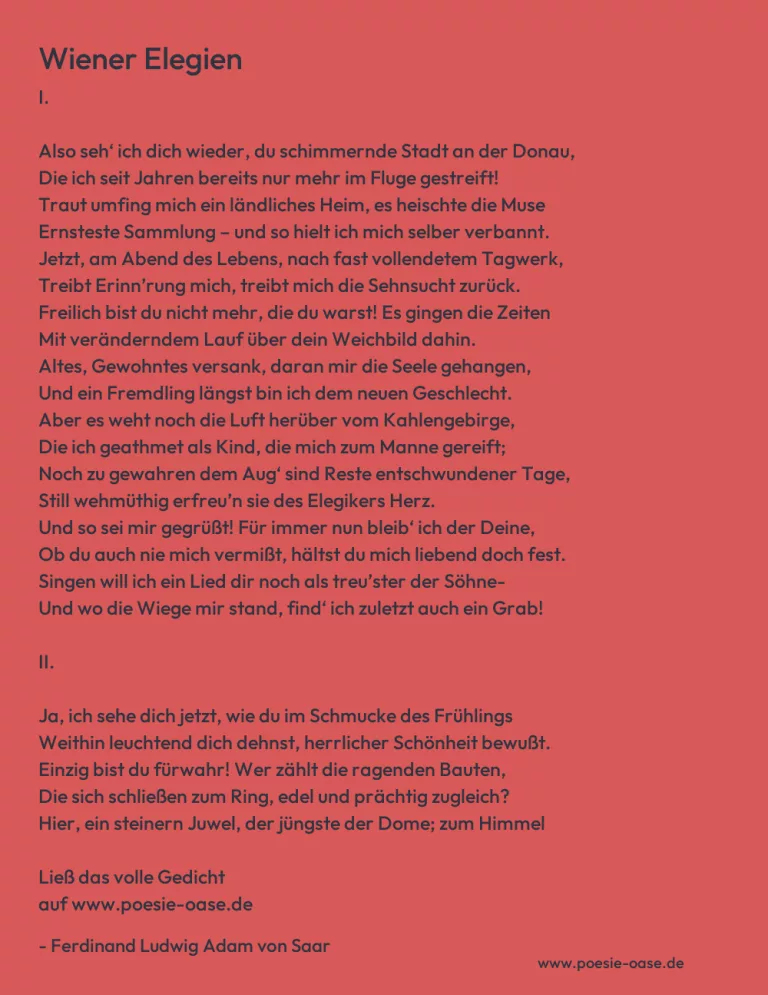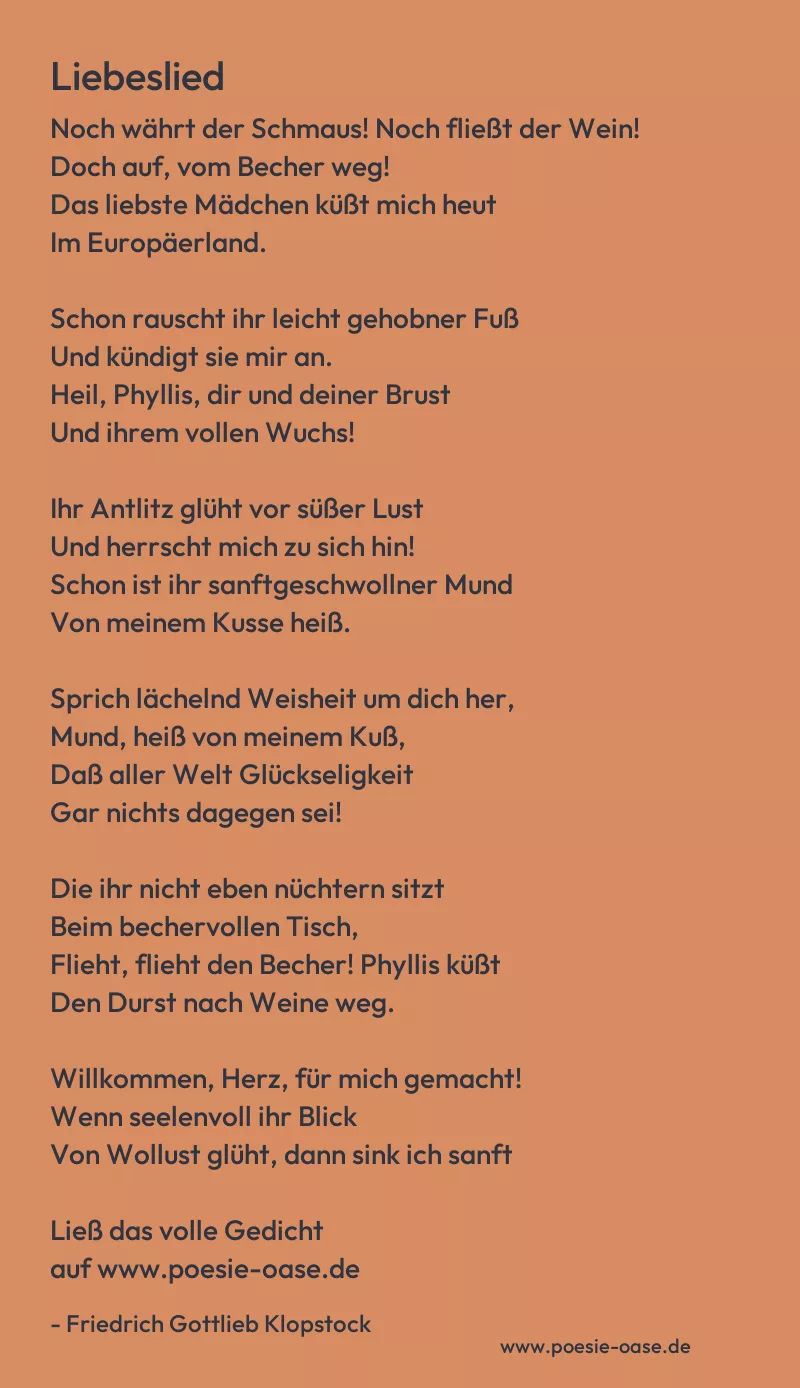Noch währt der Schmaus! Noch fließt der Wein!
Doch auf, vom Becher weg!
Das liebste Mädchen küßt mich heut
Im Europäerland.
Schon rauscht ihr leicht gehobner Fuß
Und kündigt sie mir an.
Heil, Phyllis, dir und deiner Brust
Und ihrem vollen Wuchs!
Ihr Antlitz glüht vor süßer Lust
Und herrscht mich zu sich hin!
Schon ist ihr sanftgeschwollner Mund
Von meinem Kusse heiß.
Sprich lächelnd Weisheit um dich her,
Mund, heiß von meinem Kuß,
Daß aller Welt Glückseligkeit
Gar nichts dagegen sei!
Die ihr nicht eben nüchtern sitzt
Beim bechervollen Tisch,
Flieht, flieht den Becher! Phyllis küßt
Den Durst nach Weine weg.
Willkommen, Herz, für mich gemacht!
Wenn seelenvoll ihr Blick
Von Wollust glüht, dann sink ich sanft
An ihre volle Brust.
Wenn nun mein trunknes Auge schwimmt,
Entzückung ohne Maß
Weit um mich her, dann bebt mein Herz
Zu ihrem Herzen hin.
Dann treten wir viel seliger
Als Könige daher
Und fühlen, daß dies Wahrheit sei.
Das geht durch Mark und Bein.
Und preist mit frohem Ungestüm
Der Bräut’gam und die Braut;
Er schaut auf uns nacheifernd hin
Und küßt sie feuriger,
Und drückt sie wilder an sein Herz
Und lispelt ihr ins Ohr:
„Sind wir den Göttern auch nicht gleich,
So lieben wir doch auch!“
Uns preist, voll Freuden einer Braut,
Die Mutter ihrem Sohn!
Sie drückt ihn an ihr Herz und spricht:
„Sei, wie dein Vater war!“
Nur uns gehört die Ewigkeit,
Wenn wir gestorben sind,
Damit der Enkelinnen Sohn
Versteh, was Liebe sei.