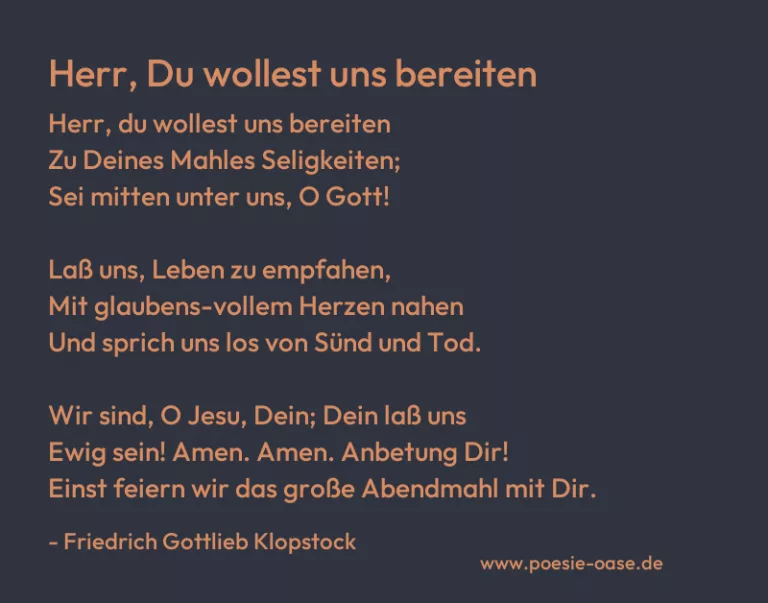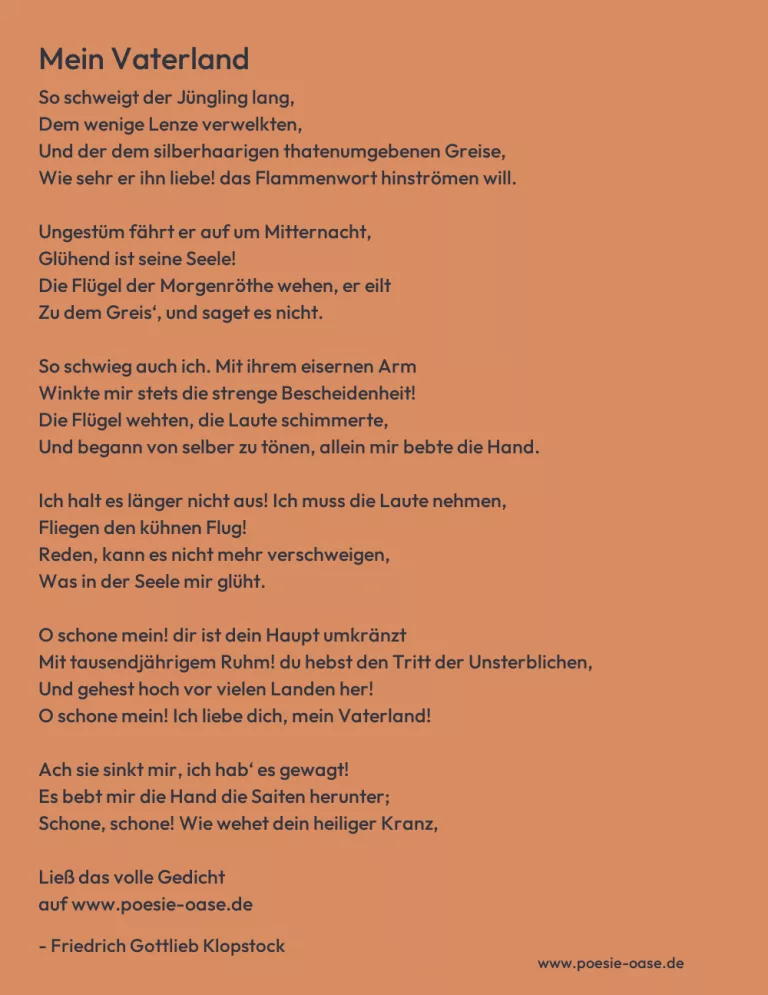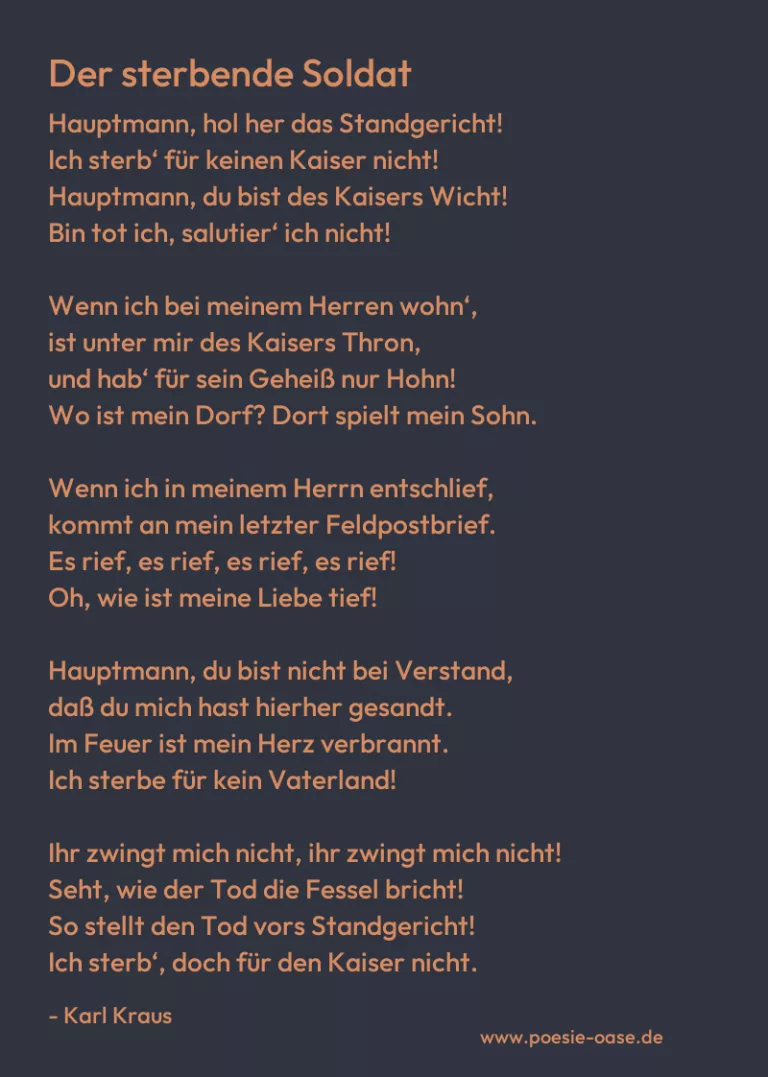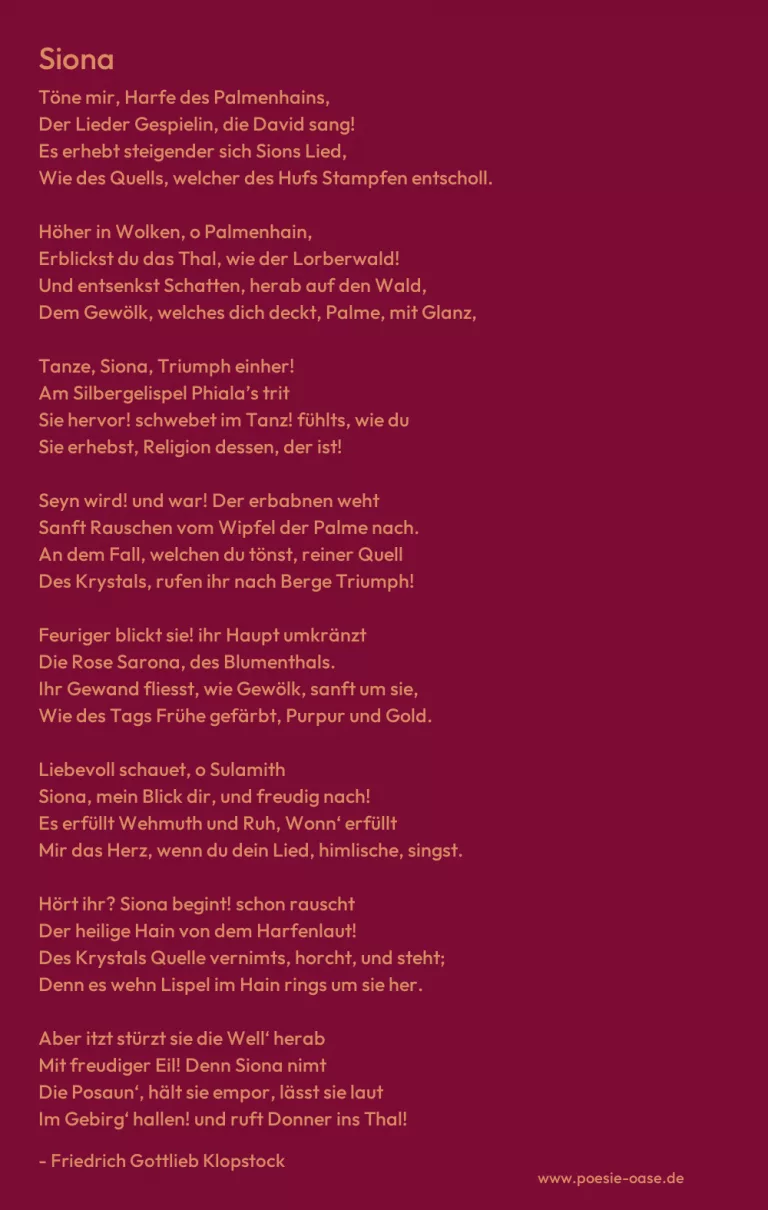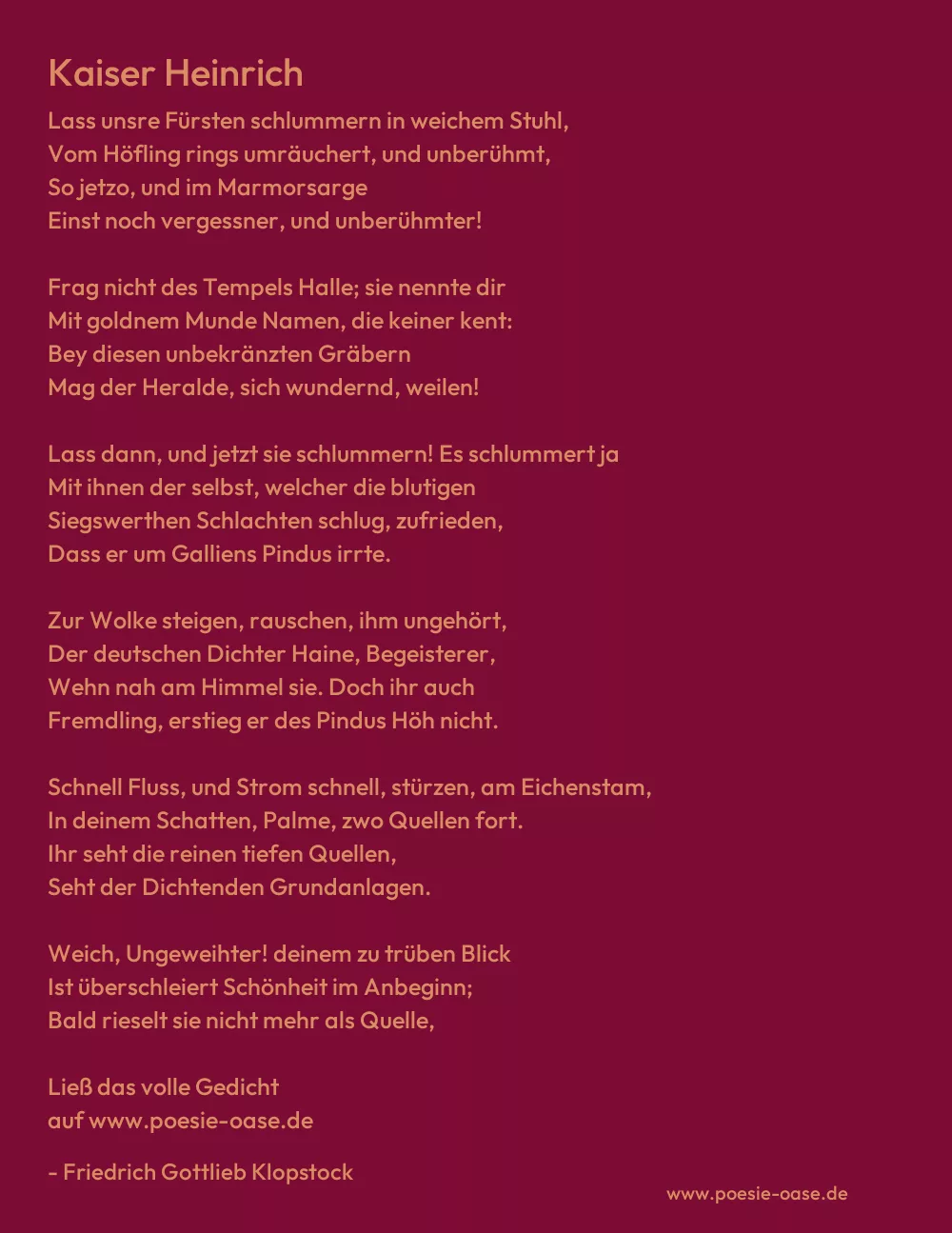Lass unsre Fürsten schlummern in weichem Stuhl,
Vom Höfling rings umräuchert, und unberühmt,
So jetzo, und im Marmorsarge
Einst noch vergessner, und unberühmter!
Frag nicht des Tempels Halle; sie nennte dir
Mit goldnem Munde Namen, die keiner kent:
Bey diesen unbekränzten Gräbern
Mag der Heralde, sich wundernd, weilen!
Lass dann, und jetzt sie schlummern! Es schlummert ja
Mit ihnen der selbst, welcher die blutigen
Siegswerthen Schlachten schlug, zufrieden,
Dass er um Galliens Pindus irrte.
Zur Wolke steigen, rauschen, ihm ungehört,
Der deutschen Dichter Haine, Begeisterer,
Wehn nah am Himmel sie. Doch ihr auch
Fremdling, erstieg er des Pindus Höh nicht.
Schnell Fluss, und Strom schnell, stürzen, am Eichenstam,
In deinem Schatten, Palme, zwo Quellen fort.
Ihr seht die reinen tiefen Quellen,
Seht der Dichtenden Grundanlagen.
Weich, Ungeweihter! deinem zu trüben Blick
Ist überschleiert Schönheit im Anbeginn;
Bald rieselt sie nicht mehr als Quelle,
Giesst in Gefilde sich, reisst das Herz fort!
Wer sind die Seelen, die in der Haine Nacht
Herschweben? Liesst ihr, Helden, der Todten Thal?
Und kamt ihr, eurer späten Enkel
Rachegesang an uns selbst zu hören?
Denn ach wir säumten! Jetzo erschrecket uns
Der Adler keiner über der Wolkenbahn.
Des Griechen Flug nur ist uns furchtbar,
Aber die Religion erhöhet
Uns über Hämus, über des Hufes Quell!
Posaun‘, und Harfe tönen, wenn sie beseelt;
Und tragischer, wenn sie ihn leitet,
Hebet, o Sophokles, dein Kothurn sich.
Und wer ist Pindar gegen dich, Bethlems Sohn,
Des Dagoniten Sieger, und Hirtenknab‘,
O Isaide, Sänger Gottes,
Der den Unendlichen singen konte!
Hört uns, o Schatten! Himmelan steigen wir
Mit Kühnheit. Urtheil blickt sie, und kent den Flug.
Das Maass in sichrer Hand, bestimmen
Wir den Gedanken, und seine Bilder.
Bist du, der Erste, nicht der Eroberer
Am leichenvollen Strom? und der Dichter Freund?
Ja, du bist Karl! Verschwind, o Schatten,
Welcher uns mordend zu Christen machte!
Tritt, Barbarossa, höher als er empor;
Dein ist der Vorzeit edler Gesang! Denn Karl
Liess, ach umsonst, der Barden Kriegshorn
Tönen dem Auge. Sie liegt verkennet
In Nachtgewölben unter der Erde wo
Der Klosteröden, klaget nach uns herauf
Die farbenhelle Schrift, geschrieben,
Wie es erfand, der zuerst dem Schall gab
In Hermanns Vaterlande Gestalt, und gab
Altdeutschen Thaten Rettung vom Untergang!
Bey Trümmern liegt die Schrift, des stolzen
Franken Erfindung, und bald in Trümmern,
Und ruft, und schüttelt (hörst du es, Cellner, nicht?)
Die goldnen Buckeln, schlägt an des Bandes Schild
Mit Zorn! Den, der sie höret, nenn‘ ich
Dankend dem froheren Wiederhalle!
Du sangest selbst, o Heinrich: Mir sind das Reich
Und unterthan die Lande; doch misst‘ ich eh
Die Kron‘, als Sie! erwählte beydes
Acht mir und Bann, eh ich Sie verlöre!
Wenn jetzt du lebtest, edelster deines Volks,
Und Kaiser! würdest du, bey der Deutschen Streit
Mit Hämus Dichtern, und mit jenen
Am Kapitol, unerwecklich schlummern?
Du sängest selber, Heinrich: Mir dient, wer blinkt
Mit Pflugschaar, oder Lanze; doch misst‘ ich eh
Die Kron‘, als Muse, dich! und euch, ihr
Ehren, die länger als Kronen schmücken!