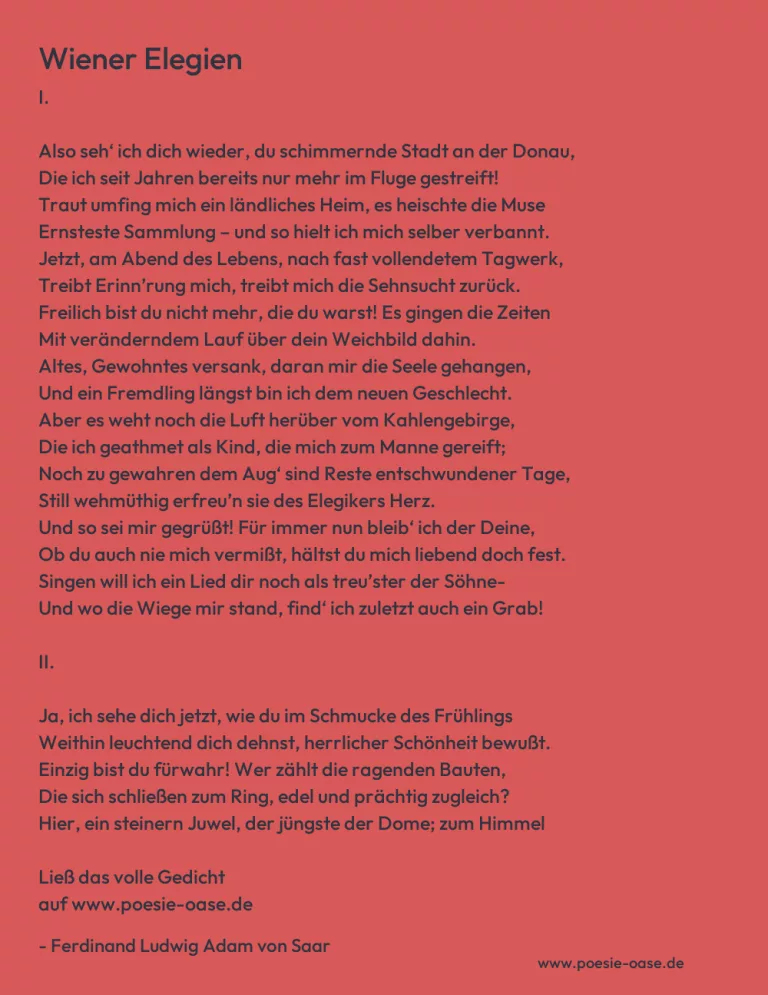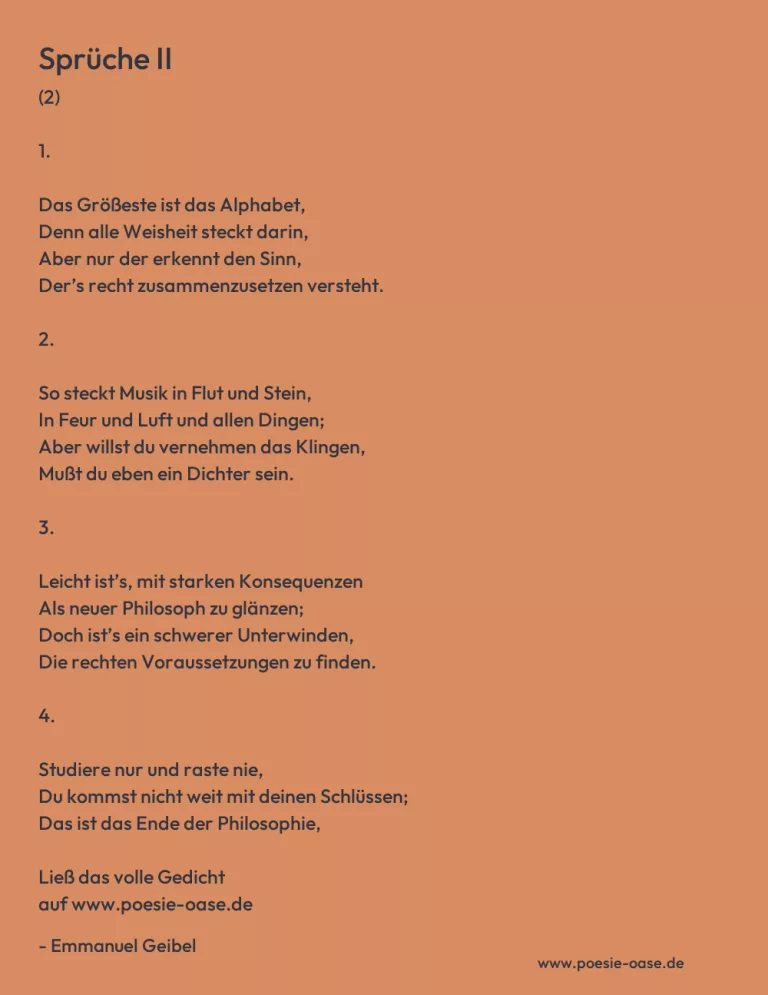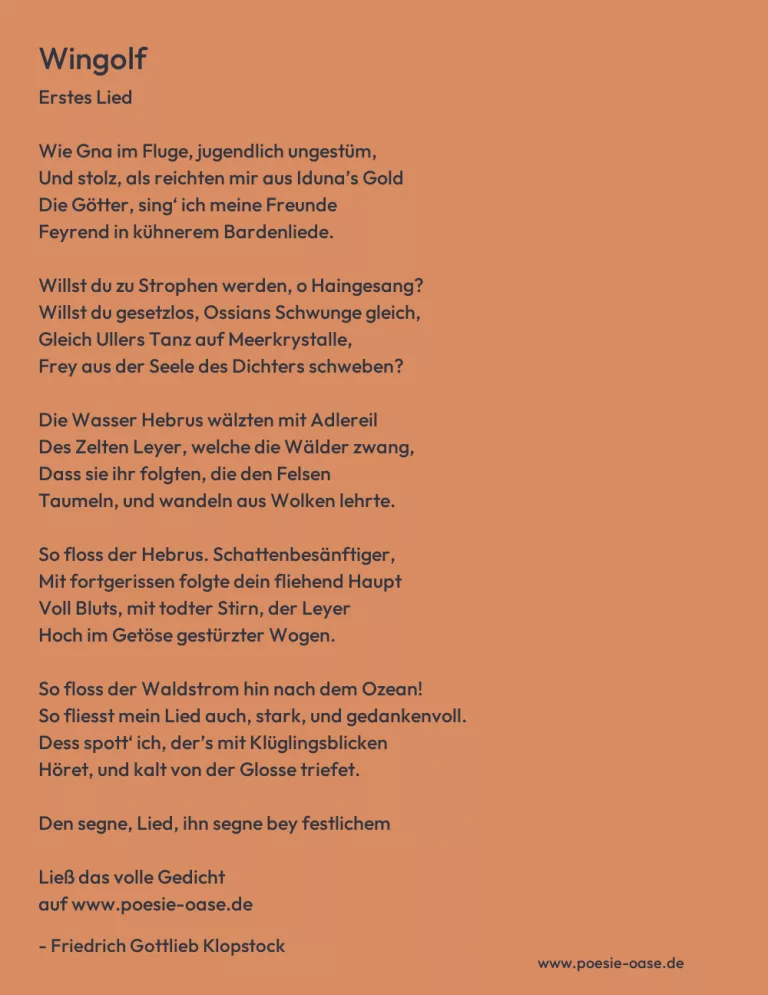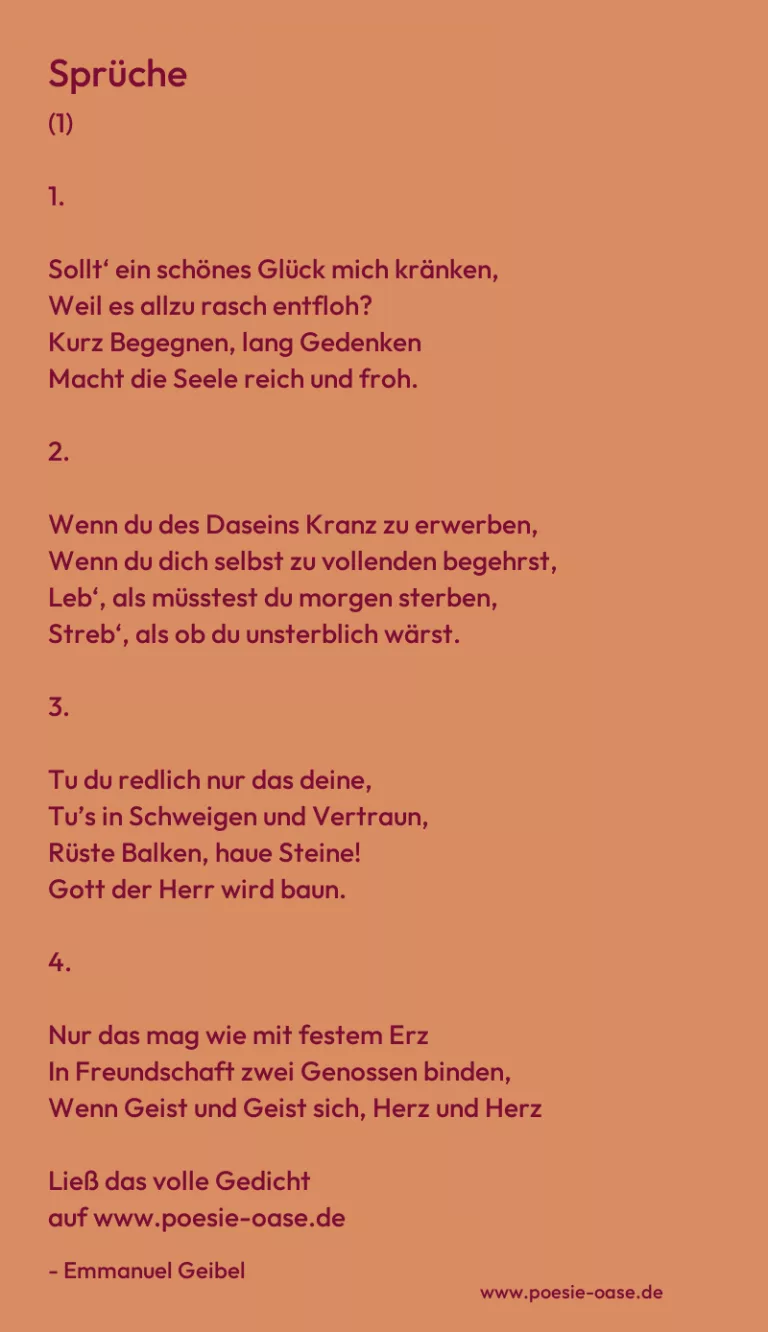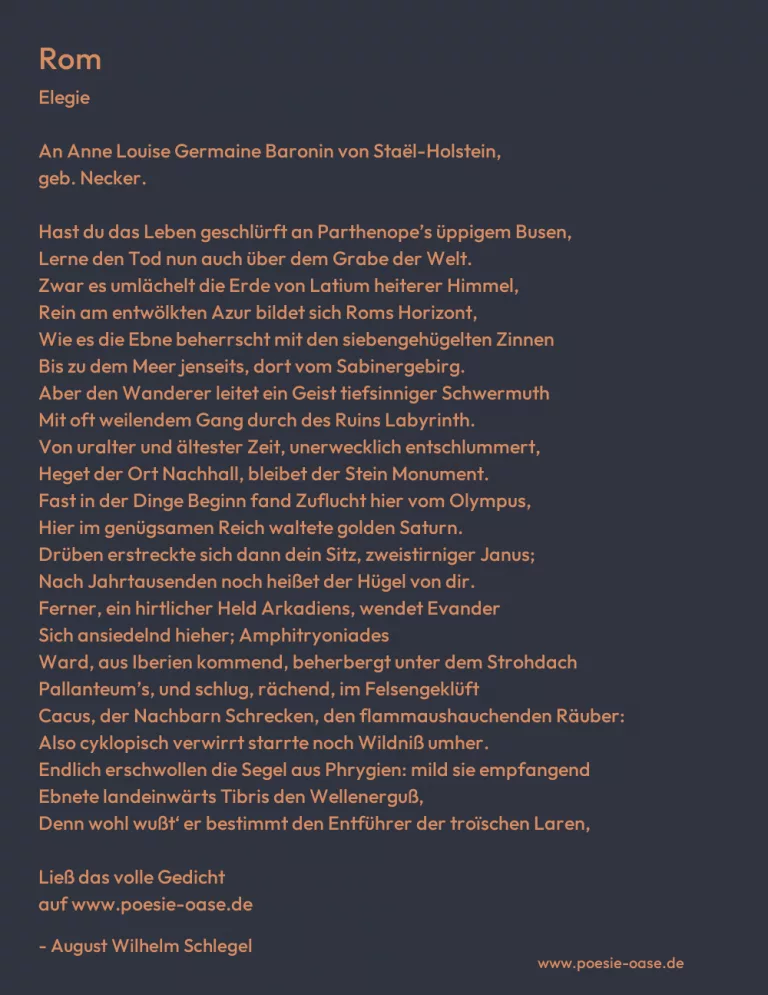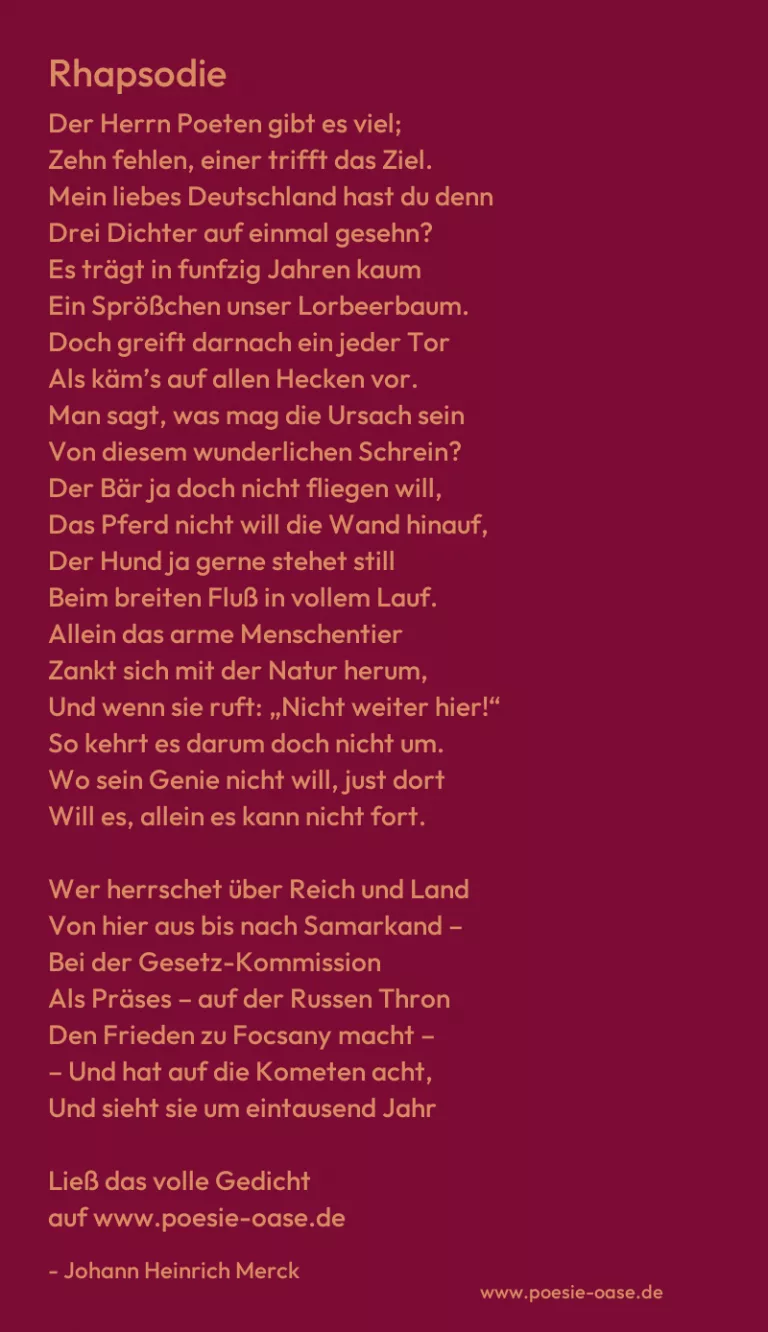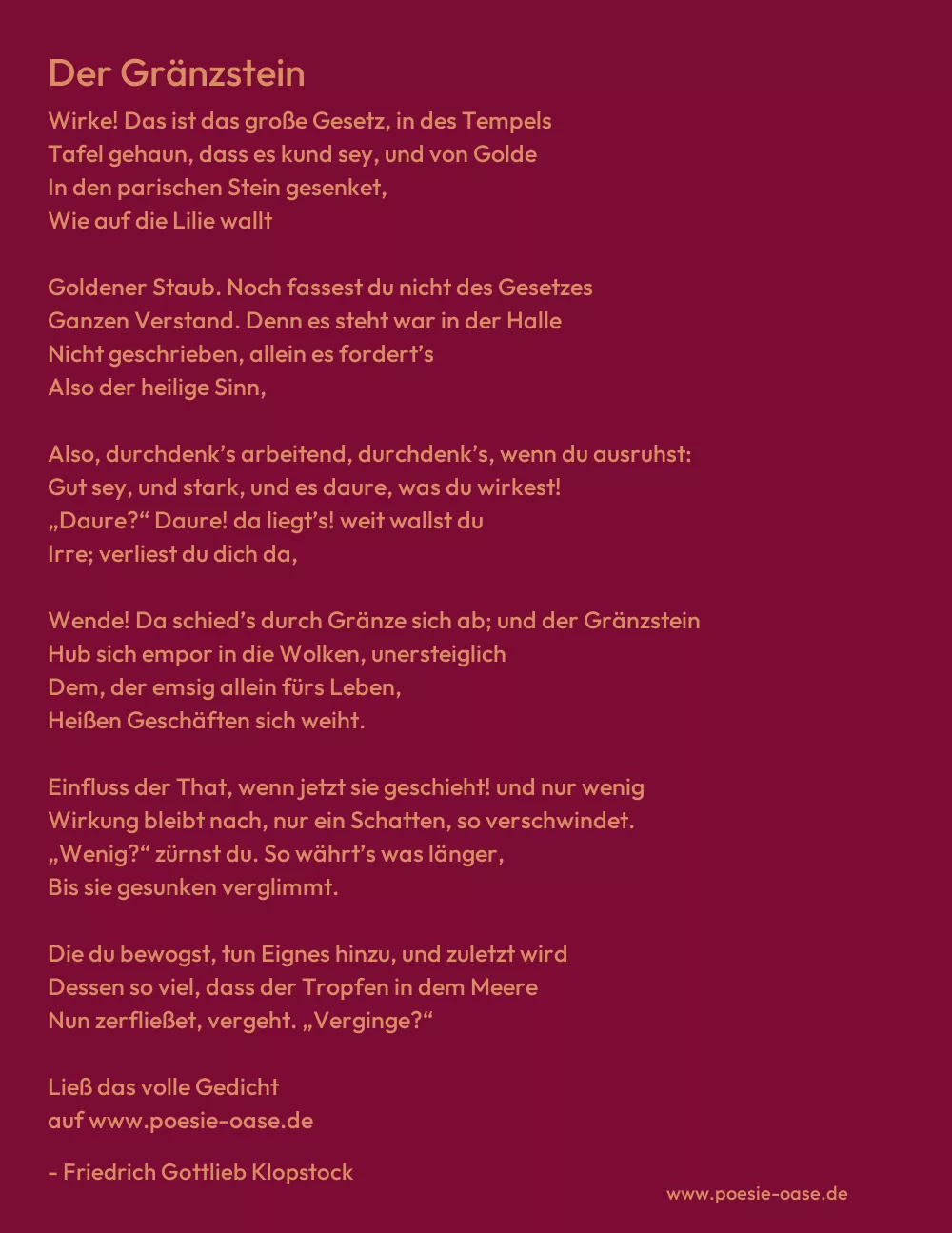Wirke! Das ist das große Gesetz, in des Tempels
Tafel gehaun, dass es kund sey, und von Golde
In den parischen Stein gesenket,
Wie auf die Lilie wallt
Goldener Staub. Noch fassest du nicht des Gesetzes
Ganzen Verstand. Denn es steht war in der Halle
Nicht geschrieben, allein es fordert’s
Also der heilige Sinn,
Also, durchdenk’s arbeitend, durchdenk’s, wenn du ausruhst:
Gut sey, und stark, und es daure, was du wirkest!
„Daure?“ Daure! da liegt’s! weit wallst du
Irre; verliest du dich da,
Wende! Da schied’s durch Gränze sich ab; und der Gränzstein
Hub sich empor in die Wolken, unersteiglich
Dem, der emsig allein fürs Leben,
Heißen Geschäften sich weiht.
Einfluss der That, wenn jetzt sie geschieht! und nur wenig
Wirkung bleibt nach, nur ein Schatten, so verschwindet.
„Wenig?“ zürnst du. So währt’s was länger,
Bis sie gesunken verglimmt.
Die du bewogst, tun Eignes hinzu, und zuletzt wird
Dessen so viel, dass der Tropfen in dem Meere
Nun zerfließet, vergeht. „Verginge?“
In die Atome sich löst.
Nicht, dass dein Thun, verkenne mich nicht, mir nicht heilig
Wäre, vollführt’s, wes auch andre sich erfreuen:
Nicht verächtlich, wofern es dir nur
Frommet, verkenne mich nicht!
Könige sind weitwirkend, auch bleibt’s, wie ein Abend
Schatten; und doch muss auch dieser sich verlieren!
Ach die Handlung sinkt hin, und klimmt nicht
Über der Sonderung Stein.
Geist des Gesangs, was rufest du mir, und gebietest
Anderen Ton? O du kennest noch nicht ganz dich!
Bey Amphion! auch diese Saite
Stimmte der Grieche fürs Herz.
Könige sind weitwirkend, auch bleibt’s, wie ein Abend
Schatten; und doch muss auch dieser sich verlieren!
Ach die Handlung sinkt hin, und klimmt nicht
Über der Sonderung Stein.
Aber wenn, wem die Sterblichkeit ruft, noch, was wirket,
Hinter sich lässt, noch ein Denken in des Geistes
Werken, welches von Kraft, von Gutem
Voll, wo es waltet, uns hält:
Jenseit ist das der Höhe, die gränzt. Was es wirkte,
Wirket es stets, wie im Anfang, so von neuem:
Jahre fliehn; und es strömt sein Einfluss,
Wie der Beginn sich ergoss.
Da ist das Werk! und tönet nicht bloß, wie vollbrachte
Handlungen, nach. Wenn von diesen bis zum fernsten
Hall sich jede verlor, zum letzten
Lispel sich; redet es laut!
Nutzet, doch nicht, wie einst das Geschäft, nur an Einer
Stäte, zugleich an so vielen, als getrennte
Sich’s, nach Mühe, nach Lust, zu ihrer.
Muße Gefährten ersehn.
Rührt es, und wird die Rührung zu That; so durchwallt die
Ähnlichen Pfad mit der andern, die dem eignen
Quell entfloss. Und gelingt nicht diese
Rührung dem bleibenden oft?
Wirke! Das ist das große Gesetz, in der Halle
Marmor gehaun, dass es kund sey; und die Dauer
Liest der weisere mit, als stünd‘ es
Goldenes Gusses mit da.
Frey ist der Flug der Ode, sie kieset, wonach sie
Lüstet, und singt’s. Was verbeut ihr, dass sie leise
Schwebe, wenn sie der Schwung, der hoch jetzt
Steiget, itzt höher, nicht freut.