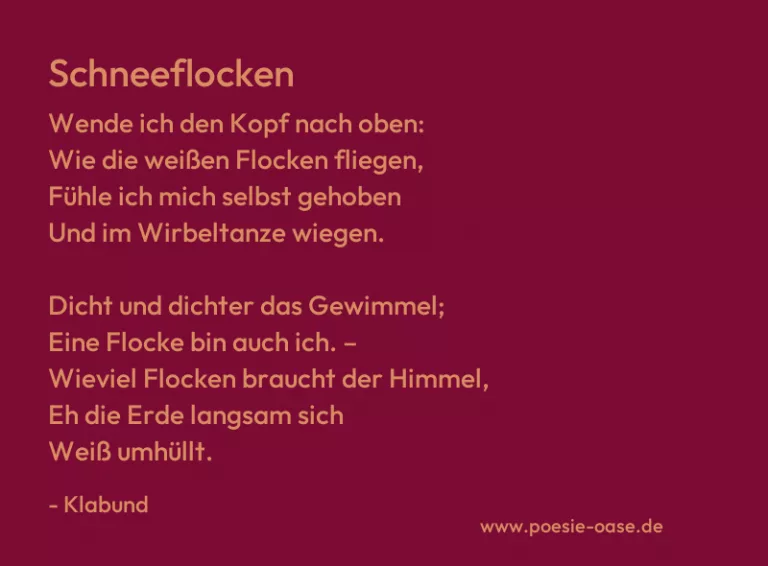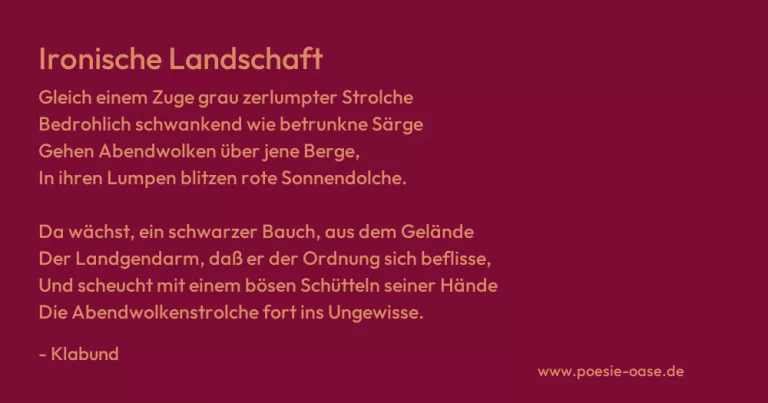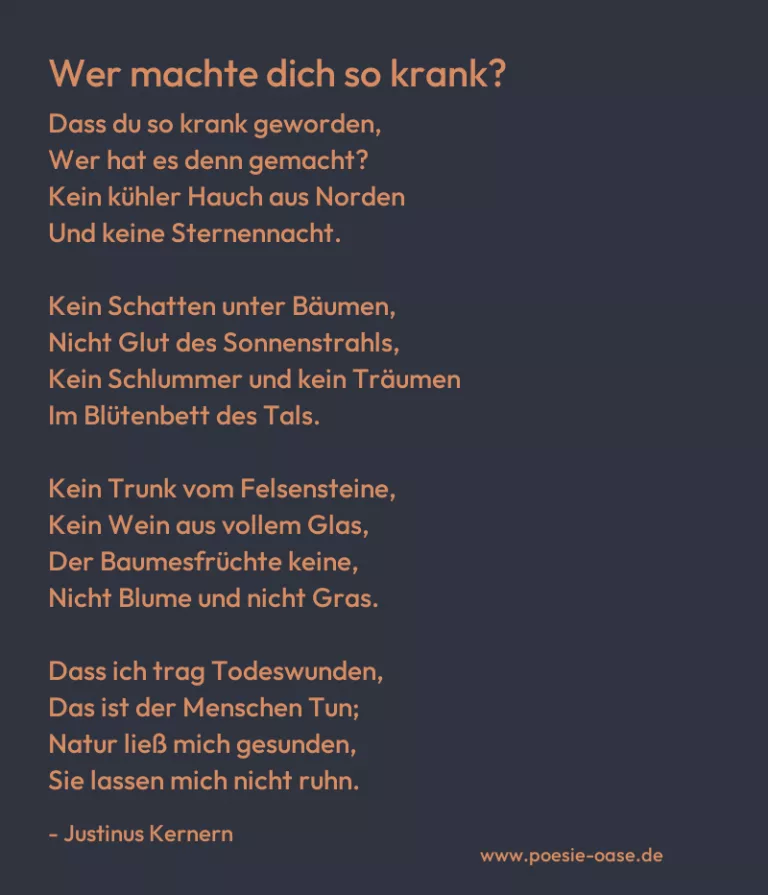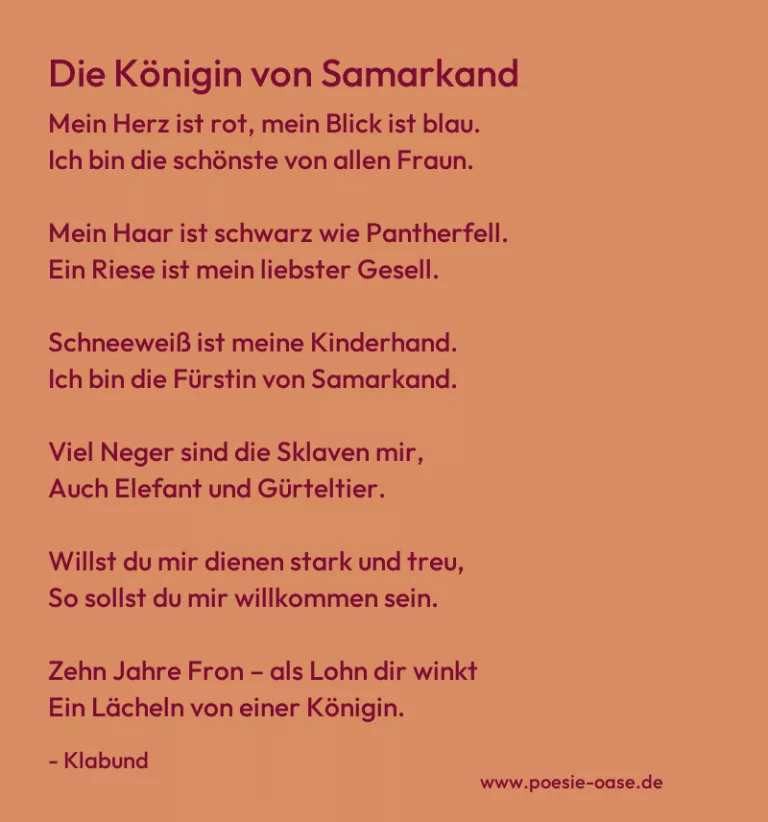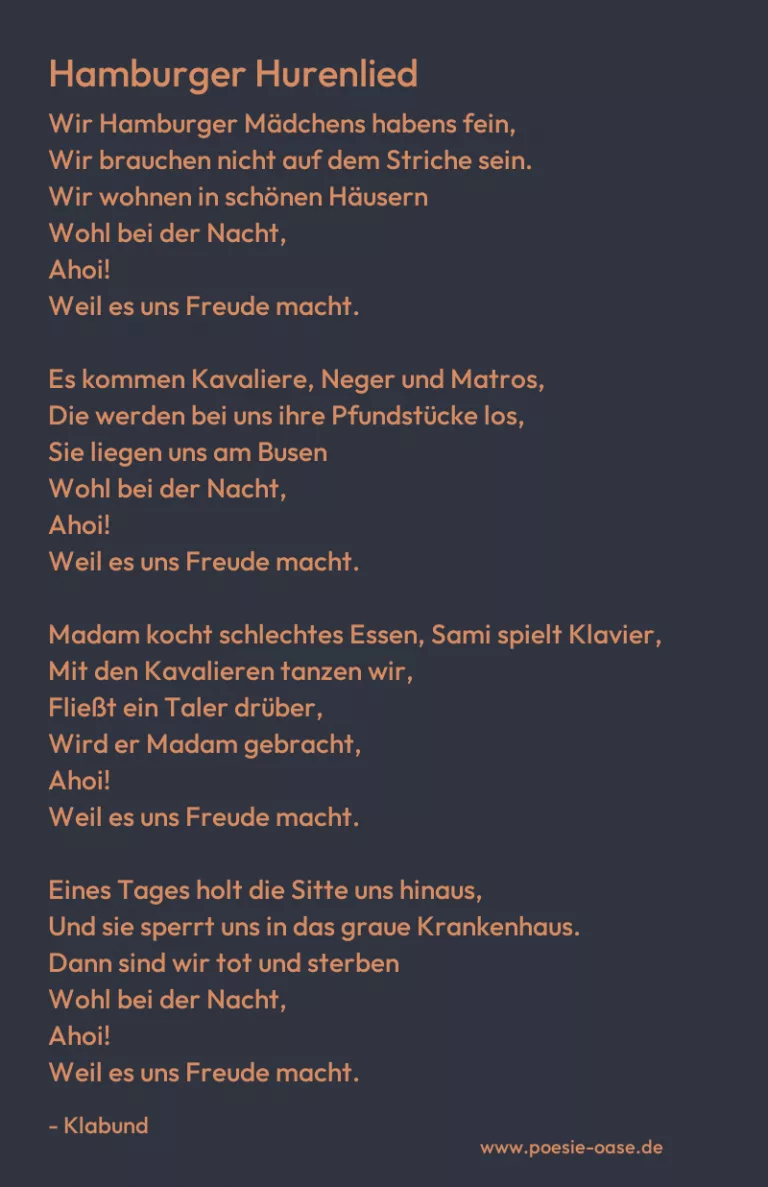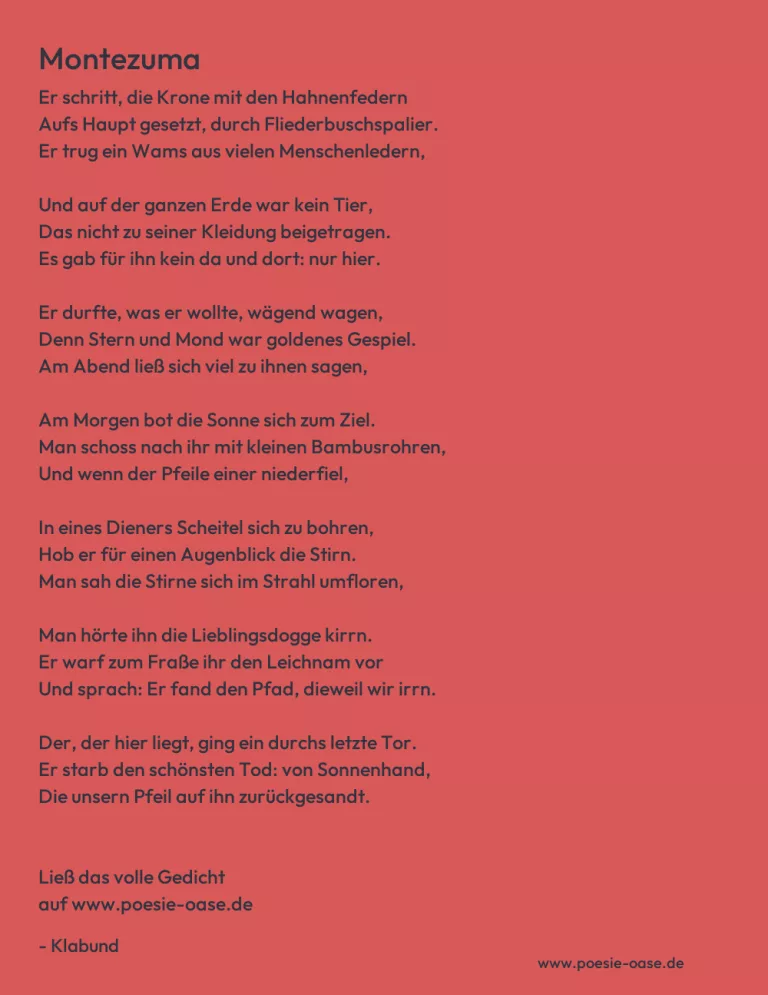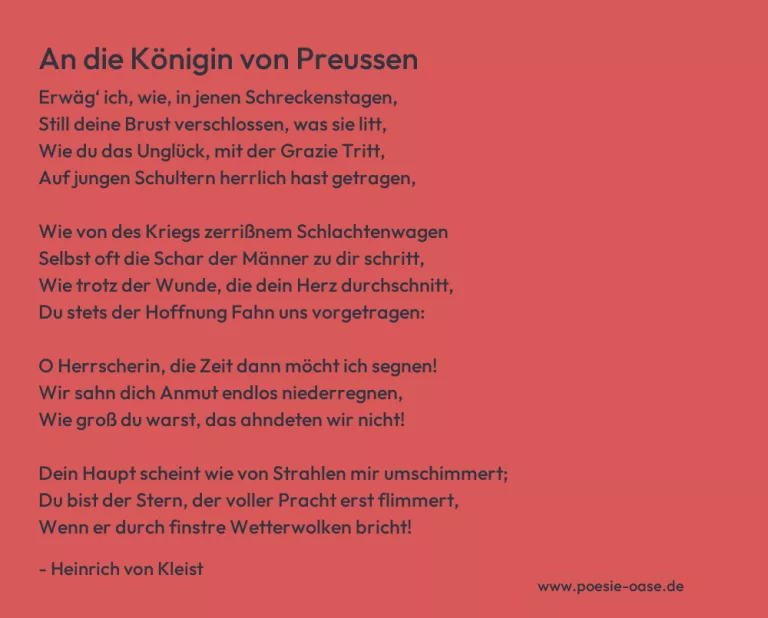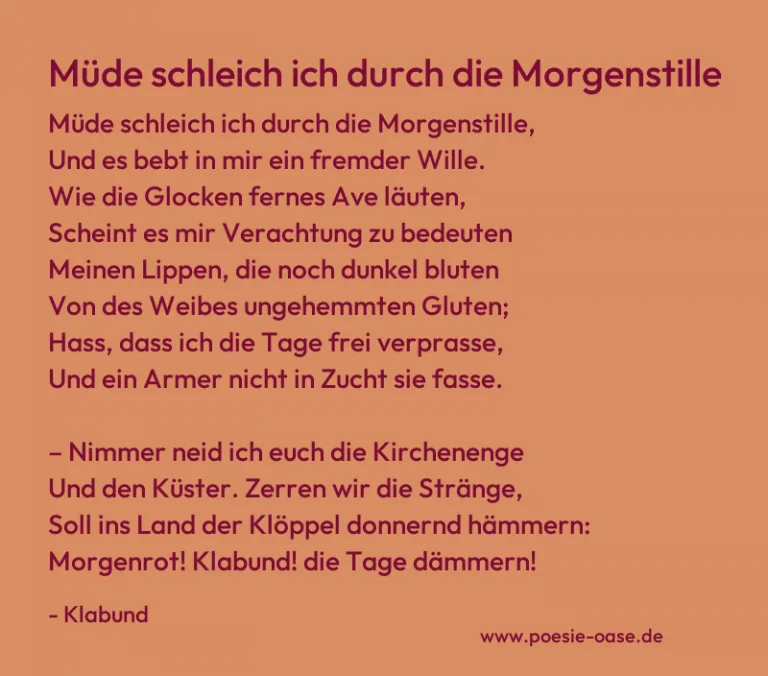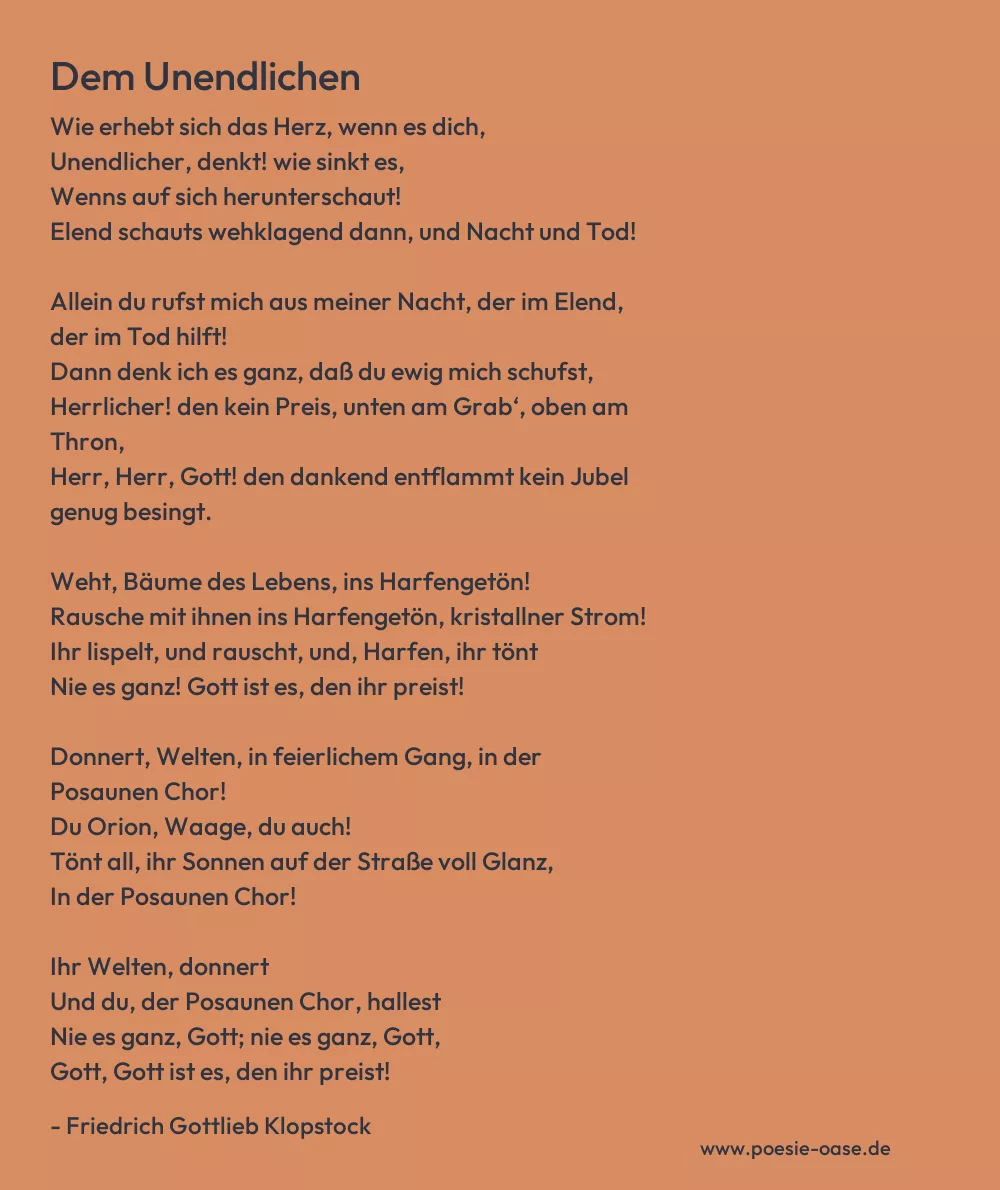Wie erhebt sich das Herz, wenn es dich,
Unendlicher, denkt! wie sinkt es,
Wenns auf sich herunterschaut!
Elend schauts wehklagend dann, und Nacht und Tod!
Allein du rufst mich aus meiner Nacht, der im Elend,
der im Tod hilft!
Dann denk ich es ganz, daß du ewig mich schufst,
Herrlicher! den kein Preis, unten am Grab‘, oben am
Thron,
Herr, Herr, Gott! den dankend entflammt kein Jubel
genug besingt.
Weht, Bäume des Lebens, ins Harfengetön!
Rausche mit ihnen ins Harfengetön, kristallner Strom!
Ihr lispelt, und rauscht, und, Harfen, ihr tönt
Nie es ganz! Gott ist es, den ihr preist!
Donnert, Welten, in feierlichem Gang, in der
Posaunen Chor!
Du Orion, Waage, du auch!
Tönt all, ihr Sonnen auf der Straße voll Glanz,
In der Posaunen Chor!
Ihr Welten, donnert
Und du, der Posaunen Chor, hallest
Nie es ganz, Gott; nie es ganz, Gott,
Gott, Gott ist es, den ihr preist!